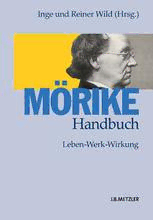Table Of ContentInge und Reiner Wild (Hrsg.)
Handbuch
Leben-Werk-Wirkung
J.B.METZLER
Inge und Reiner Wild (Hrsg.)
Mörike-Handbuch
Inge und Reiner Wild (Hrsg.) Mörike-
Mitarbeit: Ulrich Kittstein
Handbuch
Leben – Werk – Wirkung
Verlag J.B. Metzler
Stuttgart · Weimar
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-476-01812-0
ISBN 978-3-476-05247-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-05247-6
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2004 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprü nglich erschienen bei J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung
und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2004
www.metzlerverlag.de
[email protected]
V
Inhaltsverzeichnis
Vorwort VII Der junge Dichter 101
Hinweise zur Benutzung IX Der Feuerreiter 102
Peregrina I-V 103
Siglenliste, Abkürzungen X
Gesang zu zweien in der Nacht 107
An einem Wintermorgen, vor Sonnenauf-
gang 108
Biographische Grundlagen
Besuch in Urach 110
Um Mitternacht 111
Eduard Mörike. Sein Leben und seine Zeit 1 Septembermorgen 112
Begegnung / Erstes Liebeslied eines Mädchens /
Beziehungen 11 Der Gärtner 113
Im Frühling 115
Briefwerk 19
Josephine 116
Entschuldigung. An Gustav Schwab 117
Mein Fluß 118
Literatur- und kulturhistorisches Er ist’s 120
Umfeld Das verlassene Mägdlein 121
Wald-Idylle. An J.M. 122
Sonette. An L. 123
Antike 27 Gesang Weyla’s 125
Verborgenheit 126
18. Jahrhundert, Klassik, Romantik 33
Gebet 127
Zeitgenössische Literatur 43 Märchen vom sichern Mann 128
An eine Äolsharfe 129
Musik 51 Die Schwestern 131
An meinen Arzt, Herrn Dr. Elsäßer 132
Bildende Kunst 55
Ein artig Lob 133
Waldplage 133
An Longus 134
Werk Auf eine Christblume 135
An Wilhelm Hartlaub / Ländliche Kurzweil.
An Constanze Hartlaub 137
Mörike als Lyriker 59
Die schöne Buche 138
Die Überlieferung der Gedichte 68 Auf ein Ei geschrieben 140
Der Petrefaktensammler. An zwei
Naturlyrik 74 Freundinnen 141
Götterwink 142
Liebeslyrik 77
Ach nur einmal noch im Leben! 143
Balladen 81 Göttliche Reminiscenz 144
Auf einer Wanderung 145
Antikisierende Gedichte 86 An den Vater meines Pathchens 146
Erbauliche Betrachtung 147
Gelegenheitsgedichte 90
Auf eine Lampe 148
Humoristische Gedichte 95 Denk’ es, o Seele! 149
Der alte Thurmhahn. Idylle 150
Gedichte in Einzeldarstellungen 99 Erinna an Sappho 152
Erinnerung. An C.N. 99 Bilder aus Bebenhausen 154
Nächtliche Fahrt 100 »Lang, lang ist’s her«. 156
VI Inhaltsverzeichnis
Maler Nolten 157 Wirkung und Rezeption
Prosa-Erzählungen 178
Die Zeitgenossen 237
Fragment eines religiösen Romans 178
Lucie Gelmeroth 179 Vertonungen 244
Der Schatz 181
Der Bauer und sein Sohn 183 Illustrationen 248
Die Hand der Jezerte 184
Zur Forschungsgeschichte 251
Das Stuttgarter Hutzelmännlein 185
Mozart auf der Reise nach Prag 192
Idylle vom Bodensee 203 Anhang
Dramatische Werke 206
Zeittafel 257
Orplid-Werk 211
Bibliographie 260
Wispeliaden 213
Nachweis der Illustrationen 265
Vermischte Schriften 214
Verzeichnis der Beiträgerinnen und
Übersetzungen 219 Beiträger 266
Bearbeitungen 222 Register 267
Werkregister 267
Mörike als Zeichner 226 Personenregister 272
VII
Vorwort
Eduard Mörike ist einer der bedeutendsten sens, die umfassende Darstellung des Werks,
deutschsprachigen Lyriker des 19. Jahrhunderts. auch weniger bekannter und entlegener Texte
Er gehört zudem zu der Gruppe von Autoren, und Fragmente, sowie die Abbildung von Mö-
Dichtern und Philosophen aus dem deutschen rikes vielfältiger Kreativität, neben der poeti-
Südwesten, insbesondere aus Württemberg, die schen auch der zeichnerischen, kunsthandwerk-
seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts die geis- lichen, naturwissenschaftlichen, der Affinität zur
tige und kulturelle Entwicklung in Deutschland Musik und der Herausgeber- und Übersetzertä-
nachhaltig beeinflusst haben. Anders jedoch als tigkeit. Dabei wird in Korrektur des traditionel-
etwa Schiller, Hegel oder Hölderlin blieb Mörike len Mörike-Bildes, das wesentlich auf die ersten
zeitlebens der angestammten Region verhaftet. Jahrzehnte seines Lebens konzentriert ist, auch
Das gilt partiell auch für sein Werk; Gedichte wie die spätere Biographie in ihrer nicht zu unter-
Der alte Thurmhahn, das Versepos Idylle vom schätzenden Bedeutung berücksichtigt, etwa die
Bodenseesowie die Märchenerzählung Das Stutt- Gesamtheit von Mörikes Tätigkeiten nach sei-
garter Hutzelmännlein prägen die kulturelle nem Ausscheiden aus dem Pfarramt.
Identität seiner Herkunftsregion bis heute. Im Mörikes produktivste Zeit fällt in die Epoche
größten Teil seines Werks greift Mörike jedoch des Biedermeier. Mit seinem Naivitätspro-
räumlich, historisch und kulturhistorisch weiter gramm, seinem »Kult der Einzeldinge« (Fried-
aus. Zugleich reagiert er sensibel auf die Zeitum- rich Sengle) und dem Rückzug in eine ästhe-
stände und ist ein aufmerksamer Beobachter der tische Gegenwelt der ironisch oder elegisch ge-
ästhetischen, philosophischen, religionsphiloso- brochenen Idylle ist er zutiefst von der Signatur
phischen, wissenschaftlichen und auch politi- dieser Epoche geprägt. Enge des Lebensraums
schen Diskussionen seiner Zeit. Dies gilt für das und Weite des kultur- und literarhistorischen
Frühwerk, aber auch für das spätere Werk, das in Blicks sind die beiden Pole dieses Lebens, aus
der Forschung bisher eher unterschätzt wurde. deren Antagonismus oder Vermittlung Mörikes
Die literaturwissenschaftliche Beschäftigung Produktivität resultiert. Sein Werk ist ein In-
mit Mörike hat in den letzten zwanzig Jahren dikator für kulturelle und ästhetische Umbruch-
deutlich zugenommen. Große Aufmerksamkeit prozesse wie für Wandlungen des Identitätskon-
gilt nach wie vor den Gedichten; dabei zeigt eine zepts im Zuge von Modernisierungsprozessen
Reihe von kleineren Beiträgen in weiter gestreu- beim Übergang zur arbeitsteiligen Industriege-
ten Publikationen, dass Mörikes Lyrik auch au- sellschaft; es besitzt trotz politischer und gesell-
ßerhalb der Fachwissenschaft großes Interesse schaftlicher Abstinenz an der Oberfläche der
findet. Dem trägt das Handbuch mit Überblicks- Texte eine sozialpsychologische Tiefendimen-
artikeln zu lyrischen Gattungen und etwa 50 sion, die es vielfach noch zu erschließen gilt. Ein
Einzelanalysen von Gedichten Rechnung; der wesentlicher Aspekt der Darstellung im Hand-
Kanon des Bekannten und Vielzitierten wird buch ist daher die Verflochtenheit des Werks in
damit entscheidend ausgeweitet. Starke Beach- das kulturelle und literarische Umfeld der Epo-
tung hat zunehmend auch Mörikes Roman Ma- che des Biedermeier in regionaler und über-
ler Nolten gefunden; in den letzten Jahren sind regionaler Perspektive. Mörike nimmt sowohl
dazu mehr Monographien, vor allem Disserta- Themen und Formelemente der deutschen Klas-
tionen, erschienen als in den Jahrzehnten davor. sik als auch der Romantik auf. In der Tradition
Ziel des Handbuchs ist die Repräsentation des der Klassik bietet ihm die Antike wichtige ästhe-
gesammelten literaturwissenschaftlichen Wis- tische Ordnungsmuster; seine Dichtung ist seit
VIII Vorwort
den vierziger Jahren vor allem durch die kleinen des Alltags; alltägliches Leben erhält durch die
Formen der antiken Literatur geprägt. Der anti- Verwendung traditionsreicher, insbesondere an-
kisierende Ton der Lyrik bekommt durch die tiker oder antikisierender Formen die Qualität
romantisch vermittelte Vermischung mit dem humaner Grunderfahrungen. Poetisches, ge-
Bildbereich und dem Stil der Volksliedtradition formtes Sprechen ist für Mörike Medium der
eine bemerkenswerte kulturelle Tiefendimen- Alltagskommunikation, er ist ›Dichter‹ auch im
sion. Auch Mörikes realistisch-novellistisches alltäglichen Umgang mit Familie und Freunden.
Schreiben ist häufig durchsetzt mit Elementen Der selbstironische Vers »Als Dichtel hab ich
der Volksüberlieferung. Sein Werk verweist je- ausgestritten« aus dem vierzeiligen »StegreifVers-
doch zugleich durch neue Themen und Aus- lein«, das Mörike am 16. März 1849 an den
drucksformen auf spezifisch moderne Bewusst- Freund Hartlaub schickte (HKA 15, S.304), hat
seinslagen und Erfahrungsmodi gerade des sich nicht bewahrheitet; im Jahre 2004, im Jahr
Künstlers. Mehrfach sind in der Forschung Be- seines 200. Geburtstags, gehört Mörike zum
rührungspunkte mit dem zeitgenössischen l’art selbstverständlichen Kanon der deutschen Lite-
pour l’art gesehen worden, doch ist Mörike kei- ratur.
ner vom bürgerlichen Leben abgegrenzten Es bleibt zu danken: der Stiftung Landesbank
Kunstreligion verpflichtet. Vielmehr setzt er der Baden-Württemberg, die durch ihre großzügige
sich verfestigenden ›Prosa der Welt‹ und der Spende die Arbeit am Handbuch unterstützt hat,
modernen Erfahrung von ›Zerrissenheit‹ noch- Regina Cerfontaine, Hans-Ulrich Simon und vor
mals ein literarisches Programm der ästhetischen allem Albrecht Bergold von der Arbeitsstelle der
Versöhnung entgegen. Versöhnung bietet auch Historisch-kritischen Mörike-Ausgabe (Mörike-
die Musik, insbesondere die Mozarts, die thema- Archiv) am Deutschen Literaturarchiv Marbach
tisch und als sprachliche Musikalität ins Werk für hilfreiche Auskünfte und den jederzeit be-
eingeht. Literarhistorisch kommt Mörikes Dich- reitwillig gegebenen Rat, Uwe Schweikert vom
tung so eine Zwischenstellung zu; Mörikes Ei- Metzler-Verlag für die engagierte Begleitung des
genständigkeit, seine Unverwechselbarkeit grün- Projekts und Oliver Schütze für die Betreuung in
det gerade darin, dass er angesichts fortgeschrit- der Endphase; wir danken weiter Jürgen Land-
tener Modernisierungsprozesse noch einmal die wehr für Rat und Hilfe, Silke Arnold-de Simine
Ansprüche ›klassischer‹ Ästhetik mit den Erfah- und Alexander Reck für die Unterstützung bei
rungen der Moderne zu vermitteln unternimmt. der Auswahl der Illustrationen, Kai Berkes, An-
Ausgleich der Gegensätze ist auch kennzeich- dreas Gürtler sowie insbesondere Susanne Kau-
nend für den Menschen Mörike; der Blick auf lich-Koch und Markus Müller für die sorgfältige
sein Leben erweist ihn als Melancholiker mit Korrektur und den studentischen Hilfskräften
hochsensibler Kreativität, begabt jedoch auch Anja Hoffmann, Simone Weckler und Regine
mit einem ausgeprägten Sinn für Humor und Zeller für ihre intensive und gründliche Mit-
Komik. Sein Werk zeigt eine zunehmende Poeti- arbeit.
sierung, Ästhetisierung und damit Nobilitierung Die Herausgeber
IX
Hinweise zur Benutzung
Der Name »Mörike« wird mit »M.« (im Genitiv (z.B. der Verwendung lateinischer Schrift für
»M.s«) abgekürzt; ein Verzeichnis aller Siglen fremdsprachliche Wendungen) wurde verzichtet.
und Abkürzungen ist auf S. X–XII zu finden. Hervorhebungen der Verfasser erscheinen kursiv,
Titel von Primär- und Sekundärliteratur erschei- zur besonderen Kennzeichnung einzelner Wör-
nen im laufenden Text kursiv. Titel von Mörikes ter (etwa als Jargon) werden einfache Anfüh-
Werken können in Kurzform genannt sein. rungszeichen verwendet.
Mörikes Werke werden nach HKA zitiert oder, Jedem Artikel ist ein alphabetisch geordnetes
soweit beim Abschluss des Handbuchs dort noch Literaturverzeichnis angeschlossen, das neben
nicht erschienen, nach SW; es werden jeweils der im Artikel zitierten Literatur eine Auswahl
Band- und Seitenzahl angegeben. Bei bisher der einschlägigen Forschungsliteratur enthält.
nicht publizierten Werken Mörikes, die erstmals Am Ende des Handbuchs findet sich eine Biblio-
in HKA erscheinen werden, wird auf den ent- graphie zu Mörike.
sprechenden Band verwiesen (dies betrifft vor- Die Anordnung der Artikel im Abschnitt
nehmlich HKA 7). Zitate im laufenden Text sind »Werk« ist an den Gattungen orientiert; die
in doppelte Anführungszeichen, Zitate innerhalb Artikel zu den einzelnen Gedichten sind chrono-
von Zitaten in einfache Anführungszeichen ge- logisch nach den Entstehungsdaten der Gedichte
setzt. Auslassungen in Zitaten werden durch geordnet (bei Unklarheiten etwa innerhalb eines
eckige Klammern und drei Punkte gekennzeich- Jahres wurde die alphabetische Abfolge nach
net; Einfügungen der Verfasser in Zitaten stehen Titel oder Anfang des Gedichts gewählt). Auf
ebenfalls in eckigen Klammern. Die Zitate sind Verweise zwischen den Artikeln wurde verzich-
im laufenden Text, mit Angaben in runden tet; es sei stattdessen auf die Möglichkeit der
Klammern, nachgewiesen. Hervorhebungen in Erschließung des Handbuchs durch das Inhalts-
Zitaten erscheinen durchweg kursiv, auf die Wie- verzeichnis und die Register hingewiesen.
dergabe bloßer Schreibgewohnheiten Mörikes
X
Siglenliste, Abkürzungen
Mörikes Werke
HKA Mörike, Eduard: Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Im
Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg und
in Zusammenarbeit mit dem Schiller-Nationalmuseum Marbach a.N. hg. v.
Hubert Arbogast, Hans-Henrik Krummacher, Herbert Meyer u. Bernhard Zeller.
Stuttgart 1967ff.
M Mörikes Werke. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 3 Bde. Hg. von
Harry Maync. 2. Aufl. Leipzig 1914.
SW Eduard Mörike: Sämtliche Werke in zwei Bänden. Nach den Originaldrucken zu
Lebzeiten Mörikes und nach den Handschriften. Textredaktion: Jost Perfahl.
München 1967, 1970. Bd. 1: 6. Auflage Düsseldorf, Zürich 1997, mit Nachwort,
Anmerkungen, Bibliographie und Zeittafel von Helmut Koopmann; Bd. 2: 3.
Auflage Düsseldorf, Zürich 1996, mit Anmerkungen von Helmut Koopmann.
A1 Mörike, Eduard: Gedichte. Stuttgart, Tübingen 1838.
A2 Mörike, Eduard: Gedichte. 2. verm. Aufl. Stuttgart, Tübingen 1848.
A3 Mörike, Eduard: Gedichte. 3. verm. Aufl. Stuttgart, Tübingen 1856.
A4 Mörike, Eduard: Gedichte. 4. verm. Aufl. Stuttgart 1867.
Iris Mörike, Eduard: Iris. Stuttgart 1839.
Vier Erzählungen Mörike, Eduard: Vier Erzählungen. Stuttgart 1856.
Briefausgaben Mörike. Briefwechsel. Hg. v. Hildburg und
Werner Kohlschmidt. Berlin 1978.
Bauer: Briefe – Bauer, Ludwig Amandus: Briefwechsel Strauß-Vischer– Briefwech-
Briefe an Eduard Mörike. Hg. v. Bernhard sel zwischen David Friedrich Strauß und
Zeller u. Hans-Ulrich Simon. Marbach a.N. Friedrich Theodor Vischer. 2 Bde. Hg. v. Adolf
1976. Rapp. Stuttgart 1952.
Briefwechsel Heyse – Ein Gefühl der Ver- Briefwechsel Vischer – Briefwechsel zwi-
wandtschaft: Paul Heyses Briefwechsel mit schen Eduard Mörike und Friedrich Theodor
Eduard Mörike. Hg. v. Rainer Hillenbrand. Vischer. Hg. v. Robert Vischer. München
Frankfurt a.M. u.a. 1997. 1926.
Briefwechsel Kurz – Briefwechsel zwischen Seebaß 1939 – Mörike, Eduard: Briefe. Hg. v.
Hermann Kurz und Eduard Mörike. Hg. v. Friedrich Seebaß. Tübingen 1939.
Jakob Baechtold. Stuttgart 1885. Seebaß 1941 – Mörike, Eduard: Unveröffent-
Briefwechsel Schwind – Briefwechsel zwi- lichte Briefe. Hg. v. Friedrich Seebaß. Stuttgart
schen Eduard Mörike und Moriz v. Schwind. 1941.
Hg. v. Hanns Wolfgang Rath. 2., um vier Seebaß 1945 – Mörike, Eduard: Unveröffent-
Briefe vermehrte Aufl. Stuttgart o.J. lichte Briefe. Hg. v. Friedrich Seebaß. 2., um-
[1920]. gearb. Aufl. Stuttgart 1945.
Briefwechsel Storm – Theodor Storm – Strauß: Briefe – Strauß, David Friedrich:
Eduard Mörike. Theodor Storm – Margarethe Ausgewählte Briefe. Hg. u. erläutert v. Eduard
Zeller. Bonn 1895.