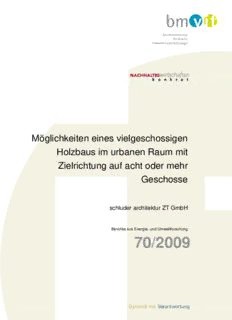Table Of ContentMöglichkeiten eines vielgeschossigen
Holzbaus im urbanen Raum mit
Zielrichtung auf acht oder mehr
Geschosse
schluder architektur ZT GmbH
Berichte aus Energie- und Umweltforschung
70/2009
Impressum:
Eigentümer, Herausgeber und Medieninhaber:
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Verantwortung und Koordination:
Abteilung für Energie- und Umwelttechnologien
Leiter: DI Michael Paula
Liste aller Berichte dieser Reihe unter http://www.nachhaltigwirtschaften.at
Möglichkeiten eines vielgeschossigen
Holzbaus im urbanen Raum mit
Zielrichtung auf acht oder mehr
Geschosse
schluder architektur ZT GmbH
DI Peter Krabbe, Architekt DI Michael Schluder
TU Wien, ITI
Holzforschung Austria / Bautechnik
WIEHAG Holding GMBH
Vasko + Partner Ingenieure ZT GmbH
UNIQA Sachversicherungen
brand Rat ZT GmbH
PE CEE GmbH
Rhomberg Bau GmbH
Arsenal Research
Wien, November 2008
Ein Projektbericht im Rahmen der Programmlinie
Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften
Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie
Vorwort
Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines beauftragten Projekts aus der
Programmlinie Haus der Zukunft im Rahmen des Impulsprogramms Nachhaltig Wirtschaften,
welches 1999 als mehrjähriges Forschungs- und Technologieprogramm vom Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie gestartet wurde.
Die Programmlinie Haus der Zukunft intendiert, konkrete Wege für innovatives Bauen zu
entwickeln und einzuleiten. Aufbauend auf der solaren Niedrigenergiebauweise und dem
Passivhaus-Konzept soll eine bessere Energieeffizienz, ein verstärkter Einsatz erneuerbarer
Energieträger, nachwachsender und ökologischer Rohstoffe, sowie eine stärkere
Berücksichtigung von Nutzungsaspekten und Nutzerakzeptanz bei vergleichbaren Kosten zu
konventionellen Bauweisen erreicht werden. Damit werden für die Planung und Realisierung von
Wohn- und Bürogebäuden richtungsweisende Schritte hinsichtlich ökoeffizientem Bauen und
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise in Österreich demonstriert.
Die Qualität der erarbeiteten Ergebnisse liegt dank des überdurchschnittlichen Engagements
und der übergreifenden Kooperationen der Auftragnehmer, des aktiven Einsatzes des
begleitenden Schirmmanagements durch die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und
Technik und der guten Kooperation mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft
bei der Projektabwicklung über unseren Erwartungen und führt bereits jetzt zu konkreten
Umsetzungsstrategien von modellhaften Pilotprojekten.
Das Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften verfolgt nicht nur den Anspruch, besonders
innovative und richtungsweisende Projekte zu initiieren und zu finanzieren, sondern auch die
Ergebnisse offensiv zu verbreiten. Daher werden sie in der Schriftenreihe publiziert, aber auch
elektronisch über das Internet unter der Webadresse http://www.HAUSderZukunft.at
Interessierten öffentlich zugänglich gemacht.
DI Michael Paula
Leiter der Abt. Energie- und Umwelttechnologien
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Inhaltsverzeichnis
1. Kurzfassung des Forschungsprojektes achtplus........................................................ 9
1.1. Kurzfassung............................................................................................................... 9
1.2. Abstract (english)......................................................................................................10
2. Projektabriss.............................................................................................................11
2.1. Braucht Stadt Holz?..................................................................................................11
2.2. Die Projektphasen....................................................................................................12
2.3. Der Arbeitsablauf......................................................................................................14
2.4. Die Untersuchungsergebnisse..................................................................................14
2.5. Der Blick nach vorne.................................................................................................16
3. Einleitung..................................................................................................................17
3.1. Motivation.................................................................................................................17
3.2. Initiierung der erweiterten Feasibility study achtplus.................................................18
3.3. Verfolgte Ziele...........................................................................................................20
3.4. Die Arbeitspakete.....................................................................................................20
3.5. Änderungen der Projektphasen................................................................................21
4. Projektphasen...........................................................................................................23
4.1. Projektphase 1, Positionierung.................................................................................23
4.1.1. Zusammenfassung...................................................................................................23
4.1.2. Rhomberg Bau GmbH; Mag. Michael Zangerl; DI Ulrich Forster...............................25
4.1.3. schluderarchitektur ZT GmbH; DI Michael Schluder, DI Peter Krabbe......................27
4.1.4. PE CEE GmbH; Dr. DI Merl.....................................................................................29
4.2. Projektphase 2, Typenentwicklung............................................................................36
4.2.1. Zusammenfassung...................................................................................................36
4.2.2. Schluder Architektur ZT GmbH; DI Michael Schluder, DI Peter Krabbe....................37
4.2.3. Brandrat ZT GmbH; DI Frank Peter..........................................................................53
4.2.4. Besprechungsprotokoll.............................................................................................55
4.3. Projektphase 3, Tragwerksentwicklung.....................................................................61
4.3.1. Zusammenfassung...................................................................................................61
6
4.3.2. TU Wien, ITI; Professor DDI Wolfgang Winter, Dr. DI Kamyar Tavoussi; Dr. DI
Yoshiaki Amino, MSc Tamir Pixner...........................................................................64
4.3.3. Vasko & Partner Ingenieure ZT GmbH; Lothar Heinrich............................................79
4.3.4. WIEHAG Holding GmbH; DI Alfons Brunauer...........................................................82
4.4. Projektphase 4, Konstruktive Untersuchung.............................................................89
4.4.1. Zusammenfassung...................................................................................................89
4.4.2. schluderarchitektur ZT GmbH; DI Michael Schluder, DI Peter Krabbe......................90
4.4.3. Holz Forschung Austria; DI Peter Schober, Dr. DI Martin Teibinger..........................95
4.4.4. TU Wien, ITI; Professor DDI Wolfgang Winter, Dr. DI Kamyar Tavoussi; Dr. DI
Yoshiaki Amino, MSc Tamir Pixner...........................................................................99
4.4.5. Protokoll der Besprechung vom 3.Juli 2008..............................................................99
4.5. Projektphase 5 , Workshop.....................................................................................103
4.5.1. Zusammenfassung.................................................................................................103
4.5.2. Protokoll..................................................................................................................104
4.6. Projektphase 6, Bewertung.....................................................................................110
4.6.1. Zusammenfassung.................................................................................................110
4.6.2. Vasko & Partner Ingenieure ZT GmbH; Lothar Heinrich..........................................112
4.6.3. UNIQA Sachversicherungen AG; Alexander Huter, Oliver Weghaupt.....................121
4.6.4. BrandRat ZT GmbH; DI Frank Peter.......................................................................129
4.6.5. PE CEE GmbH; Dr. DI Adolf Merl...........................................................................135
4.6.6. Rhomberg Bau GmbH; Mag Michael Zangerl, DI Ulrich Forster..............................156
5. Zusatz Energie........................................................................................................164
5.1. Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal GmbH; Ing. Anita Preisler,
MASc.B.eng Patrice Pinel.......................................................................................164
5.1.1. Gebäude Modell.....................................................................................................164
5.1.2. Ergebnisse der Simulation......................................................................................170
5.1.3. Energiebedarf der Anlage.......................................................................................180
5.1.4. Schlussfolgerungen................................................................................................181
6. Schlussfolgerung zu den Projektergebnissen..........................................................183
6.1. Leitprinzipien nachhaltiger Technologieentwicklungen............................................183
6.2. Zusammenfassung der Ergebnisse nach Projektphasen........................................183
6.2.1. Typenentwicklung...................................................................................................183
6.2.2. Tragwerksentwicklung............................................................................................183
6.2.3. Konstruktive Untersuchung.....................................................................................184
7
6.2.4. Positionierung.........................................................................................................186
6.2.5. Bewertung des Projektes anhand unterschiedlicher Expertisen..............................188
6.3. Einbeziehung der Zielgruppen................................................................................191
6.4. Das Marktpotenzial des vielgeschossigen Holzbaus...............................................192
6.5. Das Potenzial für ein Demonstrationsprojekt..........................................................193
6.6. Erkenntnisse für das Projektteam...........................................................................193
7. Ausblick und Empfehlungen....................................................................................195
7.1. Chancen und Risken eines Demonstrationsprojektes.............................................195
7.2. Weiterführende Arbeiten.........................................................................................196
7.3. Weiterführende Projekte.........................................................................................196
8. Tabelle....................................................................................................................198
9. Abbildung................................................................................................................199
10. Literatur..................................................................................................................202
11. Anhang...................................................................................................................204
11.1. Weiterführende Literatur.........................................................................................204
11.2. Protokolle................................................................................................................211
11.2.1. Protokolle 1 – Kickoff Meeting, 07 August 2007......................................................211
11.2.2. Protokolle 2 – Meeting 3, 21 September 2007 ( Siehe Seite 56 )............................215
11.2.3. Protokolle 3 – Meeting 4, 09 November 2007 ( Siehe Seite 58 ).............................215
11.2.4. Protokolle 4 – Meeting 5, 13 December 2007.........................................................215
11.2.5. Protokolle 5 – Workshop Meeting, 20 June 2008 ( Siehe Seite 104 )......................217
11.2.6. Protokolle 6 – Meeting 7, 03 Juli 2008 ( Siehe Seite 99 )........................................217
8
1. Kurzfassung des Forschungsprojektes achtplus
1.1. Kurzfassung
Acht oder mehr Geschosse aus Holz – im Projekt achtplus wird erforscht, ob und wie diese
Vision zur Realität werden kann. Will man den Holzbau als ebenbürtige Alternative im
Bauwesen etablieren, müssen Strategien des Bauens mit Holz im urbanen Raum erprobt
werden. Achtplus behandelt dieses komplexe Thema im Rahmen einer erweiterten
Machbarkeitsstudie. Das vorliegende Forschungskonzept stützt sich im Wesentlichen auf
vier Säulen:
o Entwicklung und Untersuchung eines städtisch geeigneten Hochhaustypus – acht
oder mehr Geschosse – in Holzverbundbauweise mit Büronutzung.
o Grundsätzliche Untersuchung der Machbarkeit in Bezug auf Tragwerk, Vorfertigung
und Montage sowie Klärung des Brand- und Personenschutzes.
o Erstellen einer systematischen Stärken-Schwächen-Analyse samt Kostenermittlung
zur Evaluierung der Konstruktion inklusive einer Risikoanalyse des Projektes samt
Versicherungsmodell.
o Marktorientierten Positionierung der Typologie in Bezug auf die ökonomische und
ökologische Relevanz im städtischen Kontext im Sinne nachhaltiger Entwicklung.
Methodik der Forschungsarbeit
Erarbeiten der Großziele in Arbeitssitzungen mit allen Projektbeteiligten (siehe
Projektbeteiligtenblatt). Die Bearbeitung der einzelnen Themen erfolgt in Kleingruppen. Die
Zusammenführung und Diskussion der Ergebnisse finden in der großen Runde statt.
Ergebnisse
o Es wurden 20 Regelgeschosse in Holzbauweise untersucht und auch rechnerisch
nachgewiesen. Berechnung nach Euro-Code.
o Die wesentlichen ökonomischen Faktoren für die Umsetzung des Projektes liegen im
Rohbau. Vier unterschiedliche Konstruktionsweisen wurden für die tragende
Holzstruktur untersucht und miteinander verglichen. Alle Konstruktionsarten wurden
statisch vorbemessen und für tauglich befunden.
o Alle Holzkonstruktionen wurden kalkuliert und monetär bewertet.
o Für Kern-Typus wurde eine Vergleichskalkulation in Massivbauweise erstellt und dem
Holzbau gegenübergestellt. Resultat: Der Holzbau liegt in den Errichtungskosten um
12 % höher als der Massivbau.
o Für den Brandschutz wurde die Anforderungen für Hochhäuser (ONR 22000) als
Basis herangezogen. Ausnahme: Verwendung von brennbaren anstatt nicht
brennbaren Baustoffen. Brandschutz und Evakuierung wurden nachgewiesen.
o Alle Risiken für Personen in einem solchen Gebäude können minimal gehalten
werden, zudem werden alle Sicherheiten bewusst erhöht.
o Das Bürogebäude ist im Passivhausstandard möglich, sowohl in Bezug auf die
Heizlast als auch auf die Kühllast. Voraussetzung dafür sind beste Verglasung,
9
Description:B.eng Patrice Pinel. Dieser Bericht beinhaltet erste Analysen Loren, P: Die Sakya-Pagode von Yingxian. Der älteste erhaltene mehrgeschossige.