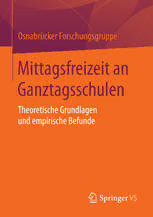Table Of ContentMittagsfreizeit an Ganztagsschulen
Osnabrücker Forschungsgruppe
Mittagsfreizeit an
Ganztagsschulen
Theoretische Grundlagen und
empirische Befunde
Osnabrücker Forschungsgruppe
Universität Osnabrück
Deutschland
ISBN 978-3-658-11622-4 ISBN 978-3-658-11623-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-11623-1
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbi-
bliogra(cid:191) e; detaillierte bibliogra(cid:191) sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikrover(cid:191) lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Lektorat: Stefanie Laux, Stefanie Loyal
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Fachmedien Wiesbaden ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
(www.springer.com)
Vorwort
Das vorliegende Buch entstand im Rahmen eines fachspezifischen Studienprojekts
im Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften an der Universität Osnabrück.
Unter der Leitung von Jun.-Prof. Dr. Ahmet Derecik wurde das Projekt zur „Be-
deutung der Mittagsfreizeit für Jugendliche an Ganztagsgymnasien“ zwei Semester
lang im Zeitraum von Oktober 2014 bis Juli 2015 koordiniert und durchgeführt.
In diesem projektorientierten Seminar waren insgesamt 13 studentische ‚Mitar-
beiter/-innen‘ mit vollem Einsatz involviert, weshalb es in einem relativ kurzen
Zeitrahmen umgesetzt und abgeschlossen werden konnte. Nachdem die im Vorfeld
des Seminars bereits weitgehend verfassten theoretischen Grundlagen zur Pro-
jekttheorie diskutiert worden sind, fand eine gemeinsame Methodenentwicklung
und -schulung statt. Im Anschluss daran wurde – den vier theoretisch ermittelten
Bedeutungszuweisungen zur Pause entsprechend (Produktionsfaktor für den Un-
terricht, Sicherheitsförderung, Gesundheitsförderung, Sozialraum) – durch vier
Teilgruppen die Datenerhebung und -auswertung durchgeführt. Um dieses Buch
publizieren zu können, wurden anschließend von den Projektteilnehmer/-innen
– entsprechend ihrer individuellen Stärken – alle bis dahin verfassten Kapitel im
Sinne einer Endredaktion noch einmal überarbeitet und optimiert. Ohne weiter
auf die Umsetzung des vorliegenden Forschungsprojektes einzugehen (vgl. Kap.
5), bestand ein übergeordnetes Ziel des fachspezifischen Studienprojekts darin,
mittels projektorientierten Lernens innerhalb der universitären Ausbildung eine
Verbindung von Wissenschaft und Lehre herzustellen. Mit der Publikation der
Ergebnisse des Studienseminars in Form des vorliegenden Buches soll darüber
hinaus das Potenzial der Studierenden für die Wissenschaft demonstriert werden.
Die Projektleitung und die -mitarbeiter/innen (Janina Kordes, Lorena Menze,
Verena Mielke, Janna Michel, Teresa Placke, Rosanna Reuter, Matthias Runde,
Vivien Schlattmann, Stefan Sträche) hoffen, dass dies gelingt und dieses Vorgehen
vielleicht sogar auch auf Nachahmung stößt. Damit könnte in der Lehre ein Beitrag
zum „signifikanten Lernen“ (Rogers, 1974) von Studierenden geleistet werden.
VI Vorwort
Über den engen Kern an studentischen ‚Mitarbeiter/-innen‘ hinaus waren noch
weitere studentische ‘Hilfskräfte‘ an verschiedenen Phasen des Projektes beteiligt.
Mareike Fischer und Tobias Nubbemeyer danken wir für ihren Einsatz zur Metho-
denentwicklung sowie Datenerhebung und -auswertung in einem Teilprojekt. Marie
Goutin und Julia Matussek gilt unser Dank für die Unterstützung beim Verfassen
von einzelnen Kapiteln zur Theorie. Abschließend danken wir ganz besonders
den teilnehmenden Schulen und vor allem den Jugendlichen, ohne deren Beiträge
dieses Projekt nicht hätte umgesetzt werden können.
Inhalt
Vorwort ............................................................. V
1 Einleitung ....................................................... 1
1.1 Forschungsstand zur Bedeutung der Pausen in (Ganztags-)Schulen .. 3
1.2 Ziele und Aufbau des Buches .................................. 11
2 Pausen in der Ganztagsschule ..................................... 15
2.1 Begründungen und Formen ................................... 16
2.2 Taktung und Rhythmisierung ................................. 18
2.3 Zeitstrukturierungsmodelle ................................... 22
2.4 Formen von Pausen .......................................... 29
2.4.1 Minipause, kleine Pause und große Pause ................. 29
2.4.2 Mittagsfreizeit ......................................... 31
3 Bedeutungen der Pausen in der Ganztagsschule ..................... 37
3.1 Historische Entwicklung der Pausen in der (Ganztags-)Schule .... 38
3.2 Pause als Produktionsfaktor für den Unterricht .................. 41
3.2.1 Erholung und Leistungssteigerung durch Bewegung
und Ruhe ............................................. 41
3.2.2 Vor- und Nachbereitung des Unterrichts .................. 46
3.3 Pause als Element der Sicherheitsförderung ...................... 47
3.3.1 Pausenregeln .......................................... 48
3.3.2 Aufsicht ............................................... 51
3.4 Pause als Element der Gesundheitsförderung .................... 53
3.4.1 Gesundheitsförderung durch Bewegung .................. 54
3.4.2 Gesundheitsförderung durch Ruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4.3 Gesundheitsförderung durch Mittagessen ................. 59
VIII Inhalt
3.5 Pause als Sozialraum ......................................... 62
3.5.1 Kompensation der (verlorenen) Freizeit ................... 63
3.5.2 Treffpunkt und Kontaktbörse ............................ 64
3.5.3 Bedeutung von Freundschaftsbeziehungen ................ 66
3.5.4 Informelle Pausenaktivitäten von Heranwachsenden ....... 68
3.5.5 Informeller Kompetenzerwerb ........................... 71
4 Zusammenfassung und Fragestellung .............................. 75
5 Untersuchungskonzeption ........................................ 81
5.1 Stichprobe ................................................... 81
5.2 Untersuchungsmethode ....................................... 82
5.3 Durchführung der Untersuchung .............................. 84
5.3.1 Leitfadenkonstruktion und Pilotphase .................... 84
5.3.2 Interviewdurchführung ................................. 86
5.3.3 Auswertung ........................................... 89
6 Untersuchungsergebnisse ......................................... 93
6.1 Allgemeine Aspekte zur Bedeutung der Mittagsfreizeit ........... 93
6.1.1 Einschätzungen der Jugendlichen zur Dauer
der Mittagsfreizeit ...................................... 94
6.1.2 Hauptaktivitäten der Jugendlichen in der Mittagsfreizeit .... 98
6.1.2.1 Ruhe und Kommunikation ....................... 98
6.1.2.2 Bewegung ..................................... 102
6.1.3 Zusammenfassende Diskussion ......................... 105
6.2 Mittagsfreizeit als Produktionsfaktor für den Unterricht ......... 108
6.2.1 Erholung in der Mittagsfreizeit zur Steigerung der
Leistungsfähigkeit ..................................... 109
6.2.1.1 Bedeutung der Bewegung und Ruhe .............. 109
6.2.1.2 Bedeutung des Luftschnappens .................. 114
6.2.1.3 Klassenraumverhalten .......................... 115
6.2.2 Vor- und Nachbereitung des Unterrichts ................. 118
6.2.3 Zusammenfassende Diskussion ......................... 122
6.3 Mittagsfreizeit als Element der Sicherheitsförderung ............. 125
6.3.1 Unfall- und Risikosituationen .......................... 126
6.3.2 Vorsichtsmaßnahmen der Schulen durch Pausenregeln .... 132
6.3.3 Vorsichtsmaßnahmen der Schulen durch Aufsicht ......... 138
6.3.4 Zusammenfassende Diskussion ......................... 145
Inhalt IX
6.4 Mittagsfreizeit als Element der Gesundheitsförderung ........... 149
6.4.1 Bedeutung der Bewegung .............................. 149
6.4.2 Bedeutung der Ruhe ................................... 155
6.4.3 Bedeutung des Mittagessens ............................ 161
6.4.4 Zusammenfassende Diskussion ......................... 163
6.5 Mittagsfreizeit als Sozialraum ................................ 167
6.5.1 Kompensation für die verlorene Freizeit am Nachmittag ... 167
6.5.2 Treffpunkt und Kontaktbörse ........................... 172
6.5.3 Freundschaftsbeziehungen von Jugendlichen ............. 175
6.5.3.1 Klasseninterne vs. klassenübergreifende
Freundschaften ................................ 178
6.5.3.2 Geschlechtshomogene vs. geschlechtsheterogene
Freundschaften ................................ 180
6.5.4 Gesprächsthemen ..................................... 181
6.5.5 Informeller Kompetenzerwerb .......................... 184
6.5.6 Hierarchien, Konflikte und Mobbing während der
Mittagsfreizeit ........................................ 186
6.5.7 Nutzung von Smartphones ............................. 190
6.5.8 Zusammenfassende Diskussion ......................... 193
7 Zusammenfassung .............................................. 201
8 Ausblick ........................................................ 209
Literatur ........................................................... 215
1
Einleitung
1 Einleitung
„Die Pausen dienen der Erholung. Sie wird bei rund 500 Schülern am besten gewährleis-
tet, wenn alle langsam auf dem Hof herumgehen (Kreisverkehr)“ (Asztalos, 1982, S. 6).
Dieses aus einer alten Schulordnung eines Berliner Gymnasiums entnommene
Zitat liest sich wie ein Auszug aus einem Gefängnis-Reglement und ist in seiner
Funktion längst überholt. Im Zuge der Entwicklung von Ganztagsschulen werden
den Heranwachsenden Mittagsfreizeiten ermöglicht, die als „Herzstück“ eines
sinnvoll rhythmisierten Schultages betrachtet werden (Fiegenbaum, 2011, S. 63;
vgl. Holtappels, 1994, S. 109-113). Allerdings ist die in der Regel 40-60 minütige
Mittagsfreizeit das Element in der Ganztagsschulentwicklung, mit dem die Schulen
die wenigsten Erfahrungen haben. Höhmann (vgl. 2005, S. 90) resümiert deshalb,
dass die Gestaltung der Mittagsfreizeit von hoher Bedeutung und dennoch ein
häufig vergessener Bestandteil von Ganztagsschule ist, der in der Praxis häufig als
leere Zeit wahrgenommen wird.
Dies kann unter anderem daran liegen, dass die Funktionen von Pausen auch
in der Theorie weitgehend vernachlässigt werden. In den theoretischen Grund-
lagenwerken zur Ganztagsschule, u. a. „Die Ganztagsschule: Alltag, Reform, Ge-
schichte, Theorie“ (vgl. Ladenthin & Rekus, 2005), „Handbuch Ganztagsschule.
Praxis – Konzepte – Handreichungen“ (Appel & Rutz, 2005) oder „Einführung
Ganztagsschule“ (vgl. Coelen & Stecher, 2014), wird den Bedeutungen der Pausen
kein eigener Stellenwert eingeräumt. Selbst in der fast 1.000 Seiten umfangreichen
Veröffentlichung „Grundbegriffe Ganztagsbildung“ (Coelen & Otto, 2008) wird
darauf nicht explizit eingegangen. Die allgemeinen empirischen Untersuchun-
gen zur Ganztagsschule, u. a. die Studien zur Entwicklung von Ganztagsschulen
(StEG-Studien) (vgl. Holtappels, Klieme, Rauschenbach, Stecher, 2007; Radisch,
2009; Prüß, Kortas & Schöpa, 2009; Fischer, Holtappels, Klieme, Rauschenbach,
Stecher & Tüchner, 2011), die Begleitstudien zur Offenen Ganztagsschule im Prim-
arbereich des wissenschaftlichen Kooperationsverbundes in Nordrhein-Westfalen
O. Forschungsgruppe, Mittagsfreizeit an Ganztagsschulen,
DOI 10.1007/978-3-658-11623-1_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2016