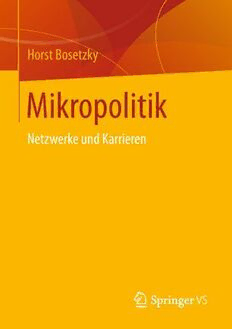Table Of ContentHorst Bosetzky
Mikropolitik
Netzwerke und Karrieren
Mikropolitik
Horst Bosetzky
Mikropolitik
Netzwerke und Karrieren
Horst Bosetzky
Berlin, Deutschland
ISBN 978-3-658-23138-5 ISBN 978-3-658-23139-2 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-23139-2
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Redaktion: Stefan Kühl und Christel Vinke
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Inhaltsverzeichnis
1 Mikropolitik, Machiavellismus und Machtkumulation . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Die einzelnen Formen von Autorität und ihre
Auf- bzw. Abwertung durch mikropolitische Aktivitäten . . . . . . . . . 2
1.2 Machtbesitz als persönliches Motiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Machtkumulation und machiavellistisches Handeln . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Funktionen und Dysfunktionen der Mikropolitik . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Die bewusste Schaffung von Unklarheit
als innerorganisatorisches Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Schaffung von Unklarheit als Mittel der Herrschaftssicherung . . . . . 12
2.2 Die Schaffung von Unklarheit als Mittel zum Aufbau
von Gegenmacht und zur Erringung von Freiräumen . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Unklarheit als Mittel im mikropolitischen Kampf
um Macht, Prestige und Aufstieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Schaffung von Unklarheit als Mittel zum Abbau
von Entfremdung und Abhängigkeitsgefühlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5 Die Tendenz zur Entorganisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 Das Don-Corleone-Prinzip in Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1 Zur Verteilung von Macht in Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Die Verpfl ichtung zur Gegenleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 Selbsterfüllende Prophezeiungen in Machtprozessen . . . . . . . . . . . . 34
4 Der Prinz-von-Homburg-Effekt – Zum Überleben in Organisationen . 37
4.1 Abweichendes Verhalten als Notwendigkeit und als Gefahr . . . . . . . 38
4.2 Heinrich von Kleist als Organisationsoziologe . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3 Leistung und Loyalität als die wichtigsten Aufstiegskriterien . . . . 42
V
VI Inhaltsverzeichnis
5 Das Verdrängen bürokratischer Elemente
als Organisationsnotwendigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1 Die bürokratische Grundstruktur der Organisation . . . . . . . . . . . . . . 46
5.2 Nichtbürokratische Elemente der Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.3 Widersprüchliche Normen und die Verdrängung
und Verdeckung bürokratischer Elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.4 Die Nutzung von Freiräumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.5 Zum Verhalten in bürokratischen Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . 54
6 Zur Maxime „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ . . . . . . . . . . . . 59
6.1 Gründe für die Kontrolle in Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.2 Konsequenzen fehlenden Vertrauens in Organisationen . . . . . . . . . . . . 62
6.3 Der Charme des Misstrauens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7 Systemimmanente Grenzen einer planvollen Verwaltungsführung . . 67
7.1 Abweichendes Verhalten und organisationsinterne Anomie . . . . . . . 68
7.2 Anarchische Tendenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.3 Arbeitsplatzautonomie und die Aufhebung der Funktion
von Vorgesetzten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.4 Jenseits des Bildes der Maschinerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8 Die instrumentelle Funktion der Beförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
8.1 Die Grenzen strukturell-funktionaler Untersuchungen
von Beförderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
8.2 Instrumentalisierung durch die Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.3 Promotionsbeziehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8.4 Funktionen der machtpolitischen Instrumentalisierung
des Aufstiegssystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
8.5 Risiken von Promotionsbündnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
8.6 Zusammenwirken der Funktionen des Aufstiegs systems . . . . . . . . . 88
8.7 Zur Verbreitung von Promotionsbündnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
9 Dunkelfaktoren bei der Beförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
9.1 Promotionsbeziehungen in Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9.2 Instrumentalisierung der Bediensteten
durch andere Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
9.3 Schwierigkeiten der Personalbesetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Inhaltsverzeichnis VII
10 Das „Wegloben“ als Sonderform vertikaler Mobilität . . . . . . . . . . . . . 101
10.1 Gründe für das Wegloben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
10.2 Vorteile des Weglobens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
10.3 Wegloben als Strategie der Mikropolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
10.4 Gefährdung der Organisationsziele durch das Wegloben . . . . . . . . 105
11 Ordnung ist das halbe Leben – und die andere Hälfte …? . . . . . . . . . 107
11.1 Dysfunktionale Folgen übersteigerter Ordnung . . . . . . . . . . . . . . . 108
11.2 Unordnung und Chaos als unvermeidliche und funktionale
Elemente großer Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
11.3 Instrumentelle Motive zur Störung von Ordnung
und zur Boykottierung der Arbeit Anderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
11.4 Positive Folgen von Unordnung und Chaos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
11.5 Lob und Notwendigkeit von Unordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
12 Die unterschiedlichen Funktionen von Betriebsausfl ügen und Feiern . 115
12.1 Der Nutzen für informelle Gruppen und formelle Arbeitsgruppen . . 116
12.2 Mikropolitik auf Betriebsausfl ügen und Feiern . . . . . . . . . . . . . . . . 118
12.3 Zur Rolle des Alkohols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
13 Die „kameradschaftliche Bürokratie“
und die Grenzen der wissenschaftlichen Untersuchung . . . . . . . . . . . 121
13.1 Die Herausbildung der „kameradschaftlichen Bürokratie“ . . . . . . . 122
13.2 Soziale Beziehungen als Tauschvorgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
13.3 Das Wissen um die schwachen Stellen des Anderen . . . . . . . . . . . . 127
13.4 Konsequenzen für wissenschaftliche Untersuchungen . . . . . . . . . . 128
14 Organisationswirklichkeit anhand von Romanen . . . . . . . . . . . . . . . . 133
14.1 ,,08/15 in der Kaserne“ von Hans Hellmut Kirst . . . . . . . . . . . . . . 134
14.2 „Die Caine war ihr Schicksal“ von Hermann Wouk . . . . . . . . . . . 137
14.3 „Büroroman’’ von W.E. Richartz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
14.4 Der Nutzen der Lektüre von Romanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
VIII Inhaltsverzeichnis
15 Warum es so schwierig ist, Praktikern
Organisationssoziologie zu vermitteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
15.1 Die Unverständlichkeit der Fachsprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
15.2 Der Banalitätsvorwurf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
15.3 Der Vorwurf der „Wirklichkeitsverfehlung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
15.4 Das Ausblenden der Organisationswirklichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . 146
15.5 Der Verzicht auf Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
15.6 Die depressive Grundstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
15.7 Über eine sinnvolle Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Nachwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Nachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
1
Mikropolitik, Machiavellismus
und Machtkumulation1
Die Beschäftigung mit Mikropolitik rührt aus einem mehrjährigen Aha-Erlebnis
her – aus Erkenntnissen, gewonnen vor allem als Lehrling und Saisonarbeiter im
„Hause Siemens“ und als wissenschaftlicher Mitarbeiter der bremischen Verwal-
tung. Aufgewachsen war ich nämlich mit dem verkürzten Bewusstsein, dass unse-
re Großorganisationen allesamt so funktionierten, wie der Idealtypus der Büro-
kratie dies meint und „vorschreibt“, dass also alle Mitarbeiter berechenbar wären
und hundertprozentig rollengerecht handelten, in allem programmiert, ähnlich den
Ameisen und Bienen. Die Machtpotenziale aller Akteure schienen mir – in der
Hierarchie kaskadenförmig nach unten hin abnehmend – ein für alle Mal unver-
rückbar festgelegt zu sein, etwa so wie die elektrischen Potenziale bei den Bau-
teilen eines Fernsehers, und ich hatte auch keinerlei Zweifel daran, dass es den
einzelnen Mitarbeitern absurd vorkommen musste, diesen funktionsnotwendigen
Schaltplan irgendwie infrage stellen oder irgendwie ändern zu wollen.
Mit dieser Vorstellung sozusagen einrückend, kam es mir dann in der öffent-
lichen wie der privaten Verwaltung, der Industrie- wie der Staatsbürokratie, sehr
bald so vor, als ginge es dort sehr wildwüchsig bis geradezu chaotisch zu, zwar
schon irgendwie geregelt und zielgerichtet, aber nicht so, dass das gebräuchliche
Bild vom Verwaltungsapparat Sinn gemacht hätte; eher schien mir der Vergleich
mit einem Fußballspiel, einer Fußballmannschaft angebracht: Alle hatten ein mehr
1 Bosetzky, Horst (1977): „Machiavellismus, Machtkumulation und Mikropolitik“,
Zeitschrift für Organisation, Jg. 46, S. 121–125; erweitert in Bosetzky, Horst (1988):
„Mikropolitik, Machiavellismus und Machtkumulation“, in: Willi Küpper; Günther
Ortmann (Hg.): Mikropolitik. Rationalität, Macht und Spiele in Organisationen. Op-
laden: WDV, S. 27–37.
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019 1
H. Bosetzky, Mikropolitik,https://doi.org/10.1007/978-3-658-23139-2_1
2 1 Mikropolitik, Machiavellismus und Machtkumulation
oder minder festes Ziel und durchaus klar defi nierbare und sogar schriftlich fi xier-
te Rollen. Auch wurde auf den ersten Blick alles nach einem elaborierten Regel-
werk gesteuert und geleitet, aber dennoch war die Berechenbarkeit der Einzelnen
und die Prognostizierbarkeit ihrer Handlungen ziemlich gering. Mir fi el damals
auf, dass formal völlig ranggleiche Personen ganz verschiedene Einfl usspotenziale
haben konnten – und mehr noch: dass es sogar Untergebene gab, die ihre Vorge-
setzten fest im Griff hatten und deren Entscheidungen quasi selber trafen. Dazu
kamen zahllose kleinere Beobachtungen über „Menschen im Machtspiel“, ihre
Kämpfe – Siege und Niederlagen – um Statussymbole wie Räume, Teppiche, Gar-
dinen, Schreibtische oder Lampen, um bessere Arbeit und Arbeitsbedingungen,
um Aufstiegschancen, um knappe Ressourcen, um die Durchsetzung ihres Willens
und ihrer Zielvorstellungen, aber auch das Registrieren vieler Anzeichen von Ohn-
macht, Passivität und einem gottergebenen Sich- abfi nden mit dem Gegebenen: die
Demutshaltung als Überlebensstrategie.
Bei einem ersten Versuch, meine Impressionen irgendwie zu systematisieren,
bin ich dann auf vier „axiomatische Annahmen“ gekommen: Erstens ist in jeder
Organisation nur ein Teil der theoretisch vorhandenen Machtmenge fest an Per-
sonen und Positionen gebunden, der andere ist frei fl utend und verfügbar. Da sich
jede Organisation inmitten gesellschaftlicher Kräftefelder befi ndet, wirken zwei-
tens außerorganisatorische Machtpotenziale in die Organisation hinein und be-
einfl ussen deren „innere Gravitation“. Drittens gibt es in jeder Organisation Men-
schen, die Macht und Einfl uss suchen und andere, die daran kein Interesse haben.
Viertens sind Organisationsmitglieder an der Erhöhung ihres Machtpotenzials
interessiert, so können sie dies in aller Regel nur dadurch erreichen, dass sie Koali-
tionen bilden und sich im weiteren Sinne „politisch“– eben „mikropolitisch“ – ver-
halten, das heißt, dass sie Gefolgsleute anwerben und für die Erreichung der eige-
nen Ziele arbeiten lassen und ihnen im sozialen Tauschprozess als Gegenleistung
dafür ihrerseits Unterstützung gewähren. Um dies wieder etwas zu konkretisieren,
soll nun zuerst danach gefragt werden, inwieweit die einzelnen Formen der Auto-
rität in Organisationen überhaupt „mikropolitischen Manipulationen“ zugänglich
sind, in ihrer Stärke von der Zuschreibung anderer abhängen.
1.1 Die einzelnen Formen von Autorität und ihre Auf-
bzw. Abwertung durch mikropolitische Aktivitäten
Mit Autorität ist hier der für legitim gehaltene, innerlich anerkannte Einfl uss einer
Instanz, Gruppe oder Person gemeint (vgl. Bosetzky/Heinrich 1986: 146ff.), und
es zeigt sich, dass die Stärke einiger Formen von Autorität relativ unabhängig von