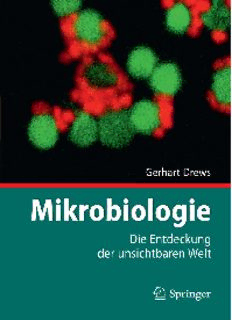Table Of ContentMikrobiologie
Gerhart Drews
Mikrobiologie
Die Entdeckung der unsichtbaren Welt
1 3
Prof. Dr. Gerhart Drews
Inst. Biologie II
Universität Freiburg
Schänzlestr. 1
79104 Freiburg
Deutschland
[email protected]
ISBN 978-3-642-10756-6 e-ISBN 978-3-642-10757-3
DOI 10.1007/978-3-642-10757-3
Springer Heidelberg Dordrecht London New York
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Über-
setzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung,
der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenver-
arbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen
Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in
der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen
unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften.
Einbandentwurf: WMXDesign GmbH, Heidelberg
Gedruckt auf säurefreiem Papier
Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)
Vorwort
D ie „Unsichtbaren“: das sind vor allem die Bakterien, aber auch andere, mikro-
skopisch kleine Lebewesen. Sie waren bei ihrer Entdeckung im 17. Jahrhundert ein
wenig beachtetes Kuriosum. Es gab nur die Vermutung, dass Pestilenz und Fäulnis
durch etwas Materielles übertragen und hervorgerufen werden. Erst im 19. Jahrhun-
dert begann die systematische Erforschung der Kleinstlebewesen und ihrer Eigen-
schaften. In den vergangenen Jahrzehnten ist unser Wissen über Bakterien und ihre
Wechselwirkungen mit der Umwelt dank der Fortschritte in der Molekularbiologie
gewaltig angewachsen. Dieses Buch ist kein Lehrbuch der Mikrobiologie und ihrer
Geschichte und kein historischer Roman, sondern versucht dem Leser die Welt eini-
ger Denker, Forscher und interessierter Laien aus vergangenen Jahrhunderten näher
zu bringen, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit den „kleinen Tierchen“
beschäftigten. Erst im 19. Jahrhundert wurden die Wurzeln für die moderne Mikro-
biologie gelegt. Wir wollen einige der Pioniere und ihre Zeit kennen lernen. Heute
beeindrucken uns die ungeheure Vielfalt und die außergewöhnlichen Leistungen
der Bakterien und ihre Wirkung auf die Umwelt, die vor allem auf der Basis neu-
er biochemischer und molekulargenetischer Forschung ergründet wurden. Dieses
Buch will die Faszination, die von der Welt der Bakterien ausgeht, anhand einiger
aktueller Themenkomplexe vermitteln. Dazu gehört auch die Entdeckung der sub-
organismischen, infektiösen Agenzien.
W enn in der heutigen Zeit die Medien aktuelle biologische Fragestellungen the-
matisieren, so konzentrieren sie sich auf den Menschen und die Tier- und Pflanzen-
welt. Die dadurch entstandene Lücke in der Wissensvermittlung versucht dieses
Buch auszufüllen. Natürlich war es auch die Neugier, der Frage nachzugehen, wie
sich Wissenschaft in vergangenen Jahrhunderten im Kontext der kulturellen Evo-
lution entwickelte.
Dem Springer Verlag, und hier besonders Herrn Dr. Dieter Czeschlik und Frau
Stefanie Wolf, sei gedankt, das Wagnis einzugehen, diese Thematik als Buch zu
veröffentlichen und mich bei der redaktionellen Bearbeitung zu unterstützen. Eben-
so gilt mein Dank Frau. Dr. Claudia Schön für die Bearbeitung des Manuskriptes.
Mein Dank gilt auch Dr. Tobias Erb und Rafael Say, die mir bei der Anfertigung ei-
niger Zeichnungen halfen. Danken möchte ich auch Wolfgang H. Müller für die Be-
arbeitung von Bildmaterial. Prof. Karl O. Stetter, Dr. Marc Mussmann und Miriam
v
vi Vorwort
Weber sowie Verlage und weitere Kollegen stellten mir dankenswerter Weise Bild-
material zur Verfügung. Dank sei auch denen, die durch kritische Durchsicht des
Manuskriptes den Text verbessern halfen.
Freiburg Gerhart Drews
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Was sind Mikroorganismen und wie sind sie entstanden . . . . . . . . . . . . . 5
3 Anfänge naturwissenschaftlichen Denkens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1 Galenos von Pergamon (129–199), ein bedeutender Mediziner
in der Antike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Hieronymus Fracastoro und das infektiöse Agens . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.1 Fracastoro als Arzt und Dichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.2 Die Lehre von den Kontagien der Infektion . . . . . . . . . . . . . . . 18
4 Die Fortschritte der Naturwissenschaften im 17.
und 18. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1 Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1.1 Holland im 17. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1.2 Van Leeuwenhoek baut Mikroskope und entdeckt
eine neue Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1.3 Die Entdeckung der „sehr kleinen Tierchen“ . . . . . . . . . . . . . . 34
4.2 Versuche, den Bakterien in der Welt der Lebewesen einen Platz
zuzuweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3 Mit der Hypothese der Urzeugung entwickelte sich modernes
Denken und Experimentieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.1 „Generatio spontanea“ und die Entdeckung von
Entwicklungszyklen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.2 Versuche zur Sterilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5 Die Entwicklung moderner mikrobiologischer Forschung
im 19. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1 Neue Methoden und Denkansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2 Der Breslauer Botaniker Ferdinand Cohn setzt Maßstäbe für
die bakteriologische Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
vii
vviiiiii Inhaltsverzeichnis
5.2.1 Jugend und Studienjahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.2 Aktivitäten Cohns in der Forschung und an der
Universität Breslau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2.3 Gründung des pflanzenphysiologischen Institutes . . . . . . . . 55
5.2.4 Popularisierung von Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.2.5 Neubau des Institutes für Botanik
und Pflanzenphysiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.3 Cohn, Koch und Pasteur repräsentieren Richtungen
bakteriologischer Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.3.1 Begründung einer modernen Bakteriologie durch Cohn . . . 58
5.3.2 Edwin Klebs (1834–1913) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.3.3 Koch revolutioniert die Infektionsbiologie . . . . . . . . . . . . . . 66
5.3.4 Der Nachweis von Infektionserregern durch Koch
und Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.3.5 Gärungsphysiologie und Immunisierungsversuche im
Labor von Pasteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.3.6 Unterschiedliche Forschungsstrategien in den
Schulen von Koch und Pasteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.3.7 Entdeckung des Erregers der Tuberkulose durch
Robert Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.3.8 Infektionskrankheiten und ihre Bekämpfung . . . . . . . . . . . . 78
5.3.9 Die Entwicklung von Antikörpern gegen
Krankheitserreger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.3.10 Paul Ehrlich und die Chemotherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.3.11 Kochs zweite Ehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.3.12 Kochs Untersuchungen tropischer
Infektionskrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.3.13 Reise nach Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.3.14 Kochs letzte Lebensjahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6 Die vielfältigen Aktivitäten von Bakterien in der Natur . . . . . . . . . . . . 87
6.1 Entwicklung von Methoden und Denkansätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.2 Der Stickstoffkreislauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.2.1 Fixierung elementaren Stickstoffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.2.2 Sergej Nikolaevitch Winogradsky (1856–1953) . . . . . . . . . . 90
6.2.3 Nitrogenase und Stickstoffreduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.2.4 Nitrifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.2.5 Dissimilatorische Nitratreduktion, Denitrifikation . . . . . . . . 93
6.2.6 Anaerobe Ammoniumoxidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.2.7 Ökologische Aspekte des Stickstoffkreislaufes . . . . . . . . . . 95
6.3 Der Kreislauf des Schwefels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.3.1 Dissimilatorische Sulfatreduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.3.2 Oxidation von Schwefelwasserstoff (H S), Sulfurikanten . . 98
2
6.4 Die Kreisläufe von Sauerstoff und Kohlenstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6.4.1 Die Entstehung der Erdatmosphäre und ihr Einfluss
auf die Biosphäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Inhaltsverzeichnis iixx
6.4.2 Die Atmungskette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6.4.3 Der Kreislauf des Kohlenstoffs: Fixierung von
Kohlendioxid, CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2
6.5 Metalle im Energiestoffwechsel von Bakterien . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.5.1 Eisenoxidation und Eisenreduktion in verschiedenen
Erdperioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.5.2 Metall-oxidierende Bakterien bei biotechnologischen
Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.6 Die Aufklärung von Gärungsstoffwechsel und Atmung . . . . . . . . . 113
6.7 Die photosynthetisch aktiven Bakterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.7.1 Die Entdeckung pigmentbildender Bakterien . . . . . . . . . 116
6.7.2 Engelmanns Untersuchungen zur Photosynthese der
Algen und Bakterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.7.3 Die grünen Bakterien und Reaktionszentren
der anoxygenen Photosynthese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.8 Die Welt der „blaugrünen Algen“, die Cyanobakterien
mit oxygener Photosynthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7 Die Entdeckung der Viren und anderer suborganismischer
infektiöser Agenzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.1 Das Tabakmosaikvirus und andere Viren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.2 Viroide: nackte, infektiöse Ribonukleinsäure . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.3 Prione, die unheimlichen Krankheitserreger aus Protein . . . . . . . . 135
8 Die Wege zur Entdeckung von Proteinen,
Enzymen und Zellstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.1 Die Zelle als Grundbaustein aller Organismen . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.2 Entdeckung des Generationswechsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
9 Die Einheit des Stoffwechsels und die Aufklärung
der Proteinstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
10 Die Molekularbiologie erweitert unser Blickfenster
auf das Geschehen in der Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
10.1 Das Entstehen der Vererbungslehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
10.2 Die Chemie der Makromoleküle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
10.3 Das Entstehen der Bakteriengenetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
10.4 Lederberg und sein Beitrag zur Entwicklung
der Bakteriengenetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
10.5 Fortschritte der molekularen Genetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
10.6 Die Doppelhelix der Desoxyribonukleinsäure (DNA) . . . . . . . . . . 152
10.6.1 Strukturaufklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
10.6.2 Replikation der DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
10.7 Der genetische Code und seine Übersetzung in die Sprache
der Proteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
10.7.1 Genkartierung und zellfreie Proteinsynthese . . . . . . . . . . 161
x Inhaltsverzeichnis
10.8 Die molekulare Biologie der Zelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
10.8.1 Genomsequenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10.8.2 Struktur und Teilung des bakteriellen Chromosoms . . . . 165
10.8.3 Cytoplasmatische Membran und Cytoskelett . . . . . . . . . 167
10.9 Der Begriff der Spezies und die Sexualität bei Bakterien . . . . . . . 168
10.9.1 Methoden der Klassifizierung von Bakterien . . . . . . . . . 169
10.9.2 Genomorganisation und Expression . . . . . . . . . . . . . . . . 170
10.9.3 Regulation des Stoffwechsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
11 Die Verwandtschaft zwischen Bacteria, Archaea und Eukarya . . . . . 175
11.1 Die Symbiontentheorie und ihr Einfluss auf die Deutung
der Stammesentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
11.2 Die Drei-Domänen- und die Eocytenhypothese . . . . . . . . . . . . . . . 178
11.3 Bacteria und Archaea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
12 Regulation von Stoffwechsel und Zelldifferenzierung . . . . . . . . . . . . . . . 183
12.1 Die ATP-Synthase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
12.2 Energieproduktion durch Substratstufenphoshorylierung . . . . . . . 186
12.3 Anpassung an Umweltfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
12.3.1 Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
12.3.2 Konzentration von H + - und OH (cid:237) -Ionen . . . . . . . . . . . . . 187
12.3.3 Andere, das Wachstum beeinflussende Faktoren . . . . . . 187
13 Mikroorganismen und ihre Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
13.1 Süßwasser-Binnenseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
13.2 Strategien der Bakterien, einen optimalen Lebensraum
zu besetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
13.3 Aktive Bewegung von Bakterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
13.4 Das Streifenwatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
13.5 Lebensgemeinschaften an den Hydrothermalquellen
der Tiefsee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
13.6 Leben unter dem Eis in der Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
13.7 Der Pansen und seine Bewohner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
13.8 Andere extreme Standorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
13.9 Lebensgemeinschaften im Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
13.9.1 Die Rhizosphäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
13.9.2 Nitrogenase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
13.10 Trinkwasser und Abwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
13.10.1 Moderne Abwasseranlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
14 Mikroorganismen im Dienste des Menschen: Biotechnologie . . . . . . 209
15 Die Systembiologie untersucht Regulationsnetzwerke und
phylogenetische Beziehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Description:Von den Anfängen naturwissenschaftlichen Denkens in der Antike über das Mikroskop bis zur synthetischen Biologie.Mikroorganismen leisten einen wesentlichen Beitrag zum Kreislauf der Stoffe in der Natur. Sie haben die Voraussetzung für das Leben der höheren Organismen geschaffen und synthetisiere