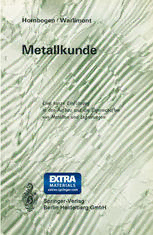Table Of ContentMetallkunde
Eine kurze Einführung in den Aufbau
und die Eigenschaften von Metallen und Legierungen
Von
Erhard Hornbogen Hans Warlimont
Mit einem Beitrag von Th. Ricker
Mit 229 Abbildungen
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
1967
E. Hornbogen
Dr.-Ing., Abteilungsleiter und Professor am Institut für Metallphysik
der Universität Göttingen
H. Warlimont
Dr. rer. nat., Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart
Th. Ricker
Dr. rer. nat. Telefunken AG., Forschungsinstitut, Ulm
Additional material to this book can be downloaded from http://extras.springer.com
ISBN 978-3-662-26942-8 ISBN 978-3-662-28414-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-28414-8
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet,
dieses Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege
(Photokopie, Mikrokopie) oder auf andere Art zu vervielfältigen
@ by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1967
UrsprUnglieh erschienen bei Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1967
Library of Congress Catalog Card Nurober: 66-29245
Titelnummer 1384
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Buche berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche
Namen im Sinne der Warenzeichen· und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften
Vorwort
Die Metallkunde ist die Lehre von Aufbau und Eigenschaften der
Metalle und Legierungen. Die allgemeine Metallkunde ist im Kern ein
Teilgebiet der augewandten Physik mit tiefen Wurzeln in Teilen der
physikalischen Chemie - nämlich der Lehre von den Phasengleich
gewichten, der Reaktionskinetik und der Elektrochemie. In der
angewandten Metallkunde werden die Erkenntnisse der allgemeinen
Metallkunde auf Werkstoffkunde, Umformtechnik, Gießereitechnik,
Oberflächenveredlung und andere Verfahren, Metalle zu bearbeiten,
angewandt. Von der Metallkunde ist die Metallhüttenkunde zu unter
scheiden, in der die Chemie und Technologie der Metallgewinnung
behandelt werden.
Seit die allgemeine Metallkunde als festumrissenes Forschungs
gebiet vor allem von GusTAV TAMMANN (1903-1937 in Göttingen)
eingeführt wurde, hat sie sich zu einem umfangreichen Zweig natur
wissenschaftlicher Forschung entwickelt. Dieses kleine Buch kann
deshalb nicht einen vollständigen Überblick über alle bisher in Me
tallen und Legierungen gefundenen Erscheinungen geben - es ist
kein Lehrbuch der Metallkunde. Vielmehr soll es als erste Einführung
sowohl in die allgemeine als auch in die augewandte Metallkunde
dienen.
Für den Leserkreis haben wir an alle diejenigen gedacht, die
wissen möchten, womit sich die Metallkunde beschäftigt, an Metall
kundler im Betrieb, deren Hochschulausbildung längere Zeit zurück
liegt, an Festkörperphysiker, die sich in der rauben Luft industrieller
Laboratorien mit den komplexen Erscheinungen in metallischen
Werkstoffen beschäftigen müssen, an Werkstoffingenieure, die etwas
über physikalische Ursachen der Eigenschaften von Werkstoffen er
fahren möchten, und an Studenten der Natur-und Ingenieurwissen
schaften, die sich überlegen, ob sie einen Teil ihres Studiums der
Metallkunde widmen sollen.
Das Verständnis des Buches wird durch naturwissenschaftliche
Kenntnisse, die etwa den Erfordernissen eines Vordiploms ent
sprechen, erleichtert. Die einzelnen Abschnitte sind möglichst so
verfaßt worden, daß sie getrennt gelesen werden können. Begriffe,
die in vorangehenden Kapiteln erläutert wurden, werden allerdings
vorausgesetzt. Jedem Kapitel folgt eine Liste von Büchern, die das
darin behandelte Teilgebiet ausführlicher darstellen.
IV Vorwort
Die Auswahl und Anordnung des Stoffes in dieser kurzen Form
war nicht leicht. Sicher wird man meinen, daß das eine oder andere
Teilgebiet zu knapp behandelt ist. Wir hoffen, daß in absehbarer
Zeit wieder ausführlichere Lehrbücher der Metallkunde in deutscher
Sprache erscheinen werden. Die Autoren sind für Kritik im Hinblick
auf die Auswahl und Darstellung des Stoffes dankbar.
Herr Prof. W. KöSTER hat uns ermutigt, mit der Arbeit an diesem
Büchlein zu beginnen. Wir danken ihm sehr dafür. Außerdem danken
wir Herrn Dr. Th. RICKER, der sich bereitgefunden hat, das KapitelS
über Elektronentheorie zu schreiben, Herrn Prof. P. RAASEN für die
Durchsicht des Manuskriptes und viele wertvolle Ratschläge und
allen Mitarbeitern am Max-Planck-Institut für Metallforschung, die
Gefügebilder beigesteuert oder uns durch Ratschläge und kritische
Durchsichten des Manuskripts geholfen haben. Einzelne Fachkolle
gen und Firmen haben uns in dankenswerter Weise Gefügebilder
überlassen: Dr. F. BENESOVSKY (Metallwerk Plansee), R. C. GLENN
(U. S. Steel), Dipl. Ing. H. P. jUNG (Glyko Werke), Dr. J. MoTz
(Gießereiinstitut), Dr. G. PETZOW (Max Planck Institut), Dr. A.
RAHMEL (Dechema), Dr. B. RALPH (Cambridge University), Dr. H.
WEISZ (Siemens) und International Nickel. Schließlich möchten wir
auch unseren Mitarbeiterinnen im Laboratorium für ihre fleißige
Hilfe und Geduld bei der Herstellung des Manuskripts und der Ge
fügebilder danken.
Herbst 1966
ERHARDHORNBOGEN HANS W ARLIMONT
Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeiner Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Natur der Metalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Geschichte der Metalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Metalle als Werkstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aufgaben der Metallkunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Übergang in den festen Zustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aggregatzustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Übergang gasförmig zu kristallin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Übergang flüssig zu kristallin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Keimbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Heterogene Keimbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Stabile und instabile Grenzflächen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Erstarrung in einer Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Einkristalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Kristallstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bindung und Koordination.................................... 16
Punkte, Ebenen und Richtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stereographische Projektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Intermetallische Phasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anisotropie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. Gitterbaufehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Leerstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Versetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stapelfehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Korngrenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. Elastische und plastische Verformung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Elastische Verformung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Streckgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Verfestigung ........................· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zwillingsbildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Verformungstextur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6. Konstitution von Legierungen............................ 47
Grundlagen der heterogenen Gleichgewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Mischkristalle, geordnete Atomverteilung, intermetallische Phasen . . 49
Zweistoffsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mehrstoffsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7. Eigenschaften von Legierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Strukturabhängigkeit, Gefügeabhängigkeit, Mischungsregel . . . . . . . . 59
Mechanische Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Elektrische und thermische Leitfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Dichte und Wärmeausdehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
VI Inhaltsverzeichnis
8. Elektronentheorie der Metalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Modell freier Elektronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Bändermodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ferromagnetismus und Supraleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
9. Thermisch aktivierte Vorgänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Definition ........................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Aktivierungsenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Erholung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rekristallisation und Kornvergrößerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kriechen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
10. Umwandlungen im festen Zustand........................ 85
Umwandlungsarten, thermodynamische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . 85
Keimbildung im festen Zustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Wachstumsvorgänge.......................................... 87
Ausscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Umwandlungen in Ordnungsphasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Diskontinuierliche Umwandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Martensitumwandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11. Untersuchungsverfahren.................................. 97
Makroskopische und mikroskopische Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . 97
Beugung von Röntgenstrahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Elektronenbeugung ........................................... 100
Neutronenbeugung ........................................... 101
Lichtmikroskopie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Elektronenmikroskopie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Physikalische Eigenschaften ................................... 104
Dämpfung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Mikrosonde .................................................. 106
Radioaktive Isotope .......................................... 107
Mössbauereffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Feldionenmikroskopie ........................................ 108
12. Erstarrung von Legierungen und Gußlegierungen ........ 110
Eigenschaften von Metallschmelzen ............................. 110
Bildung von Mischkristallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Eutektische Erstarrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Seigerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Gußlegierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Gießtechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
13. Technische Formgebung und Werkstoffprüfung ......... 121
Einfluß von Gefüge, Temperatur und Verformungsgeschwindigkeit . 121
Mechanik der Formgebung .................................... 123
Formgebungsverfahren ....................................... 124
Werkstoffprüfverfahren ....................................... 128
14. Umwandlungshärtung und Stähle ......................... 131
Umwandlungen eutektoider Stähle ............................. 132
Festigkeit einzelner Umwandlungsprodukte ...................... 133
Anlassen .................................................... 136
Voreutektoider Ferrit und Zementit ............................ 137
Legierte Stähle .............................................. 137
Thermomechanische Behandlung ............................... 140
Inhaltsverzeichnis VII
15. Aushärtung von Legierungen ............................. 142
Eigenschaftsänderung durch Teilchen ........................... 142
Wechselwirkung von Versetzungen mit Teilchen ................. 144
Ausscheidungsgefüge und mechanische Eigenschaften ............. 147
Aushärtbare Aluminiumlegierungen ............•............... 149
Aushärtbare Nickellegierungen ................................ 150
Eisenlegierungen, das Altern von Stahl ......................... 151
Dispersionshärtung ........................................... 153
16. Chemische und thermische Beständigkeit, Oberflächen-
behandlung ............................................. 154
Korrosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Rostfreie Stähle, Korrosionsschutz ............................. 158
Verzunderung ................................................ 160
Oberflächenbehandlung ....................................... 162
17. Legierungs- und Werkstoffherstellung im festen Zustand,
Pulvermetallurgie ...................................... 163
Umgehung des flüssigen Zustandes ............................. 163
Pulvermetallurgische Verfahren ................................ 163
Anwendung der Pulvermetallurgie .............................. 166
18. Ferromagnetische Legierungen ........................... 169
Ferromagnetische Kristallarten .................•.............. 169
Ferromagnetische Bezirke und Magnetisierungskurve . . . . . . . . . . . . . 172
Magnetisch weiche Werkstoffe ................................. 174
Magnetisch harte Werkstoffe ................................... 176
Anomalie von Eigenschaften durch Ferromagnetismus . . . . . . . . . . . . . 178
19. Metalle und Strahlung .................................... 179
Strahlenschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Reaktorwerkstoffe ........................................... 182
Metallkunde des Urans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
20. Neue metallische Werkstoffe und Bearbeitungsverfahren 185
Höchste Festigkeit und Hitzebeständigkeit ...................... 185
Werkstoffe in der Elektrotechnik .............................. 189
Stoßwellenbehandlung von Metallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Sachverzeichnis ............................................. 193
VIII
Verzeichnis
der im Text erwähnten Metalle und Legierungen
Ag ... 4, 17, 64, 111 Fe-Ni ... 94
Ag-Al ... 61, 63 FeS ... 24
Ag-Cu ... 51 FeSb ... 24
Ag-Mn ... 61 Fe-Si ... 171
Ag-Sb ... 61 FeSn ... 24
Ag-Zn ... 61, 63 Fe6Zn21 ••• 25
Al ... 4, 17, 33, 62 Hf ... 17, 182
Al-Cu ... 119, 148, 149f. In .. .
Al-Mg ... 119 In-Tl ... 94
Al-MgS~ ... 148, 150 Ir ... 17
Al-Mg Zn ... 148, 150
Al-Si .2.. 118 Mg ... 4
Au ... 4, 17, 33, 111 MgCu2 ••• 25
AuCu ... 90 MgN~ ... 25
MgSe ... 24
Au-Cd ... 94
Mg-Sn ... 54
Au-Ni ... 51
Au-Si ... 53 MgZn2 ••• 25
Mo ... 17, 186
Be ... 167
Nb ... 17, 62, 186
Bi .. .
Nb-N ... 62
Bi-Cd-Pb-Sn ... 119
Ni ... 17, 75, 170
Ca ... 17
Ni-Al. .. 148
Ca-Mg ... 61
Ni Al ... 151
3
Co ... 17,170 Ni-C ... 65
Cr ... 17 Ni-Cr ... 161
Cu ... 4, 17, 33, 46, 62, 64 Ni-Cr-Fe ... 161
Cu-Al ... 94 Ni3Fe ... 176
CuCdSb ... 24 Pd ... 17
CuGa ... 25 Pb ... 17
Cu-Ga-Zn ... 94 Pb-Sb-Sn ... 119
Cu MnAl ... 170f.
2 Pt ... 17
Cu Se ... 24
2 Pt-Fe ... 65
Cu-Sn ... 94
Pt-Ir ... 65
Cu-Zn ... 46, 56
Pt-W ... 55
CuZn ... 25, 61
Cu5Zn8 ..• 25 Sn ... 4
CuZn3 •.• 25 Ta ... 17, 186
Fe ... 1, 4, 5, 17, 62, 64, 80, 170 Ti ... 17, 94
FeAl ... 90 Tl. .. 17
Fe3Al ... 90f. u ... 94, 183f.
Fe-Al-Si ... 161
Fe-C ... 57, 62, 80, 94, 117, 132f., V ... 17
153 w ... 17, 166, 186
Fe-Cr. .. 138, 158, 161 W-Ag ... 186
Fe-Cr-Al ... 161 Zn ... 4
Fe-Cr-Ni ... 64, 159
Zr ... 17
Fe-Cu ... 87, 144, 148
Fe-N ... 80, 153
1. Allgemeiner Überblick
Natur der Metalle
Als Metall wird im täglichen Leben ein Stoff bezeichnet, der
folgende Eigenschaften hat:
Reflexionsfähigkeit für Licht,
hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit,
plastische Verformbarkeit und
in einigen Fällen Ferromagnetismus.
Einzelne dieser Eigenschaften können auch in Nicht-Metallen
auftreten; deshalb ist auf diese Weise noch nicht befriedigend defi
niert, was ein Metall ist. Eine eindeutige Beschreibung des metalli
schen Zustandes wäre: Ein Metall ist ein Stoff, dem eine Fermiober
fläche zugeordnet werden kann. Es handelt sich hier allerdings um
einen unanschaulichen Begriff aus der Elektronentheorie (Kap. 8).
Damit wird gesagt, daß die äußeren Elektronen der Metallatome im
Zustand metallischer Bindung besondere Eigenschaften haben, auf
denen die oben erwähnten bekannten Erscheinungen beruhen. Sie
sind zwischen den Atomen eines Metallkristalls frei beweglich.
Es ist bemerkenswert, daß sich manche Eigenschaften von Me
tallen durch bestimmte Behandlungen oft um viele Größenordnun
gen ändern können. Solche Behandlungen sind z. B. : Legieren
(Mischen verschiedener Metalle), Glühen (Wärmebehandlung), Ver
formen (mechanische Behandlung), Bestrahlen mit Neutronen. -
Dazu zwei Beispiele :
a) Die Streckgrenze a. ist die mechanische Spannung, bei der die
plastische Verformung eines Metalls beginnt (Kap. 5). Für reines
Eisen findet man a. ~ 1 kpmm-2• Fügt man dem Eisen nur einige
Atomprozent Kohlenstoff zu, so kann bei geeigneter Wärmebehand
lung (Kap. 14) eine Streckgrenze von über 200 kpmm-2 erreicht
werden.
b} Die Koerzitivkraft ist die magnetische Feldstärke H die auf
0,
gebracht werden muß, um ein bis zur Sättigung magnetisiertes ferro
magnetisches Metall wieder zu entmagnetisieren (Kap. 18). Der Wert
von He kann sich in Legierungen, die immer hauptsächlich aus Eisen
und Nickel bestehen, zwischen 0,0040ersted und 2000 Oersted ändern.
Ähnliche Beispiele könnten für die elektrische Leitfähigkeit
(Kap. 7, 8), die plastische Verformbarkeit (Kap. 5, 13, 14, 15) oder
die chemische Beständigkeit (Kap. 16) gegeben werden.