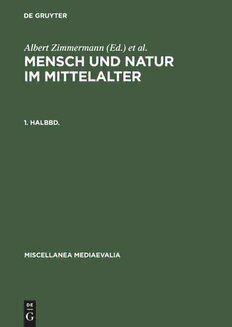Table Of ContentMensch und Natur im Mittelalter
W
DE
G
Miscellanea Mediaevalia
Veröffentlichungen des Thomas-Instituts
der Universität zu Köln
Herausgegeben von Albert Zimmermann
Band 21/1
Mensch und Natur im Mittelalter
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1991
Mensch und Natur
im Mittelalter
1. Halbband
Herausgegeben von Albert Zimmermann
und Andreas Speer
Für den Druck besorgt von Andreas Speer
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1991
Die Deutsche Bibliothek — CIP-Titelaufnahme
Mensch und Natur im Mittelalter / hrsg. von Albert Zimmer-
mann und Andreas Speer. — Berlin ; New York de Gruyter.
(Miscellanea mediaevalia ; Bd. 21)
NE: Zimmermann, Albert [Hrsg.]; GT
Halbbd. 1 (1991)
ISBN 3-11-013163-3
ISSN 0544-4128
© Copyright 1991 by Walter de Gruyter & Co., D-1000 Berlin 30.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Satz und Druck: Arthur Collignon GmbH, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer, Berlin
Der Kosmos-Mensch
Sanctae Hildegardis Revelationes (Liber Divinorum Operum)
Lucca, Biblioteca Statale, Ms. 1942, fol. 9r
Vorwort
Dieser Band 21 der Miscellanea Mediaevalia geht zurück auf die sieben-
undzwanzigste Kölner Mediaevistentagung, die — eine lange Tradition
fortsetzend — vom 11. bis 14. September 1990 stattfand. Mehr als 200
Teilnehmer aus über 20 Ländern, darunter viele Forscher aus Osteuropa,
die zum ersten Mal Gelegenheit zur Teilnahme hatten, folgten der Einla-
dung des Thomas-Instituts zum bewährten interdisziplinären Diskussions-
forum. Unter dem Rahmenthema der Tagung: „Mensch und Natur im
Mittelalter" enthält dieser Band die in zwölf Sektionen gehaltenen Vor-
träge1 und Beiträge, welche die Diskussion ergänzen und weiterführen.
Das Thema betrifft eine erkennbar zentrale Fragestellung der Geistesge-
schichte des Mittelalters. Die Zahl der Beiträge macht jedenfalls einen
Doppelband erforderlich.
Am Naturbegriff als Leitfaden läßt sich recht gut verfolgen, wie die
Deutungen der Welt durch die mittelalterlichen Denker zunehmend dif-
ferenzierter werden. Die Frage nach dem Naturverständnis bringt zunächst
in den Blick, wie sich Erklärungen kosmologischer und naturphilosophi-
scher Art entwickeln und sich dabei immer mehr von offenbarungstheo-
logischen und symbolischen Deutungsmustern lösen. Der wachsenden
Konsistenz im Begreifen der Natur aus genuin naturphilosophischer Per-
spektive entspricht ein wachsendes Selbstbewußtsein der Menschen, die
der Natur nicht mehr nur hilflos gegenüberstehen und sich auch nicht auf
eine kontemplative Sicht derselben beschränken. In weiten Bereichen
wächst das Bewußtsein von Autonomie, welches auch einen kulturellen
Niederschlag findet. „Une découverte de la nature et de l'homme" nennt
Marie-Dominique Chenu in seiner Skizze der Geistesgeschichte des 12.
Jahrhunderts diese bedeutsame Entwicklung2.
Damit ist angegeben, von wo aus in den vorliegenden Arbeiten nach
dem Verständnis von Mensch und Natur gefragt wird. Die Perspektiven,
die in den Themen des ersten und des dritten von der SIEPM veranstalteten
Kongresses für mittelalterliche Philosophie — „L'homme et son destin
d'après les penseurs du moyen âge"3 und „La filosofia della natura nel
1 Vgl. hierzu A. Speer, Mensch und Natur im Mittelalter. Tagungsbericht von der 27.
Kölner Mediaevistentagung, in: Bulletin de philosophie médiévale 32 (1990), 222 — 226.
2 La théologie au 12e siècle, Paris 1957, 31976, besonders chap. I, 19-51.
3 Actes du premiers congrès international de philosophie médiévale (28. 8.-4. 9. 1958),
Louvain 1960.
VI Vorwort
medioevo"4 — gekennzeichnet sind, sollten systematisch aufeinander be-
zogen werden, und zwar vor einem bestimmten historischen Hintergrund.
Das Interesse gilt jedoch nicht nur philosophischen Texten. Leider kommt
im interdisziplinären Kontext der Tagung die Theologie zu kurz.
Die Gliederung des Doppelbandes lehnt sich an die Sektionsthemen der
Tagung an, ist jedoch etwas allgemeiner gehalten; die Überschriften be-
schränken sich in aller Regel auf ein Stichwort. Gleichwohl soll durch die
Gliederung zum Ausdruck gebracht werden, auf welche Weise wir die
beiden Elemente des Rahmenthemas aufeinander bezogen wissen wollen.
Den Ausgangspunkt bildet jene Entdeckung der Natur in ihrer, zumindest
relativen, phänomenalen und ursächlichen Eigenständigkeit, die eine ent-
sprechende wissenschaftliche Erforschung nach sich zieht, welche mit
Erfolg eigenständige Geltung beansprucht. Dies gilt nicht nur für die
Naturphilosophie im weiteren und die Physik im engeren Sinne, sondern
auch für die Metaphysik, die sich der zunehmenden Vielfalt des natürlichen
Wissens durch Reflexion auf die zugrundeliegenden Prinzipien zu versi-
chern trachtet und damit die Voraussetzungen für eine befriedigende
Verhältnisbestimmung von Vernunft- und Offenbarungswissen schafft.
Auch hierfür liefert Chenu das Stichwort, wenn er von einem „éveil
métaphysique" spricht5.
Der skizzierte Vorgang hat epochemachende Auswirkungen. Er be-
stimmt das gesamte Hoch- und Spätmittelalter. Auch der Wandel im
Bildungs- und Wissenschaftsverständnis, begriffsgeschichtlich in der Ab-
lösung von „ars" durch „scientia" zu verfolgen, hat eine seiner Ursachen
in den sich differenzierenden und spezialisierenden Formen der Wirk-
lichkeitsbetrachtung. Diese greifen dabei die vorfindlichen Traditionen in
ihrer ganzen Breite auf, jedoch nicht vorrangig im Sinne einer bloß
enzyklopädischen Zusammenschau, sondern mittels spekulativer Durch-
formung und transformativer Aneignung.
Das Problem des Naturgesetzes und ineins damit des naturhaft Rechten
eröffnet eine vorwiegend praktische Perspektive. In den Mittelpunkt rückt
die Frage nach der menschlichen Autonomie im Hinblick auf das Handeln.
Die Fülle der verschiedensten anthropologischen Fragestellungen, seien
sie grundsätzlicher Art oder an einzelnen Lebensvollzügen orientiert, zeigt,
daß man die Eigenart des Menschen überhaupt immer mehr zu erschließen
versucht. Schließlich findet die Beziehung von Mensch und Natur ihren
Ausdruck in der Herausbildung eines kulturellen Naturbegriffs, der einem
kulturellen Naturverhältnis entspricht, das mit der Entfaltung der städti-
schen Kultur zunehmend an Bedeutung gewinnt. Auch die sich wandelnde
4 Atti del terzo congresso internazionale di filosofia medioevale (31. 8.-5. 9. 1964), Milano
1966.
5 La théologie au 12e siècle, chap. XIV, 309-322.
Vorwort VII
Bilderwelt, sei sie ikonographischer oder eher kartographischer Art, spie-
gelt den Wandel der Betrachterperspektive wider.
Wie bereits angedeutet, stand die 27. Kölner Mediaevistentagung auch
unter dem Eindruck der politischen Veränderungen der Jahre 1989 und
1990. War in den Jahren zuvor lediglich einer kleineren Zahl von osteu-
ropäischen Mediaevisten, vornehmlich aus Polen und der Tschechoslo-
wakei, eine Teilnahme an den Kölner Tagungen möglich — die bisherigen
Tagungsbände der Miscellanea Mediaevalia legen hiervon beredt Zeugnis
ab — , so konnten jetzt zum ersten Mal Mittelalterforscher auch aus einigen
Ländern teilnehmen, denen solche Kontakte bislang versagt waren. Dieser
Tatsache trugen die Veranstalter Rechnung durch ein eigens angesetztes
Abendgespräch mit einer Delegation des Instituts für Philosophie der
Moskauer Akademie der Wissenschaften über Mittelalterforschung in der
UdSSR. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Situation der Mediaevistik
in anderen osteuropäischen Ländern erörtert. Beklagt wurden insbesondere
der Mangel an Quellentexten und das Fehlen eines internationalen For-
schungsaustausches6. In diesem Sinne möchte der vorliegende Band der
Miscellanea Mediaevalia einen Beitrag zur Begegnung westlicher und
östlicher Mittelalterforschung leisten, der hoffentlich in der Zukunft seine
Fortsetzung findet.
Eine wesentliche Voraussetzung für das interdisziplinäre Gespräch und
für die geschilderte Begegnung von Forschern waren die finanziellen
Hilfen, die uns gewährt wurden. Neben der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, dem Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst
gilt unser Dank dieses Mal auch besonders der Fritz Thyssen Stiftung,
dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Rudolf Sie-
dersleben'schen Otto Wolff-Stiftung, sowie einer Reihe von Einzelspen-
dern. Sie alle haben dazu beigetragen, daß die siebenundzwanzigste Kölner
Mediaevistentagung schließlich so stattfinden konnte, wie wir es geplant
hatten.
Unser Dank gilt auch allen Mitarbeitern der Universität zu Köln, deren
Hilfe wir immer wieder in Anspruch nehmen durften. Besonders gedankt
sei den Mitarbeitern des Musikwissenschaftlichen Instituts und seinem
Direktor Herrn Prof. Dr. K. W. Niemöller für die Bereitstellung des
Musiksaales als Tagungsort und die vielfache technische Unterstützung.
Dem Rektor der Universität zu Köln, Herrn Prof. Dr. Bernhard König,
der die Teilnehmer im Alten Senatssaal empfing, sei herzlich gedankt.
Dank gilt schließlich dem Direktor des Römisch-Germanischen Museums,
Herrn Prof. Dr. H. Hellenkemper, der uns für einen Nachmittag Gastrecht
gewährte und damit ermöglichte, einen Teil der Tagung auf ältestem
Kölner Boden stattfinden zu lassen.
6 Vgl. hierzu den Tagungsbericht (Anm. 1), 224—225.
Vili Vorwort
Vorbereitung und Organisation der 27. Kölner Mediaevistentagung
lagen in den Händen der Mitarbeiter des Thomas-Instituts. Gleiches gilt
für die redaktionellen Arbeiten dieses Bandes, dessen Register wiederum
Herr Hermann Hastenteufel M. A. erstellte. Allen Mitarbeitern sei für ihre
vielfältige Hilfe besonders herzlich gedankt. Ein Gleiches gilt für den
Verlag Walter de Gruyter, der den Doppelband in bewährter Weise aus-
stattete und für eine zügige Drucklegung sorgte.
Köln, im Juli 1991 Albert Zimmermann
Andreas Speer