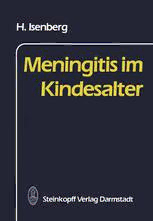Table Of ContentMeningitis im Kindesalter
Mit freundlicher Empfehlung
Oberreicht durch
Fur meine Frau in
Dankbarkeit
H. Isenberg
Meningitis im Kindesalter
i
Steinkopff Verlag Darmstadt
Dr. H. Isenberg
Stadtische Kliniken, Kinderklinik
Heidelberger LandstraBe
6100 Darmstadt
CIP-Titelaufnahme de:r Deutschen Bibliothek
Isenberg, Hannes:
Meningitis im Kindesalter / H. Isenberg. - Darmstadt:
Steinkopff, 1988
ISBN-13: 978-3-642-97779-4 e-ISBN-13: 978-3-642-97778-7
DOl: 10.1007/978-3-642-97778-7
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschUtzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der
Ubersetzung, des Nachdrucks, des Vortrages, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk
sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfaltigung auf anderen Wegen und der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Ver
vielfaltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der
gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland yom 9. Septem
ber 1965 in der Fassung Yom 24. Juni 1985 zulassig. Sie ist grundsatzlich vergUtungspflichtig. Zuwider
handlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Copyright © 1988 by Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, GmbH & Co. KG, Darmstadt
Verlagsredaktion: Sabine MUller - Herstellung: Heinz J. Schafer
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Vertiffent
lichung berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von
jedermann benutzt werden dUrften.
Gesamtherstellung: Meininger, Neustadt
Geleitwort
Die Meningitis im Kindesalter spielt heute gewiB nicht mehr die bedrohliche Rolle, die
noch in den alteren Lehrbtichern der Kinderheilkunde beschrieben wird. Jedoch sind
Hirnhautentztindungen auch heute keineswegs selten und trotz der tiberzeugenden
Wirkung von Antibiotika- und Chemotherapie nicht ungefahrlich. So wurde mir von
einem Knaben berichtet, der im ersten Lebensjahr bereits viermallebensgefahrlich an
einer E.-coli-Meningitis erkrankt war. Nur eine intensive Chemotherapie hatte ihm das
Leben gerettet. Der sofortige Verdacht auf das Bestehen eines bisher nicht gefundenen
Zuganges zu den Meningen bestatigte sich mit der Entdeckung eines schwach erkenn
baren Hamangioms oberhalb der Rima ani. Dieses war der Anfang eines winzigen
offenen Ganges zum Rtickenmark. Seine chirurgische Beseitigung befreite das Kind aus
der Gefahr.
Dieser Fall moge als Hinweis darur dienen, daB die Therapie der Hirn-und Rticken
markshauterkrankungen umfassende Sachkenntnis erfordert. Es ist daher dem Verfasser
des Buches zu danken, daB er in seinem Werk eine grtindliche Darstellung dieses
Krankheitsgebietes anbietet, das dem Suchenden kaum eine Antwort schuldig bleiben
dtirfte.
Gottingen, im April 1988 Prof. Dr. med. G. Joppich
em. Direktor der
Universitats-Kinderklinik
Gottingen
v
Geleitwort
Auch die moderne und wirksame antibiotische Therapie kann dem praktisch tatigen
Arzt nicht ersparen, Uber ihren Einsatz gerade bei der bakteriellen Meningitis gewissen
haft nachzudenken. Er wUnscht sich einen Wegweiser, der ihm eine Entscheidungshilfe
anbietet. Was und wieviel davon ist notwendig? - Hier findet man die Antwort.
Der am Beginn seiner Ausbildung stehende Kinderarzt muB sich nun nicht mehr lange
mit der einschlagigen Literatur befassen, ehe er in Zweifelsfallen tatig werden kann.
Aber auch der erfahrene Padiater findet Anregungen und Tips und ist aufgefordert,
seinen Wissensstand aufzufrischen. Viele Hinweise sind in dieser Form sonst nirgendwo
nachzulesen.
Ich darf dem Verfasser -langjahriger Abteilungsarzt an unserer Klinik und geschatzter
Kollege - eine weite Verbreitung seines Werkes wUnschen.
Darmstadt, im April 1988 Prof. Dr. Ulrich Wemmer
Direktor der Kinderklinik
Darmstadt- Eberstadt
VI
Vorwort
Die bakterielle Meningitis ist trotz therapeutischer Fortschritte und der Verbesserung
intensivmedizinischer Moglichkeiten nach wie vor eine ernste, lebensbedrohliche Er
krankung, die oft von bleibenden Schiiden begleitet wird. Die Prognose hiingt einzig
von einer fruhzeitigen differentialdiagnostischen Abklarung und von einer sofort ein
geleiteten antimikrobiellen Therapie abo
Dieses Buchlein faBt meine nunmehr 20jahrige kinderarztliche, in klinischer Tatigkeit
gewonnene Erfahrung mit Meningitis zusammen. Nicht akademische Fragen sollen darin
im Vordergrund stehen, sondern die Probleme des Arztes am Krankenbett, in dessen
Handen das Schicksal der Kinder liegt. Es enthalt - durch zahlreiche Tabellen leicht
zuganglich - Orientierungshilfen zur schnellen Differenzierung der Meningitis und zu
ihrer Therapie. Ausgefallene, wissenschaftlich orientierte Diagnoseverfahren werden
summarisch erwahnt. Yom raschen Zeitpunkt der Diagnose und Therapie hiingt in
erheblichem MaBe die Mortalitat und die neurologische Defektheilung abo Andere
GesetzmaBigkeiten gelten bei der Neugeborenensepsis mit Meningitis und beim Water
house-Friderichsen-Syndrom. Deshalb sind beiden Formen der Krankheit eigene Kapitel
des Buches gewidmet.
Ich bedanke mich bei Herrn Ulrich Fiedler, der durch seine Dissertationsarbeit die
wissenschaftlichen Grundlagen fur dieses Buch erarbeitet hat.
Mein Dank gilt auch meinen beiden Sekretarinnen Frau Rita Shinkle und Frau
Gerlinde Holzhauer flir das Schreiben, die Formgebung und die Korrektur des Manu
skriptes sowie ihre groBe Hilfe bei der Literaturzusammenstellung.
Herrn Muller, Marburg, danke ich besonders fur die Anregung zu dies em Buch, flir
die vielen guten Ratschlage und seine Bemuhungen.
Darmstadt, im August 1988 H. Isenberg
VII
Inhaltsverzeichnis
Geleitworte ................................................................... V, VI
Vorwort ....................................................................... VII
1 GeschichtIiches zur Meningitis epidemica (Genickstarre) ................. 11
2 Beschreibung des Krankengutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Pathogenese und Morphologie ............................................ 24
4 Liquorphysiologie ......................................................... 27
5 Allgemeine Symptomatik ................................................. 33
6 Diagnostik der bakteriellen Meningitis .................................... 39
7 Problematik der DifferentiaIdiagnose ..................................... 57
8 Therapie und Prognose der Meningitis
im KindesaIter nach der 6. Lebenswoche .................................. 61
9 Behandlungsdauer der bakteriellen Meningitis ............................ 68
10 Chemoprophylaxe ......................................................... 71
11 Diagnose und Therapie des Waterhouse.Friderichsen.Syndroms .......... 74
U Neugeborenensepsis ....................................................... 78
Anbang ....................................................................... 97
IX
1 Geschichtliches zur Meningitis epidemica
(Genickstarre)
Wenngleich schon Galen und Hippokrates die Symptomatik der Meningitis kannten, so
ist doch die Geschichte der Diagnose und Therapie der Meningitis weniger als 200 Jahre
alt (1).
Hippokrates stellt im ersten Kapitel des dritten Buches von »De morbis« fest: »Wenn
das Him unter dem Druck der Entztindung an Volumen zunimmt, gibt es Kopfschmerzen.
Sie sind in dem Teil starker, wo die Entztindung wtitet. Der Schmerz wird auch in den
Schlafen empfunden. Der Kranke bekommt Ohrensausen, und das Gehor wird stumpf.
Die BlutgefaBe sind gespannt und sie klopfen. Fieber und Schauer tun sich kund, doch
der Schmerz nimmt nicht ab, er laBt nur nach, wenn das Fieber sich ausbreitet. Diese
Krankheit ist verhangnisvoll. Man kann nicht beurteilen, an welchem Tag der Tod
eintritt.« 1m zweiten Kapitel heiBt es dann weiter: »Wenn sich das Wasser im Him bildet,
entstehen heftige Schmerzen in den Schlafen und anderen Teilen des Kopfes. Von Zeit
zu Zeit gibt es Schauer und Fieber. Die Gegend der Augen ist schmerzhaft, die Sicht
verdunkelt, die Pupille deformiert. Es ergibt sich daraus Doppelsichtigkeit. Erhebt sich
der Kranke, so bekommt er Schwindelgefiihle. Er ertragt weder Wind noch Licht. Er
bekommt Ohrensausen, erbricht Speichel, Schleim und manchmal das Essen« (4). Die
ersten Publikationen, die sich mit der Beobachtung epidemischer Meningitisfalle befas
sen, gehen auf Thomas Willis (1661 in London) (1621-1675) und den Franzosen Gaspard
Vieusseux (1746 -1814) zurtick (1).
Viele kannten die Krankheit, hatten aber wenig Erkenntnisse tiber den Verlauf und
sprachen entsprechend den Erkenntnissen Galens von Phrenitis mit den Leitsymptomen
Kopfschmerzen, Fieber, Delirium. Bei den todlich verlaufenden Fallen fand man stets
Eiter an der Himoberflache. In weniger schweren Fallen sprach man von Zephalitis,
Gehimfieber oder akutem Hydrozephalus (3).
Vieusseux erkannte bei der Epidemie 1805 in Genfund Umgebung, daB die Meningitis
vor allem bei jungen Kindem und jungen Menschen zum Tod fiihrte und hochstens 10%
der Opfer tiber 30 Jahre alt waren. Neben den schon bekannten Symptomen beschrieb
er vor allem die violetten Flecke am Korper der sterbenden Kinder. Elisha North (1771
- 1843) berichtet 1811 in New York, daB das Auftreten von Flecken hauptsachlich im
Gesicht, am Nacken und an den Extremitaten, aber auch am ganzen Korper als progno
stisch ungtinstiges Zeichen zu bewerten sei. Diese Flecken konnten stecknadelkopfgroB
sein oder auch die GroBe einer 6 Cent-Mtinze erreichen. Sie seien nicht erhaben und
verschwanden nicht bei Druck. Je dunkler die Petechien, desto schwerer sei die Krankheit
(4).
Der Begriff »Meningitis« wurde erstmalig 1803 von Herpen in seiner Dissertation
gebraucht. Eine ausfiihrliche Beschreibung der Morphologie erfolgte von Matthey 1806.
Seither sprach man regelmaBig von Meningitis-Komplex. Genaue Zusammenhange
11
zwischen Krankheitserregern, Symptomatik und Ansatzen zur Therapie waren jedoch
erst fast 100 Jahre spatermoglich, nachdem Quincke 1891 die Lumbalpunktion eingeflihrt
hatte (1).
1887 entdeckte der Pathologe und Anatom Anton Weichselbaum (1845 - 1920) in
Wien aus autoptischem Material den Erreger und nannte ihn Diplococcus intracellularis
meningitidis (heute Neisseria meningitidis) (1, 4). Dem Padiater Heubner gelang es
erstmals 1896, aus in vivo gewonnenem Lumballiquor die Diplokokken zu ziichten.
Bis zu dieser Zeit waren alle therapeutischen Ansatzpunkte frustran, unspezifisch und
in der Regel erfolglos. Die Prognose war gerade im Kindesalter fatal und die Letalitat
betrug 70 - 100%. Die von Kolle und Wassermann 1905 bzw. von Jochmann 1906
eingeflihrte Serumtherapie ermoglichte schlieBlich, die Letalitatziffer auf etwa die Halfte
zu senken. Finkelstein gibt 1921 in seinem Lehrbuch flir Sauglingskrankheiten als Be
handlungsversuch bei Meningitis an: Ansatz von Blutegeln am Warzenfortsatz, Schmier
kuren, heiBe Bader, antiphlogistische Behandlung mit Antipyrin und Salizylaten sowie
Eisumschlage auf den geschorenen Kopf, Narkotika gegen Unruhe und Schmerzen, Jod
Kalium-Gaben und Lumbalpunktionen. Die bis 1940 fortgesetzte intramuskulare und
intralumbale Serumapplikation wurde mit sehr unterschiedlicher Begeisterung und letzt
lich mit groBer Skepsis beurteilt. Erst mit der Einflihrung der Sulfonamidtherapie 1937
kam es zu einer geradezu dramatischen Beeinflussung dieses fatalen Krankheitsbildes
mit einem Riickgang der Letalitat, so daB man die Entdeckung dieses Praparates als
eine der schonsten Errungenschaften der modernen Medizin bezeichnete (1).
Nach Jahrhunderten hoffnungsloser Prognose eroffneten nun die nachsten Jahre
immer weitere M6glichkeiten der Chemotherapie. Die Einflihrung des Penicillins 1942
erbrachte in der konventionellen Dosierung von 0,2 - 1 Mega IE taglich parenteral,
erganzt durch tagliche intrathekale Injektionen von 10.000 bis 20.000 E etwa gleich gute
Resultate wie die Sulfonamidtherapie. Diese Erfolge bezogen sich jedoch im wesentli
chen nur auf gut empfindliche Keime wie etwa Meningokokken, wahrend bei Pneumo
kokken die Ergebnisse wesentlich deprimierender waren. Erst die massive Erhohung
der Penicillindosen zwischen 1946 und 1949 auf i. v. 20 Mio E taglich, bzw. i.m. 2-stiindlich
1 Mio E brachte unter Verzicht auf intrathekale Injektion jetzt auch bei Pneumokokken
eine wesentliche Erfolgsverbesserung (1).
Hierbei ist anzumerken, daB bei Meningokokken-Meningitis schon vor der Einfiihrung
der Sulfonamide nahezu die Halfte der Kinder iiberlebte, wahrend die Pneumokokken
und Haemophilus-influenzae-Meningitis fast ausnahmslos todlich verlief. Ebenso ist
bemerkenswert, daB durch Sulfonamide allein bereits die Letalitat der Haemophilus
influenzae-Meningitis wesentlich, die der Pneumokokken-Meningitis dagegen nur gering
verbessert werden konnte (1, 2).
Nach den Sulfonamiden und dem Penicillin wurde 1946 Chloramphenicol als dritte
Substanz erfolgreich in die Meningitis-Therapie eingefiihrt. Es war das erste Antibioti
kum mit breitem Wirkungsspektrum und ausreichend guter Liquorgangigkeit auch bei
wenig entziindeten Meningen. In dieser letzten Eigenschaft ist es auch heute noch
uniibertroffen. Andererseits ist seine Wirkung nur bakteriostatisch, und die minimale
Hemmkonzentration der infrage kommenden Erreger wird durch die im Liquor erreich
ten Konzentrationen zwar deutlich, jedoch nicht urn 10er Potenzen iibertroffen. Auch
wird heute zunehmend die Hamatotoxizitat des Chloramphenicols sowie das Grey
Syndrom als Risiko empfunden. Fiir die Pneumokokken-Meningitis konnte in verglei
chenden Studien nachgewiesen werden, daB die Kombination Penicillin und Chloram-
12