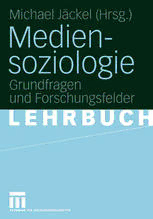Table Of ContentMichael Jackel (Hrsg.)
Mediensoziologie
Michael Jackel (Hrsg.)
Medien
soziologie
Grundfragen
und Forschungsfelder
I
VS VERLAG FOR SOZIALWISSENSCHAFTEN
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Uber <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
1. Auflage November 2005
Aile Rechte vorbehalten
© VS Verlag fUr Sozialwissenschalten/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005
Lektora!: Barbara Emig-Raller
Der VS Verlag fUr Sozialwissenschalten ist ein Unternehrnen van Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werk einschlieBlich aller seinerTeile ist urheberrechtlich geschUtzl. Jede
verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ahne Zustimmung des Verlags unzulassig und stralbar. Das gilt insbesandere
fUr Verviellaltigungen, Obersetzungen, Mikroverlilmungen und die Einspei
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe van Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ahne besandere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass salche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als Irei zu betrachten
waren und daher von jedermann benutzt werden dUrlten.
Umschlaggestaltung: KUnkelLapka Medienentwicklung, Heidelberg
Gedruckt aul saurelreiem und chlarlrei gebleicl1tem Papier
ISBN-13 978-3-531-14483-2 e-ISBN-13 978-3-322-80675-8
DOL 10.1007/978-3-322-80675-8
Inhalt
VOrbelTICrkung ......................................................... . .. ....................... " ................... 7
Michael Jiickel
Einleitung - zut Zielsetzung des Buches ......................................................................... 9
MichaelJikkc! / ThomCis Crt/nd
Eine Medicnsoziologie - aus der Sicht der Klassiker .......... . .. ............ 15
Jan D. Reinhardt
Mcclien und Idcntitat. ........................................................................................................ 33
Thomas Dobler
Medicn und ihre Nutzer ...... . ....................................................................................... 47
JoacbiJII R. Hifjlich
Medlen und intcrpcrsonale Kommunikation ..... .. .............................................. 69
A "gela Keppler
Medien und soziale Wirklichkeit ..................................................................................... 91
Herbert Willellls
Medicn und die Inszenierung sozialcr Rollen . .. .................................... 107
Waldemar f7ogc/ge.w"g
Medien und abweichendcs Ve rhalten .......................................................................... 125
RaillerU:/illtf'T
Medicn und Kultur. .... 149
Udo Gottlieh
Medicn und Kritik ..................................... . .. ...................... 163
6 Inhalt
Hal1s:Tiitgel/ Btlcher / Arnefi, DJicklVitz
Medien und soziale Konflikte... .. ......................................................................... 179
Richard Miinch / Jal1 Schmidt
Medien und sozialcr Wandel .......................................................................................... 201
Michaef Jiickel
Medien und Tntegration .................................................................................................. 219
ThottJas LeI1Z / Nicole Zit/ien
Medien und sozialc Unglcichhcit .................................................................................. 237
Manfred iVIai
T\1edien als soziales System ...... ...................... ............................. ................................. 255
KJlrt Imho!
Medicn und Offcntlichkcit. ............................................................................................ 273
Michael Jackel
Medien und Macht ........................................................................................................ 295
CbriJtia11 S tcgballer
Medien und sozialc Net7.werkc ..................................................................................... 319
Ucla Thiedcke
Mcdicn und virtualisierte Vergesellschaftung .............................................................. 335
1 clf/jel) S chJlltz / HmiJJJJlt WejJler
Medicn und Transnationalisierung ............................ . . ................................... 347
Cornelia Bobll
Die Medicn der Gcsellschaft. .. .. ......................... 365
Sachrcgister ......... . .. ... 377
Auturenvcrzeichnis ........ . .. ... 385
Vorbemerkung
Die Idee fLrr das vorliegende Buch entstand im Laufe des Jahres 2004, die Gesamt
konzeption nalun Ende dessclben Jahres konkrete ['ormen an. Dass der Band in
nerhalb cines Zciu-aums von weniger als zw()lf l\1onaten realisicrt werden kOl1ntc,
ist zunachst def graBen Disziplin det betciligtcn Autorinncn wld Autoren zuzu
schreiben, denen Iller an efster Stelle Inein hcrzlichster Dank gilt. Ebenso danke ich
Frau Emig-Roller vom Verlag fLir Sozialwissenschaften fur die Aufnahme des
Buchs in das Verlagsprogramm und die gute Zusammenarbeit.
Rei Projekten dieser j\rt sind in der redaktionellen Phase viele inhaltliche De
tailfragen zu kliiren, die Nicole Zillien, Thomas Grund und Thomas Lenz in akribi
scher und vorbildlicher \X,T eise gelDst haben. Ich lllochte deren Engagement an die
ser Stelle besonders hervorheben. Dank auch an Sabine Wollscheid, Tobias Schlo
mer und Christian Gerhards, die insbesondere in clet Schlussphase dell1 Hcrausge
bet mit Rat und Tat zut Seite standen.
Trier, im Oktobcr 2005 MichaclJackel
Einleitung - zur Zie1setzung des Buches
Nlichael Jackel
\Xler den Diskurs liber die l110derne Gesellschaft aufmcrksam beobachtet, wird zu
l1achst feststellen, class diese ein Problenl tuit ihrer Selbstbcschreibung hat. .leder
der mittlerweile zahlreichen Vorschlage (vgL die Beitrage in Schimank/Volkma1U1
2000) kann s1ch skeptischer Einwande sieher sein. Nun sind zusatrunengesetzte Ge
sellschaftsbegriffe wie ,Informationsgesellschaft', ,Risikogesellschaft' und auch ,Me
diengescllschaft' in erster Lime in bcstimmten (zumeist wissenschaftlichcn) Kontex
ten cntstandene Hervorhebungen bestllnmter Beobachtungcl1, die notgedlungen
verkiirzen, weil sic im Zuge des Hervorhcbens bestinuntcr Merklnalc andere VCt
nachEissigen. Die Aufforderung zu diffcrenzieren ist in der Regel das Resultat ciner
iiberzeichnetcn Vcrallgemeinerung besrinuntcr Verhaltnisse. Wer auf Gemeinsam
keitcn odcr dOl1unante Strukturmerk111aIc hinweist, tuuss den Hinwcis auf die Un
tcrscruedc cinkalkulieren; wer der Diffcrcnzicrung allzu groBe Bedeutung zu
schreibt, wiro mit Fragen nach del' Integration konfrontiert oder aufgefordert, die
Grenzen von Individualisierungssehliben 7.U benennen. Sehimank weist im Rahmen
seiner Einfi.ihrung zu Theorien gesellsehaftlieher Differenzierung darauf hin, dass
die Entstehung von Rollenvie1falt sowohl die Konsequenz ais aueh die weitere Vor
aussetzung von gesellsehaftliehcr Vielfalt gcwcsen ist. Vor clem Hintergrund dieser
Ent\vieklung wird nieht crst in den lctztcn Jahrcn auf FoIgcn hingcwiescn, die als
Ergebnis cincs institutionalisicrtcn Individualis111us lucht von allcn gewollt "varen,
beispielsweise: "Immer mehr Gesellschaftsmitglieder sehlagen sich luit immer be
schrankteren ,Tunnelblicken' durchs Leben; und wer hat clann eigentlich noch den
Oberblick liber die Ordnung des gesellschaftlichen Ganzen?" (Schimank 2000, 11)
Naturwissensehaftler und Sozialwissenschaftlcr betonen, class Leben bz\\,. Ge
sellschaft viel zu komplex ist, um als Einheit iiberhaupt wahrnehmbar zu sein. Einc
Pluralitat del' analytischcn Vorgchensweisc ist insofern nur konsequcnt. Die Ge
schichtc dcr Soziologie zeigt ebenfalls, Jass e.s eine einheitliehe Perspektive auf die
wissensehaftliehen Grundlagen der Disziplin einerseits und ihren Beobaehtungsge
genstand anoererseits nie gegeben hat. Daher ist ehef von Lmelu "Kult del' Ein
heitswissensehaft" (1\1unch 2002, S. 9) zu sprcchen. Dcm Paradig111cnsU'cit in den
Sozialwissenschaften halt T\1l.inch cntgegcn: ".1 eoer diesel' V crsuchc bedeutct lctzten
Endcs immel', oass eine spezifisehe Sieht auf die soziale \Xl elt falsehliehenveise fur
das Ganze gehalten wird I. .. ]." (ebenda, S. 9)
10 Michael Jackel
Ais Rene Konig seinen V orsehlag einer Soziologie als Einzelwissensehaft priisen
ticrte, wahlte cr cine Formulictung, die bis heutc neugierig macht: Es soHte cine So
ziologie siehtbar werden, "die niehts als Soziologie ist" (Konig 1967, S. 8), weil sic
sich als emplrische Einzelwissenschaft konstituieren sone. Dies ermoglichc "die
wissensehaftlieh-systematisehe Behandlung der allgemeinen Ordnungen des Gesell
schaftslebens, ihrer Bewegungs- und Entwicklungsgcsetzc, ihrer Beziehungen zut
nariirlichen Umwelt, zur Kultur im allgemcincn und zu den Einzelgebictcn des Le
bens und sehlieGlieh zur sozial-kulturellen Person des Mensehen." (ebenda, S. 8)
Heute neigt man dazu, die darin angelegte Vielfalt der Aufgaben einer Mikro-, Me
so- und Makrochcne zuzuordncn, was nicht unbedingt 7,U cmcr hoheren Transpa
renz des Beobachtungsgegenstands beitragt. \X'ic auch immer ein soleh umfasscndes
Programm besehrieben wird - cin gelegentliehes Wildern in Randgebieten und
N achbardisziplinen wird 5ich kaum vermeiden lassen. Fiir die hier darzustellende
Rindestrich-Soziologie gilt dies auch. Es gibt, so konnte man iiberspit7.t formulieten,
nicht nut cine Vielfalt det Beobachtungen, sondetn aueh cine Pluralirat der Auffas
sungen, wie man jenc Wisscnschaftlet nennen soil, die diese Beobachtungen ma
chen: Medien\\t1ssenschaftler, Kommunikationsforscher, Wirkungsforseher usw. Ei
ne weitere Besondetheit resulticrt daraus, dass den lvledien cine Doppclfunktion
7.Ukomn1t: Sie werden nieht nur als gesellsehaftliche Einriehtung analysierf, sie lie
fern quasi selbst tagtaglieh Reschtcibungen von Gesellschaft, die mit sozialwissen
sehaftlichen Diagnosen konkurtiercn.
Ocr hier gewahlte \Xleg ist dennoeh kein Komptomiss, sondern der konse
quente Versuch, die Zusammenfuhrung von Medien + GeseUschaft analytisch unter
V orgabe des Verbindungsg1ieds 7.U beschteiben. Das ist in manchen Fallen auf der
begriffliehen Ebene leieht realisierbar (z.B. Medien und sozialc Konllikt:e), in ande
ren Eillen ist die Verkniipfung weniger evident (z.B. Medien und Kritik). Dennoeh
winl dieser Weg ruer besehritten: cine Einbindung von i'v1cdien in cine soziologische
Perspektive. Dcr zugrunde gclegte Mcdien-Begriff ist dabci nieht der umfassende,
aueh alle symboliseh generalisierten Medien (z.B. Geld, Spraehe, Macht) einsehlie
Hende, sondern jener, der auch intuitiv damit assozi1ert \vird: auf technische
Verbreitungsmittcl, die ein disperses Publikum erreichen konnen, be7.ogen.
Die Zusammcnfiihrung von 1Yledien + Gesellschaft solI 7.unachst nut betonen,
dass die Verfasstheit moderncr Gesellschaftcn mit der Existcnz von Jvlas~enmedien
und -kommunikation eng vcrtlochten ist. Wenn Joas die Aufgabe der Soziologie
darin sieht, die "Arten und Weisen, wie das n1enschliche Leben sozia1 organisicrt
wird" (2001, S. 14), zu untersuchen, dano kann dies im vorliegenden Zusammen
hang als Aufforderung vcrstanden werden, nach Struktutmcrkmalen zu suehen, die
dem Vorhandcnsein von liber TVlassenmedicn verbreiteten Angebotcn zuzuschrei
ben sind. Das kann auf der Mikrocbene die t\llokation von Zeit, die (kollektive) Su
che nach Vorbildern oder die Bezugnahmc auf Thcmen scin, dcren (wenn auch nur
rudimentare) Kenntnis Kommunikation unter Fremucn lcicht mbglich macht; auf
Einleitung - zur Zielsetzung des Buches 11
det 1-1akroebene konnen geteilte \XTirklichkeitsvorstelluugen, "Einheits"suggestionen
wie offentliche Meimmg oder als dysfunktional eingestufte Phanomene wie Wis
sensillusionen dutch Informationsuberlastung genannt werden.
Andererseits erzeugt die Existenz von Massenmedien, das StattHnden von
Massenkonununikation, Bcdingungen, die cine spezifische Strukturicrthcit von Ge
sellschaft ermoglichen. Sozialwissenschaftliche Stichworte sind hier z.R. National
staatlichkeit, Demokratie, funktionalc Ausdiffcrenzierung oder Globalisierung.
Der vorliegende Band prasentiert Oberblicksbeitrage, die sieh an der gerade
fonnuliertcn Zielsetzung oficnrieren: Gnmdbcgriffe del' Soziologie werden in V Ct
bindung mit dem Medien-Begtiff (und das heillt: als unabhiingige, abhangige oder
intcrvcrucrcndc Gr6I3e) crortert, Jedem Beitrag ist eine Zusanunenfassung vorangc
stellt, so dass im Folgenden nur wenige Hinweise auf den rubalt gegeben werden.
Dass die Notwendigkeit der hier vcrfolgten Verbindung von Medien und Ge
sellschaft bereits in den Anfangen der Soziologie gesehen wurde, zeigen Michael Ja
ckel und Thomas Grund anhand einer Spurensuche unter den Klassikern des Fachs,
bevor sich Jan D. Reinhardt der Diskussion einer sehr zentralen Aufgabe widmet:
clem Zusammcnhang von lYledien und Idcntitat, der offensichtlich aus einem kom
plexcn Mixtum von Selbst- und Fremdthematisierungen he!"vorgeht. Ebenso kom
plex ist das Verhhltnis der Medien zu ihren Nutzern und umgekehrt geworden.
Thomas Dobler fokussiert dabei insbesondere die Notwendigkeit sozialer Differen
zierungen und macht damit gleichsam auf einer spezifischen Ebene dcutlich, dass
von Einheit keine Rcde sein kann. Das gilt vice versa auch fur das Reden liber Me
dien und das Reden in MeJicn. Joachim Hoflich zeigt, wie sehr Medien und inter
u
personale Korrununikacion miteinander vctwoben sind lmd in vielfiltiger Weise
ber den Bereich der l\tlassenkomrnunikation hinausweisen und neue Interaktions
kontexte generieren. Ungeachtet dessen ist die in den Mcdien "gespiegelte" \Virk
lichkeit das am haufigsten thematisie!"te Wirkungspotenzial, das Angela Kepple!" un
ter Riickg!"iff auf eine nahe liegende Tradition der Wissenssoziologie behandelt. An
diese Thematik schlicllt sich Herbert Willems nahtlos an, in dem er Medien als ein
weites Feld von Inszenierungen sozialer Rollen beschreibt, zugleich abet ein dialek
tischcs V crhaltnis zu den von Publika generierten Kulturen identifizictt. Es sind a
ber nicht nur diese gegenseitigen Konstruktionen von Wirklichkeit, die cine be
stinunte Form von Medieneinfluss hcrvorbringen, sondern gerade auch die zahlrei
chen Formen abweichcnden Vcrhaltcns, die wcsentlich mit zu einem Unbchagen an
der Modernc bcitragen. Waldemar Vogelgesang macht dies unter anclcrem an spck
takuJaren Einzclfallen cleutlich, lost sich aber von den klassischen ErklarungsMsat
zen, insbesondere in Bezug auf den Zusammenhang von Ivle<..lien und Gewalt.
Dass :Massenmcdien sukzcssivc cine neue symbolische Umwelt mlt vielf.-iltigen
Anschlussmoglichkeiten geschaffen haben, hat auch zu der hage gefuhrt, welche
Kulnu clamit auf Dauer gestellt wird. Dieses Thema ist sehr eng mit clem Diskurs
tUn die Moderne verkniipft und wird von Rainer Winter gerade auch im KOnt"ext