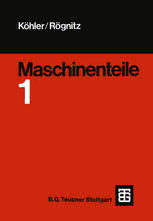Table Of ContentKöhler jRögnitz, Maschinenteile
Inhalt des Gesamtwerkes
Teil 1
6., neubearbeitete und erweiterte Auflage. 1981.
VIII, 232 Seiten mit 286 Bildern und 2 Tafeln.
Beilage : Arbeitsblätter 93 Seiten mit 22 Bildern und 103 Tafeln. Geb. DM 46,-
Einführung in das Konstruieren und Berechnen von Maschinenteilen / Nietverbindun
gen: Werkstoffe für Bauteile und Niete, Nietherstellung, Nietformen, Nahtformen,
Berechnungsgrundlagen / Stoffschlüssige Verbindungen: SchweiBverbindungen, Löt
verbindungen, Klebeverbindungen / Reib-und formschlüssige Verbindungen, Keilver
bindungen, Bolzen und Stifte / Schraubenverbindungen: Kräfte in der Schraubenver
bindung, Berechnen von Schrauben, Ausführungen von Schraubenverbindungen,
Berechnungsbeispiele / Federn: Berechnungsgrundlagen, Bemessen und Gestalten der
verschiedenen Bauformen / Rohrleitungen und Armaturen: Rohrverbindungen,
Rohrleitungsschalter / Dichtungen: Dichtungen an ruhenden Maschinenteilen,
Berührungsdichtungen an bewegten Maschinenteilen, Berührungsfreie Dichtungen /
Beilage : Arbeitsblätter.
Teil 2
6., neubearbeitete und erweiterte Auflage. 1981.
VIII, ca. 360 Seiten mit ca. 290 Bildern imd Tafeln.
Beilage : Arbeitsblätter ca. 100 Seiten mit ca. 40 Bildern und ca. 90 Tafeln. Geb.
DM 58,-
Achsen und Wellen: Entwicklung des Rechnungsganges, Gestalten und Fertigen /
Gleitlager: Gleitvorgang, Berechnen und Bemessen der Radiallager, Gleitlagerbauar
ten, Einzelteile, Schmiereinrichtungen / Wälzlager: Kraftwirkungen im Wälzlager,
Normung und Gestaltung der Lagerstelle, Beispiele / Kupplungen und Bremsen :
Nichtschaltbare starre Kupplungen, Nichtschaltbare formschlüssige Ausgleichs
kupplungen, Schalt bare Kupplungen, Bremsen / Kurbelbetrieb: Tauchkolbentrieb
werk, Berechnungsgrundlagen, Kinematik und Dynamik des Kurbelbetriebes, Aufbau,
Funktion und Gestaltung der Triebwerksteile, Festigkeitsberechnung / Kurvengetrie
be: Nockensteuerungen, Kreisbogennocken mit geradem TellerstöBel, Gestaltung /
Zugmittelgetriebe: Reib- und formschlüssige Zugmittelgetriebe / Zahnrädergetriebe:
Zykloidenverzahnung, Evolventenverzahnung an Geradstirnrädern, Schrägstirnräder
mit Evolventenverzahnung, Kegelräder, Stirnrad-Schraubgetriebe, Schneckengetrie~
be, Aufbau der Zahnrädergetriebe / Beilage : Arbeitsblätter.
Preisänderungen vorbehalten
Köhler /Rögnitz
Maschinenteile
Teil 1
Herausgegeben von
Prof. Dr.-Ing. J. Pokorny
Bearbeitet von
Prof. Dipl.-Ing. H.-D. Haage Prof. Dipl.-Ing. G. Schreiner
Doz. Dipl.-Ing. L. Hägele Prof. Dr.-Ing. J. Pokorny
Prof. Dipl.-Ing. E. Hemmerling Prof. Dipl.-Ing. U. ZeI der
6., neubearbeitete und erweitcrte Auflage
Mit 286 Bildern und 2 Tafeln mit weiteren 7 Bildern
Beilage: Arbeitsblätter mit 22 Bildern
lInd 103 Tafeln mit weiteren 151 Bildern
B. G. Teubner Stuttgart 1981
HHeerraauussggeebbeerr:: PPrrooffeessssoorr DDrr..--IInngg.. JJooaacchhiimm PPookkoorrnnyy
UUnniivveerrssiittäätt--GGeessaammtthhoocchhsscchhuullee--PPaaddeerrbboorrnn,,
AAbbtt.. SSooeesstt
BBeeaarrbbeeiitteerr:: PPrrooffeessssoorr DDiippll..--IInngg.. HHaannss--DDiieetteerr HHaaaaggee
TTeecchhnniisscchhee FFaacchhhhoocchhsscchhuullee BBeerrlliinn
DDoozzeenntt DDiippll..--IInngg.. LLootthhaarr HHääggeellee
FFaacchhhhoocchhsscchhuullee AAaaIIeenn
PPrrooffeessssoorr DDiippll..--IInngg.. EErrnnsstt HHeemmmmeerrlliinngg
HHoocchhsscchhuullee ffüürr TTeecchhnniikk BBrreemmeenn
PPrrooffeessssoorr DDiippll..--IInngg.. GGeerrhhaarrtt SScchhrreeiinneerr
FFaacchhhhoocchhsscchhuullee MMaannnnhheeiimm
PPrrooffeessssoorr DDrr..--IInngg.. JJooaacchhiimm PPookkoommyy
UUnniivveerrssiittäätt--GGeessaammtthhoocchhsscchhuullee--PPaaddeerrbboorrnn,,
AAbbtt.. SSooeesstt
PPrrooffeessssoorr DDiippll..--IInngg.. UUddoo ZZeellddeerr
UUnniivveerrssiittäätt--GGeessaammtthhoocchhsscchhuullee--PPaaddeerrbboorrnn
CCIIPP--KKuurrzzttiitteellaauuffnnaahhmmee ddeerr DDeeuuttsscchheenn BBiibblliiootthheekk
MMaasscchhiinneenntteeiillee II KKööhhlleerr II RRööggnniittzz.. -- SSttuuttttggaarrtt::
TTeeuubbnneerr
NNEE:: KKööhhlleerr,, GGüünntteerr [[HHrrssgg..))
TTeeiilltt.. HHrrssgg.. vvoonn JJ.. PPookkoorrnnyy.. BBeeaarrbb.. vvoonn HH..--DD..
HHaaaaggee ...... -- 66..,, nneeuubbeeaarrbb.. uu.. eerrww.. AAuuffll.. -- 11998811..
IISSBBNN 997788--33--332222--9944009900--22 IISSBBNN 997788--33--332222--9944008899--66 ((eeBBooookk))
DDOOlI 1100..11000077//997788--33--332222--9944008899--66
NNEE:: PPookkoorrnnyy,, JJooaacchhiimm [[HHrrssgg..]];; HHaaaaggee,, HHaannss--DDiieetteerr
[[MMiittvveerrff..]]
DDaass WWeerrkk iisstt uurrhheebbeerrrreecchhttlliicchh ggeesscchhüüttzztt.. DDiiee ddaadduurrcchh bbeeggrrüünnddeetteenn
RReecchhttee,, bbeessoonnddeerrss ddiiee ddeerr ÛÛbbeerrsseettzzuunngg,, ddeess NNaacchhddrruucckkss,, ddeerr BBiillddeenntt··
nnaahhmmee,, ddeerr FFuunnkksseenndduunngg,, ddeerr WWiieeddeerrggaabbee aauuff pphhoottoommeecchhaanniisscchheemm
ooddeerr äähhnnlliicchheemm WWeeggee,, ddeerr SSppeeiicchheerruunngg uunndd AAuusswweerrttuunngg iinn DDaatteenn··
vveerraarrbbeeiittuunnggssaannllaaggeenn,, bblleeiibbeenn,, aauucchh bbeeii VVeerrwweerrttuunngg vvoonn TTeeiilleenn ddeess
WWeerrkkeess,, ddeemm VVeerrllaagg vvoorrbbeehhaalltteenn..
BBeeii ggeewweerrbblliicchheenn ZZwweecckkeenn ddiieenneennddeerr VVeerrvviieellffäällttiigguunngg iisstt aann ddeenn VVeerrllaagg
ggeemmääBB §§ 5544 UUrrhhGG eeiinnee VVeerrggüüttuunngg zzuu zzaahhlleenn,, ddeerreenn HHööhhee mmiitt ddeemm VVeerr··
llaagg zzuu vveerreeiinnbbaarreenn iisstt..
©© BB.. GG.. TTeeuubbnneerr,, SSttuuttttggaarrtt 11998811
SSooffttccoovveerr rreepprriinntt ooff tthhee hhaarrddccoovveerr 11ss tt eeddiittiioonn 11998811
SSaattzz uunndd DDrruucckk:: GGrrooBBddrruucckkeerreeii EErriicchh SSppaannddeell,, NNüürraabbeerrgg
BBiinnddeerreeii:: EE.. RRiieetthhmmüülllleerr && CCoo .... SSttuuttttggaarrtt
UUmmsscchhllaaggggeessttaallttuunngg:: WW.. KKoocchh,, SSiinnddeellffiinnggeenn
Vorwort
Die rasche Entwicklung der Technik hat auch die klassischen "Maschinenelemente" be
einfluJ3t. Auf der einen Seite sind heute viele Maschinenteile und teilweise sogar deren
Berechnung genormt, auf der anderen Seite gewinnen fertigungsgerechtes und damit
wirtschaftliches Bemessen und sorgfältiges Berechnen steigende Bedeutung. Dies aber
bedingt die Anwendung der Festigkeitslehre beim Nachrechnen genormter Teile oder die
vollständige Berechnung neu zu gestalten der Maschinenteile. Das vorliegende Lehr- und
Arbeitsbuch will den Studierenden wie auch den Ingenieuren in der Praxis eine Hilfe bei
der Berechnung und Gestaltung von Maschinenteilen bieten. So führt die Darlegung des
Stoffes im Sinne der Konstruktionsmethodik in den meisten Fällen von der Aufgaben
stellung über die Funktion, Berechnung und Gestaltung zu Lösungsmöglichkeiten.
Das Werk" Maschinenteile" ist in zwei Teilen wie folgt aufgebaut: rn Abschnitt 1 "Ein
führung in das Konstruieren und Berechnen von Maschinenteilcn" wird dem Anfänger
zunächst ein Überblick über den Vorgehensplan fLir das Schaffen neuer technischer Ge
bilde beim Konstruieren und Leitlinien für das Entwerfen und Gestalten gegeben. H in
weise auf richtiges Gestalten enthalten auf3erdem alle folgenden Abschnitte. Darüber
hinaus wird in Abschnitt 1 an einfachen Beispielen die zweckmäf3igc Anwendung der
Tec1111ischen Mechanik, z. B. das Ermitteln unbekannter Kräfte, Momente und Span
nungen und die Wahl von zulässigen Spannungen, Sicherheitszahlen sowie anderen Kenn
und Richtwerten gezeigt. Der einleitende Abschnitt fLihrt dann weiter bis in die Berech
nung auf Dauerhaltbarkeit, jedoch werden diese AusfLihrungen für das Verständnis der
folgenden Abschnitte mit den einzelnen Maschinenteilen selbst nicht et wa vorausgesetzt.
Denn darin stehen Auswahl, Normung und Funktion der Maschinenteile häuflg im
Vordergrund, und die Berechnung wird durch reiches Zahlenmaterial und viele Zahlen
beispiele erläutert.
Durch die jedem Abschnitt vorangestellten wichtigsten Normen soli der Leser angeregt
werden, sich mit den Original-DIN-Normblättern vertraut zu machen. Eine schnelle
Unterrichtung über die wichtigsten Normen gestattet das vom DIN Deutsches Institut für
Normung e. V. herausgegebene Buch: Klein "Einführung in die DIN-Normen". Wegen
des Einflusses der HersteIlverfahren auf die Konstruktion der Maschinenteile wurden,
soweit im Rahmen des vorliegenden Werkes mäglich, werkstoff- und fertigungsgerechtes
Gestalten mit behandelt.
Für eine leichtere Aus\\crtung beider Teile wurden "Arbeitsblätter" als Anhang ge
sondert beigefügt (s. a. "Hinweise fLir die Benutzung des Werk es" auf S. VIII). Die Ar
beitsblätter enthalten den wesentlichen Stoff in knapper übersichtlicher Darstellung als
Gleichungen in Tafeln oder als Bilder. Die Zusammenstellung der Gleichungen ent
spricht im allgemeinen dem Ablauf der Berechnung und Auslegung von Bauelementen.
Es beflnden sich im Lehrbuchteil keine Tafeln, so daf3 das Lesen nicht beeinträchtigt
werden kann. Nachdem sich der Leser an Hand des Lehrbuches und, wenn zur leichteren
IV Vorwort
Bewältigung des Stoffes notwendig, daneben an Hand des Arbeitsblattes über den Rech
nungsgang der einzelnen Maschinenteile klargeworden ist, kann er die Arbeitsblätter -
beispielsweise bei den Entwurfsübungen am Zeichenbrett usw. - für sich benutzen.
Dabei sind diese für eine rezeptmäf3ige Anwendung von Formeln ohne Kenntnis der
inneren Zusammenhänge nicht auswertbar. Sie sollen dem den Stoff beherrschenden Leser
lediglich als Gedächtnisstütze dienen, den Auslegungs- bzw. Berechnungsfluf3 aufzeigen
und das erforderliche Zahlenmaterial übersichtlich darbieten. Sie können von den Stu
dierenden auch zur Wiederholung oder als Formelnachschlagewerk benutzt werden.
Als zweckmäf3ig und vorteilhaft haben sich die Arbeitsblätter ins bes on de re auch bei der
Betreuung von Studien- und Jngenieurarbeiten durch rasches Aufzeigen des Problems
bewährt.
Die sechste Auflage wurde unter Berücksichtigung einer Reihe von Wünschen aus den
Kreisen der Leser und unter Beachtung der technischen Entwicklung der letzten Zeit
überarbeitet und erweitert. Die Normenangaben wurden auf den zur Zeit gültigen Stand
gebracht.
Die Umstellung der Einheiten auf das internationale, gesetzlich eingeführte SI-System
erfolgte bereits in der fünften Auflage. Weil es auch jetzt noch notwendig ist, neben den
Sl-Einheiten die in der Vergangenheit gebräuchlichen Einheiten zu kennen (z. B. zum
Lesen von älterer Literatur), sind Umrechnungsbeziehungen auf Seite VIII angegeben.
Die Formelzeichen wurden im wesentlichen nach DIN 1304 gewählt.
Urn eine Einheitlichkeit der Formelzeichen durch alle Abschnitte zu erzielen, muf3te von
manchen in den betreffenden Normblättern angeführten Bezeichnungen abgewichen wer
den. So wurden die Bezeichnungen für die Bruchfestigkeit, für die Streckgrenze
(JB (Js
und für die 0,2-Grenze beibehalten, jedoch die Bezeichnungen nach DIN 50145 in
(JO,2
den Tafeln für Festigkeitswerte in Klammern hinzugefügt, z. B. (Rm), (Re), (Rp). In eini
gen Normen z. B. für Zahnräder und in AD-Merkblättern wird für die Sicherheit das
Formelzeichen S gesetzt. Urn Verwechslungen auszuschlief3en, wurde daher in beiden
Teilen des Werkes im Gegensatz zu DIN 1304 die Ober-und Querschnittsfläche mit A und
die Sicherheit mit S bezeichnet.
Die Gleichungen sind meist als Gröf3engleichungen nach DIN 1313, also für frei wählbare
Einheiten geschrieben, in die die Zahlenwerte mit SI-Einheiten oder mit abgeleiteten SI
Einheiten eingesetzt werden können. Nur gelegentlich werden auch auf bestimmte Ein
heiten zugeschnittene Gröf3en- bzw. Zahlenwertgleichungen verwendet (s. Hinweis für die
Benutzung des Werkes auf S. VIII).
lch danke allen Lesern, die zur Verbesserung des Werkes beigetragen haben, wie auch
den Firmen, die Material zur Verfügung steIlten. Nicht zuletzt gebührt mein Dank den
Mitarbeitern, we1che keine Mühen urn die Weiterentwicklung ihrer Beiträge scheuten.
Verlag, Verfasser und Herausgeber würden sich freuen, auch weiterhin Anregung aus
den Kreisen der Benutzer zu erhalten.
Soest, im Frühjahr 1981 Joachim Pokorny
Inhalt
1. Einführung in das Konstruieren und Berechnen \'On \Iaschinenteilen (Pokorny)
1.1. Allgemeine Gesichtspunkte für das Konstruieren . . . I
1.2. Allgemeine Gesichtspunkte für das Berechnen . . . . . . . . . . . 7
1.3. Festigkeitsnachweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. 3.1. Ermitteln unbekannter Kräfte und Momente (Freimachen von BauteiIen) . 8
U.~.Anwendung der Festigkeitslehre. . . . .. ......... 14
1. 3.3. Anwendung des Dauerfestigkeitsdiagramms bei zusammengesetzter Bean-
spruchung 28
Literatur 29
2. Nietverbindllngen (Zelder)
2.1. Werkstoffe für Bauteiie und Niete 32
2.2. Nietherstellung, Nietformen, Nahtformen 33
2.2.1. Setzkopf, Schaft, SchiieBkopf 33
2.2.2. Warmnietung . 34
2.2.3. Kaltnietung 34
2.2.4. Nahtformen . . 35
2.3. Berechnungsgrundlagen 37
2.3.1. Berechnen von Nietverbindungen im Stahlbau 38
2.3.2. Nietverbindungen im Kessel- und Behälterbau. 47
2.3.3. Nietverbindungen im LeichtmetaIIbau 48
Literatur 50
3. Stoffschlüssige Verbindungen (Hägele)
3.1. SchweiBverbindungen . . . . . 51
3.1.1. Verfahren und Werkstoffe 52
3.1.2. Gestalten und Berechnen von SchweiBverbindungen 54
3.1.3. Konstruktionshinweise . 70
3.1.4. Berechnungsbeispiele 73
Literatur 82
3.2. Lötverbindungen . . . . . 82
3.2.1. Technologie des Lötens 83
3.2.2. Berechnen und Gestalten. 84
Literatur 87
3.3. Klebverbindungen . . . . . . 88
3.3.1. Klebstoffe und Verfahren . 88
3.3.2. Berechnen und Gestalten. 90
Literatur 95
VI Inha1t
4. Reib-und formschlüssige Verbindungen (Schreiner)
4.1. Reibschlüssige Verbindungen 96
4.1.1. Aufgabe und Einteilung . . . 96
4.1.2. EinfluB der Oberflächengestalt 97
4.1.3. ReibungsschluB . . 98
4.1.4. Klemmverbindung. . 99
4.1.5. Kegelverbindung . . 100
4.1.6. Ringspannverbindung 101
4.1.7. PreB-und Schrumpfverbindungen . 103
4.1.8. Gestalten. . . . . . . 109
4.1.9. Fertigen . . . . . . . 111
4.2. FormschIüssige Verbindungen 112
4.2.1. Wirkungsweise . . . . 112
4.2.2. PaB-und Scheibenfeder, KeilweIIe, Kerbzahn-und Evolventenzahn-Profil . 113
4.2.3. Polygonprofil. . . . . 114
4.2.4. Gestalten und Fertigen 115
4.3. Keilverbindungen 117
4.3.1. Berechnen . 118
4.3.2. Gestalten. . 118
4.4. Bolzen und Stifte . 119
4.4.1. Aufgabe uod Bemessung . 119
4.4.2. Bolzen uod ZyIinderstifte 120
4.4.3. Kerbstifte und Spannhülsen 120
4.4.4. Gestalten und Werkstoff . 121
Literatur ......... 123
5. Schraubenverbindungen (Haage)
5.1. AIlgemeines • . . . . . 124
5.1.1. Gewindenormen 125
5.1.2. Gewindetolerierung 126
5.1.3. Schraubenwerkstoffe • 127
5.1.4. Schrauben-und MuUernarten 128
5.2. Kräfte in der Schraubenverbindung . 128
5.2.1. Kräfte im Gewinde . . 128
5.2.2. Anziehdrehmoment . . . 131
5.2.3. Verspannungsschaubild. . 132
5.2.4. Elastische Nachgiebigkeit. 133
5.2.5. Krafteinleitung . • . . . 135
5.2.6. Setzen der Schraubenverbindung 136
5.2.7. Selbsttätiges Lösen 138
5.3. Berechnen von Schrauben . . 139
5.3.1. Bemessungsgrundlagen . 139
5.3.2. Rechnungsgang. . . . 143
5.4. Ausführungen von Schraubenverbindungen 146
5.5. Berechnungsbeispiele 149
Literatur 154
6. Fedem (Pokorny)
6.1. Entwicklung der Berechnungsgrundlagen 155
6.2. Bemessen und Gestalten der verschiedenen Bauformen 162
Inhalt VII
6.2.1. Metallfedern . 162
6.2.2. Gummifedern 174
Literatur . . . . . . . 177
7. Rohrleitungen und Armaturen (Hemmerling)
7.1. Aufgabe und Darstellung von Rohrleitungen . 178
7.2. Rohre ............. . 179
7.2.1. Berechnen von Rohrleitungen . 179
7.2.2. Rohrnormen . . . 183
7.2.3. Berechnungsbeispiel 186
7.3. Rohrverbindungen ... 187
7.3.1. SchweiBverbindung 187
7.3.2. Schraubverbindung für Gewinderohre 188
7.3.3. Muffenverbindung 188
7.3.4. Flanschverbindung . . . . 189
7.3.5. Verschraubung . . . . . . 190
7.4. Rohrleitungsschalter (Armaturen) 191
7.4.1. Hahn . 191
7.4.2. Ventil . 192
7.4.3. Schieber 196
7.4.4. Klappe . 197
Literatur 198
8. Dichtungen (Pokorny)
8.1. Aufgabe und Einteilung . 199
8.2. Dichtungen an ruhenden Maschinenteilen . . . . . . . . . 200
8.2.1. Unlösbare und bedingt lösbare Berührungsdichtungen . 200
8.2.2. Lösbare Berührungsdichtungen . . . . . . . 201
8.3. Berührungsdichtungen an bewegten Maschinenteilen. 204
8.3.1. Packungen . . . . . . . . . . . 205
8.3.2. Selbsttätige Berührungsdichtungen 208
8.4. Berührungsfreie Dichtungen . . . . . . 218
8.4.1. Strömungsdichtungen ..... . 218
8.4.2. Dichtungen mit Flüssigkeitssperrung . 221
8.4.3. Berührungsfreie Schutzdichtungen . 223
8.4.4. Membrandichtungen
223
Literatur 224
Sachverzeichnis 225
Beilage
Arbeitsblatt 1: Einführung in das Berechnen von Maschinenteilen Al
Arbeitsblatt 2: Nietverbindungen. . . . . . . . . . . . . . . A9
Arbeitsblatt 3: SchweiBverbindungen, Lötverbindungen, Klebverbindungen A16
Arbeitsblatt 4: Reib-und formschlüssige Verbindungen/Keilverbindungen/Bolzen u. Stifte A33
Arbeitsblatt 5: Schrauben . . . . . . . . . A52
Arbeitsblatt 6: Federn . . . . . . . . . . A67
Arbeitsblatt 7: Rohrleitungen und Armaturen A80
Arbeitsblatt 8: Dichtungen . . . . . . . . A85
VIII
Hinweise für die Benutzung des Werkes
1. Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt, werden Gröl3engleich ungen geschrieben (s. DIN
1313). In diesen Gleichungen bedeuten die Formelzeichen physikalische GröJ3en, also jeweils ein
Produkt aus Zahlenwert (Mal3zahl) und Einheit.
Hin und wieder werden Zahlenwertgleichungen benutzt. In solchen Gleichungen sind die
Formelzeichen als Zahlenwerte definiert, denen jedoch bestimmte Einheiten zugeordnet
sind.
Zur schnellen Orientierung über die Bedeutung eines Formelzeichens wird auf die den einzelnen
Arbeitsblättern vorangestellten Formelzeichenlisten verwiesen.
2. Angaben zum Internationalen Einheitensystem und Umrechnungsbeziehungen:
Masse: 1 kp s2/m = 9,81 kg
Kraft: 1 N = 1 kg m/s2 1 kp = 9,81 kg m/s2 = 9,81 N ~ 10 N
Die Gewichtskraft Fg, die auf den Körper der Masse m = 1 kg wirkt, beträgt:
F. = mg = 1 kg . 9,81 m/s2 = 9,81 N
Mechanische Spannung, Flächenpressung: 1 kp/mm2 = 9,81 N/mm2 ~ 10 N/mm2
Druck: 1 Pa = 1 N/m2 = 1 .10-5 bar 1 MPa = 1 N/mm2 = 1 MNJm2 = 10bar ~ 10kpJcm2
1 bar = 0,1 M Pa = 0,1 N/mm2
1 at = 1 kp/cm2 = 9,81 . 104 N/m2 = 0,981 bar ~ 1 bar
Arbeit: 1 J = 1 Nm = 1 Ws 1 kpm = 9,81 Nm ~ 10 Nm 1 kcal = 427 kpm = 4186,8 J
Leistung: 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s 1 kpm/s = 9,81 J/s = 9,81 W 1 PS = 75 kpm/s ~ 736 W
1 kW = 1,36 PS
Trägheitsmoment: 1 kpm S2 = 9,81 Nm S2 = 9,81 kg m2
Magnetische Flul3dichte: 1 T (Tesla) = 1 Vs/m2 = 1 Nm/(m2 A)
Dynamische Viskosität: 1 Pa s = 1 Ns/m2 = 1 kg/(ms) = 103 cP (Centipoise)
Kinematische Viskosität: 1 m2/s = 1 Pa s m3/kg = 104 St = 106 cSt (Centistokes)
3. Hinweise auf DIN-Normen in diesem Werk entsprechen dem Stande der Normung bei Ab
schluB des Manuskriptes. MaJ3gebend sind die jeweils neuesten Ausgaben der Normblätter des
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. im Format A 4, die durch die Beuth-Verlag GmbH,
Berlin und Köln, zu beziehen sind. - Sinngemäl3 gilt das gleiche für alle in diesem Buche er
wähnten amtlichen Bestimmungen, RichtIinien, Verordnungen usw.
1. Einführung in das Konstruieren und Berechnen von
Maschinenteilen *
DIN-Normen (Auswahl) [15]
Grundnormen des DIN Deutsches Institut für Normung e. V. und Empfehlungen des Aus
schusses für Einheiten und FormelgröBen (AEF)
NormmaBe und -zahlen DIN 3, 323
Einheiten, mathematische Zeichen, Winkeleinheiten,
Winkelteilungen 1301, 1302, 1315
Allgemeine Formelzeichen, Formelzeichen und Ein
heiten der technischen Thermodynamik, Zeichen
für Festigkeitsberechnungen, FormeIzeichen der
Mechanik 1304, 1345, 1350, 5497
Gewicht, Masse, Menge; Dichte 1305, 1306
Schreibweise physikalischer Gleichungen 1313
Druck; Normtemperatur, -druck, -zustand 1314,1343
Festigkeitsversuche, Werkstoffprüfung usw. 1602,1605,1781, 50010ff., 51000ff.
1.1. Allgemeine Gesichtspunkte für das Konstruieren
Maschinenteile sind Bauteile oder Bauteilgruppen, die bei verschiedenen Maschinen oder
Geräten jeweils gleiche oder ähnliche Aufgaben zu erfüllen haben und daher gleiche oder
ähnliche Konstruktionsmerkmale aufweisen.
Viele Maschinenteile, die im Laufe der Zeit vervollkommnet wurden und sich gut bewährt
haben, sind genormt und werden vom Konstrukteur übernommen. Jedoch müssen die
meisten Bauteile und ihre Zusammenstellung zu Bauteilgruppen ader zu grol3en Projek
ten einander optimal angepal3t und konstruiert werden.
Die ers ten Unterweisungen im Konstruieren erhält der Studierende im allgemeinen im
Lehrfach Maschinenteile (Maschinenelemente). Das Konstruieren umfal3t dàs optimale
Lösungen anstrebende Vorausdenken technischer Gebilde und Festiegen konkreter An
gaben zu ihrer Verwirklichung [25].
Heute versucht man, das Konstruieren von neuen Maschinenteilen oder ganzen Maschinen
und Anlagen mit Methode durchzuführen und überläBt das Finden van Lösungen nicht
mehr so sehr dem Zufall oder dem Einfall. Methodik schlieBt jedoch Intuition nicht aus,
im Gegenteil, sie regt diese an. Tntuition beruht ja u. a. auf der im Gehirn gespeicherten
Lösungssammlung, auf Erfahrung und allf gründlichen Fachkenntnissen, sowie allf Vor
stellungsgabe llnd Phantasie .
• Hierzu Arbeitsblatt 1, s. Beilage S. Al bis A9.