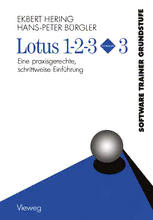Table Of ContentEkbert Hering
Hans-Peter Biirgler
Lotus '-2-3
Version 3
Eine praxisgerechte,
schrittweise Einfiihrung
Aus dem Bereich
-----------------------------------
~----Computerliteratur
Framework III - Das umfassende Anwenderbuch
von B. Harrison (Ein Ashton Tate/Vieweg-Buch)
Microsoft Project - EinfUhrung in die Anwendung
von H.-D. Lang
Chart 3.0 - Geschattsgrafiken auf dem PC
von E. Tiemeyer
Lotus 1-2-3
Eine praxisgerechte, schrittweise Einfuhrung
von E. Hering und H.-P. Burgler
Lotus Symphony Schritt fUr Schritt
von E. Hering und H.-P. Burgler
dBASE IV Programmierung fur betriebswirtschaftliche
Anwendungen
von R. A. Byers (Ein Ashton Tate/Vieweg-Buch)
dBASE IV - Schritt fur Schritt zum
professionellen Anwender
von R. A. Byers und C. Prague (Ein Ashton Tate/Vieweg-Buch)
------Vieweg ----------------------'
..
...
...
EKBERT HERING ~
HANS-PETER BORGLER I
Lotus 1-2-3 i
3
•
...
Eine proxisgerechte,
-
z
schrittweise Einfuhrung
c
•
...
...
•
;
..
...
o
ut
Friedr. Vieweg & Sohn Brounschweig/Wiesboden
1. Auflage 1987
2., liberarbeitete und aktualisierte Auflage 1989
Das in diesem Buch enthaltene Programm-Material ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgend
einer Art verbunden. Die Autoren und der Verlag iibernehmen infolgedessen keine Verantwortung und
werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung iibernehmen, die auf irgendeine Art aus der
Benutzung dieses Programm-Materials oder Teilen davon entsteht.
Der Verlag Vieweg ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann International.
Al1e Rechte vorbehalten
© Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesel1schaft mbH, Braunschweig 1989
Das Werk einschlieBlich al1er seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. J ede
Verwertung au~erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlags unzulassig und strafbar. Das gilt insbesondere fUr
Vervielfaltigungen, Obersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Schrimpf und Partner, Wiesbaden
ISBN-13: 978-3-528-14531-6 e-ISBN-13: 978-3-322-85878-8
DOl: 10.1007/978-3-322-85878-8
v
Inhaltsverzeichnis
v
Vorwort
1 Einftihrung....................................... .... .
1.1 Das Programmpaket 1-2-3 .............................. .
1.2 Hardwarevoraussetzungen ............................... 3
1.3 Installation von 1-2-3 .................................. 3
1.4 Bezeichnung der Dateinamen ............................. 19
1.5 Tastaturbelegung fur den IBM-PC .......................... 20
1.6 Starten von 1-2-3 ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
1. 7 Aufbau eines Arbeitsblattes .............................. 23
1.8 Arbeiten mit 1-2-3-Menus ............................... 27
1.9 Online-Hilfetexte..................................... 29
2 Erstellen und Bearbeiten eines Arbeitsblattes am Beispiel des
privaten Haushaltsplans. Der erste Schritt .................... 31
2.1 Eingabe der Texte .................................... 32
2.2 Korrektur der Texte ................................... , 34
2.3 Eingabe der Zahlen ................................... 39
2.4 Eingabe von Formeln .................................. 42
2.4.1 Eintippen der Zelladressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42
2.4.2 Formeleingabe durch Zeigen ........................ 43
2.4.3 Arten der Formeln ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48
2.5 Sichern des Arbeitsblattes ............................... 50
2.6 LOschen des Arbeitsblattes 51
2.7 Beenden einer 1-2-3-Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52
3 Dreidimensionale Arbeitsblatter erstellen und auswerten am
Beispiel der Entwicklung des Auftragsbestandes ............... 53
3.1 Eingabe der Zeilen-und Spaltenbezeichnungen (Text) ............ 54
2.3 Andern der Spaltenbreite ............................... 56
3.2.1 Andern der Spaltenbreite fUr eine Spalte ................ 57
3.2.2 Spaltenbreite generell einstellen ...................... 58
3.3 Justieren des Textes ................................... 59
3.4 Kopieren von Zellinhalten ............................... 60
3.5 Bereiche........................................... 63
3.6 Zahleneingabe....................................... 64
3.7 Rechnen mit der @Summe-Funktion ........................ 66
3.8 Formeln kopieren .................................... 70
VI Inhaltsverzeichnis
3.9 Relative, absolute und gemischte Zelladressierung ............... 72
3.9.1 Relative Adressierung ............................. 72
3.9.2 Absolute Adressierung ............................ 73
3.9.3 Gemischte Adressierung ........................... 74
3.10 Zahlen formatieren ................................... 76
3.10.1 Das Format Test ................................ 77
3.10.2 Das Prozentformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78
3.10.3 Das Format Wahrung ............................. 79
3.10.4 Das Format Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
3.11 Einftigen und Loschen von Zahlen und Spalten ................. 85
3.11.1 Einftigen von Zeilen .............................. 85
3.11.2 Loschen von Bereichen ............................ 87
3.12 Erstellen zusatzlicher Arbeitsblatter ........................ 88
3.13 Gleiches Format fUr alle Arbeitsblatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96
3.14 Kopieren zwischen den Arbeitsblattern ...................... 97
3.15 Konsolidierung der Arbeitsblatter .......................... 100
3.16 Erstellen eines zusammenfassenden Arbeitsblattes ............... 104
3.17 Erstellen eines Begleittextes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 118
3.18 Ausdrucken der gesamten Arbeitsblatter und Teilen daraus ......... 118
3.19 Speichern der Arbeitsblatter ............................. 121
4 Statistische Auswertung von Fertigungsdaten ................. 122
4.1 Bestimmung des durchschnittlichen Ausschusses mit der
Funktion @MITTELWERT() ............................ 124
4.2 Bestimmung des minimalen und maximalen Ausschusses mit
den Funktionen @MIN bzw. @MAX ........................ 127
4.3 Berechnung der statistischen KenngroBen Standardabweichung
undVarianz ........................................ 129
5 Zins-, Tilgungs- und Rentenrechnung mit Finanzfunktionen ...... 134
5.1 Zinsrechnung ....................................... 134
5.2 Tilgungsrechnung..................................... 139
5.3 Ren tenrechnung ..................................... 140
6 Investitionsrechnung mit Finanzfunktionen .................. 142
6.1 Abschreibungsarten ................................... 143
6.2 Kapitalwert, interner ZinsfluB und Amortisationsdauer als
Kennzahlen der dynamischen Investitionsrechnung .............. 149
6.2.1 Eingabe des Tabellengerlistes ........................ 150
6.2.2. Bestimmung des RUckflusses ........................ 151
6.2.3 Bestimmung des kumulierten Nettorlickflusses ............ 153
6.2.4 Berechnung des Kapitalwertes ....................... 155
6.2.5 Berechnung des internen Zinsflusses ................... 155
6.2.6 Berechnung der Amortisationsdauer ................... 156
Inhaltsverzeichnis VII
7 Datenbankbearbeitung am Beispiel einer Lagerverwaltung . . . . . . .. 158
7.1 Erstellen einer Datenbank ............................... 160
7.2 Formeleingabe ...................................... 162
7.3 Schiitzen von Bereichen ................................ 163
7.4 Eingabe von Datensatzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 165
7.5 Andern, Hinzufligen und Loschen von Datensatzen .............. 167
7.6 Datensatze sortieren nach einem Schliissel .................... 167
7.7 Sortieren nach 2 Schliisseln .............................. 170
7.8 Abfrage nach einfachem Kriterium ......................... 171
7.9 Anzeige der geuschten Artikel ............................ 176
7.10 Mehrfachkrtierien in einer Zeile ........................... 178
7.11 Mehrfachkriterien in mehreren Zeilen ....................... 180
7.12 Zusammengesetzte Kriterien ............................. 181
8 Datenbank und statistische Analyse am Beispiel der Auswertung
von Fertigungsdaten .................................... 184
8.1 Erfassen der Daten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 185
8.2 Automatische Numierung ............................... 187
8.3 Ermittlung der Summen ................................ 188
8.4 Eingabe der Daten .................................... 189
8.5 Sortieren nach dem Alter und nach dem GesamtausschuB .......... 189
8.6 Vergabe von Bereichsnamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191
8.7 Statistische Auswertung ................................ 195
8.7.1 Mittelwert des Ausschusses und des Maschinenalters
fUr alle Maschinen ............................... 195
8.7.2 Mittelwert des Ausschusses und des Maschinenalters fiir
Maschinen A und B .............................. 198
8.8 Erstellen einer Datentabelle mit einer Variablen . . . . . . . . . . . . . . . .. 199
8.9 Erstellen einer Datentabelle mit zwei Variablen ................. 202
8.10 Erfassen und Auswerten der AusschuBzahlen der nachsten
zwei Wochen in zwei getrennten Arbeitsblattern ................ 206
8.1 0.1 Einfligen von drei Arbeitsblattern B, C und D ............. 206
8.10.2 Kopieren des Arbeitsblattes A in die Arbeitsblatter
B, C und D .................................... 208
8.10.3 Loschen der kopierten Werte in den Arbeitsblattern
B bis D ...................................... 209
8.10.4 Eingeben des ermittelten Ausschusses flir die
Woche 25 (Blatt B) .............................. 210
8.10.5 Statistische Auswertung der Woche 25 .... . . . . . . . . . . . . .. 211
8.10.6 Statistische Auswertung der Woche 26 ................. , 216
8.11 Auswerten der Daten im Arbeitsblatt D ...................... 219
8.12 Abhangigkeit des Ausschusses vom Maschinenalter mit
den Dateien der drei Arbeitsblatter ......................... 223
VIII Inhaltsverzeichnis
9 Erstellen von Grafiken fUr eine Artikel-Umsatz-Statistik 225
9.1 Liniendiagramm ..................................... 230
9.2 Balkendiagramm ..................................... 239
9.3 Gestaffelte Balken .................................... 242
9.4 Kreisdiagramm ...................................... 244
9.5 XY-Diagramm....................................... 250
9.6 Aktien-Diagramm .................................... 252
9.7 Mischdiagramme ..................................... 255
9.8 Grafik neben Arbeitsblatt zeichnen ......................... 258
9.9 Verwalten von Grafiken ................................ 258
10 Datenaustausch mit anderen Programmen .................... 261
10.1 Direktes Einlesen der Dateien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 261
10.2 Umwandeln der Dateien ................................ 264
10.3 Erstellen von Textdateien zur Weiterverwendung in anderen
Programmen ........................................ 267
11 Ausgabe als weiterverwendbare Datei und tiber den Drucker . . . . .. 268
11.1 Vorbereitungen zum Ausdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 269
11.2 Erstellen einer ASCII-Datei .............................. 273
11.3 Erstellen einer Binardatei ............................... 275
11.4 Erstellen einer Druckdatei ............................... 272
11.4.1 M6glichkeiten des Ausdrucks ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 277
11.4.2 Beispiel eines Ausdrucks ........................... 279
11.4.3 Ausdruck der Grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280
11.4.4 Optionen zur Anderung des Ausdrucks ................. 281
12 Makros .............................................. 000
12.1 Erstellen eines einfachen Makros am Beispiel der Entwicklung
des Auftragsbestandes nach Kapitel 3 ....................... 290
12.1.1 Vorbereitung zur Erstellung von Makros . . . . . . . . . . . . . . . .. 291
12.1.2 Eingabe der Makros .............................. 292
12.1.3 Benennen des Makros ............................. 292
12.1.4 Ausftihren des Makros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 298
12.1.5 Befehlsfolge als Makro ............................ 299
12.1.6 Funktionen als Makro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 301
12.1.7 Makros automatisch erfassen ........................ 304
12.2 H6here Makrobefehle am Beispiel einer Zuschlagskalkulation ........ 309
12.2.1 Aufbau der Zuschlagskalkulation ..................... 312
12.2.1.1 Aufbau des Kalkulationsschemas ............... 314
12.2.1.2EingabederDaten ......................... 314
12.2.1.3 Durchftihrung der Berechnung ................. 315
Inhaltsverzeichnis IX
12.2.2 Aufbau des Makros .............................. 319
12.2.2.1 Makro des Kalkulationsschemas ................ 321
12.2.2.2 Makro der Kalkulation ...................... 324
12.2.2.3 Testen des Makros mit dem SCHRITT·Modus ....... 326
12.2.2.4 Programmieren mit den /X-Befehlen ............. 328
Anhang ................................................. 329
Datums-und Zeitfunktionen ................................. 329
Finanzfunktionen ........................................ 329
Logische Funktionen ...................................... 330
Mathematische Funktionen .................................. 331
Sonderfunktionen ........................................ 332
Statistische Funktionen 333
Statistische Datenbankfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 334
Zeichenfolgenfunktionen ................................... 335
Makrofunktionen und Makrobefehle ............................ 337
/X-Makrobefehle ......................................... 341
Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 342
x
Vorwort
Immer mehr Rechner werden an ArbeitspHitzen in Verwaltung, Wirt
schaft und bei Selbststandigen eingesetzt. Wenn auch die Hardwarepreise
zum Kauf eines Rechners verlocken, so wird es doch fUr viele Anwender
schwierig, ihre eigenen Probleme zu losen. Viele stehen vor der Frage, ob
sie eine der vielen Programmiersprachen erlernen soil ten oder fur teures
Geld ihre individuellen Probleme programmieren lassen mussen.
Das hier beschriebene Werkzeug Lotus 1-2-3 ist idealerweise dazu ge
eignet, ohne den Umweg uber das Beherrschen einer Programmiersprache
die eigenen Aufgaben schnell und effizient losen zu konnen. In 1-2-3
werden aile Aufgaben in einem elektronischen Arbeitsblatt, das in Spal
ten und Zeilen organisiert ist, erfal3t und mit Hilfe der Lotus 1-2-3-
Befehle gelOst. Aus diesem Grunde lassen sich aile Tabellenkalkulationen
bequem durchfuhren. Wichtig ist dabei die Moglichkeit, sehr schnell
Zahlenwerte andern zu konnen und per Knopfdruck das neue Ergebnis
zu erhalten. Die wichtige Frage: "Was passiert, wenn?" kann in Sekun
denschnelle beantwortet werden. In der vorliegenden Version 3 konnen
dreidimensionale Tabellen mit bis zu 256 Arbeitsblatter mit je 256 Spal
ten und 8192 Zeilen bearbeitet und verwaItet werden.
Foigende weitere wichtige Vorteile bietet Lotus 1-2-3:
1. Gra/ische Auswertung
Die Zahlenreihen in den Tabellen konnen zur besseren Anschauung
durch Drucken weniger Tasten in eine gewunschte Linien-, Balken- oder
Kreisgrafik umgewandelt werden. In der Version 3 sind noch die Mog
Iichkeiten hinzugekommen, Mischdiagramme (Linien- und Balkengrafi
ken) sowie Aktienverlaufsdiagramme und FHichendiagramme erstellen zu
konnen. Vor allem mit dem in Version 3 - ohne PrintGraph-Programm -
moglichen sofortigen Ausdruck der Grafiken in den gewunschten
Schriftarten und als Grafik direkt neben dem Arbeitsblatt kann das
Datenmaterial schnell und ansprechend prasentiert werden. Ebenfalls neu
ist die Moglichkeit, grafische Auswertungen automatisch, d. h. ohne Ein
gabe der grafisch auszuwertenden Daten, erstellen zu lassen.