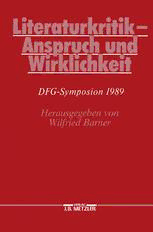Table Of ContentLITERATURKRITIK - ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT
GERMANISTISCHE SYMPOSIEN
BERICHTSBÄNDE
Im Auftrag der Germanistischen Kommission
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und in
Verbindung mit der »Deutschen Vierteljahrs
schrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte«
herausgegeben von
Albrecht Schöne
XII
Literaturkritik -
Anspruch und Wirklichkeit
DFG-Symposion 1989
Herausgegeben
von Wilfried Barner
1. B. Metzlersche
Verlagsbuchhandlung
Stuttgart
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Literaturkritik - Anspruch und Wirklichkeit:
DFG-Symposion 1989/ hrsg. von Wilfried Barner. - Stuttgart :
Metzler, 1990
(Germanistische-Symposien-Berichtsbände ; 12)
ISBN 978-3-476-00727-8
NE: Barner, Wilfried [Hrsg.); GT
ISBN 978-3-476-00727-8
ISBN 978-3-476-05557-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-05557-6
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer
tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset
zungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
© 1990 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprünglich erschienen bei J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung
und earl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 1990
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen des Herausgebers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IX
1. Tag: Literaturkritik als Institution
WILFRIED BARNER (Tübingen): Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
HERBERT JAUMANN (Bielefeld): Das Modell der Literaturkritik in der
frühen Neuzeit: Zu seiner Etablierung und Legitimation. . . . . . . . . 8
HANs-GEORG WERNER (Halle a. d. Saale): Selbstdenken und Mitfühlen.
Zu Eigenart und Rang der Literaturkritik Lessings ..... . . . . . . . 24
VOLKER RIEDEL (Berlin/DDR): Literaturkritik und klassische Philologie
bei Lessing ..................................... 38
SEBASTIAN NEUMEISTER (Berlin): Lyrik statt Klassik. Anmerkungen zur
Entstehung der modernen Literaturkritik in der italienischen und
französischen Romantik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GÜNTER OESTERLE (Gießen): »Kunstwerk der Kritik« oder >>vorübung
zur Geschichtsschreibung«? Form-und Funktionswandel der Charak-
teristik in Romantik und Vormärz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
GERT MATTENKLoTT (Marburg): Literarische Kritik im Kontext deut-
scher Judaica (1895-1933): Moritz Heimann und Efraim Frisch .... 87
W ALTER HINCK (Köln): Kommunikationsweisen gegenwärtiger Litera-
turkritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
GEORG BRAUNGART (Tübingen): Diskussionsbericht ............. 108
2. Tag: Literaturkritik als >Literatur<
HANS ULRICH GUMBRECHT (Stanford): Einführung ............ " 122
EBERHARD LÄMMERT (Berlin): Literaturkritik - Praxis der Literaturwis-
senschaft? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129
MATTHIAS LUSERKE (Saarbrücken): Adam Müllers Begriff der vermit-
telnden Kritik von 1806 als Wendepunkt in der Geschichte der deut-
schen Literaturkritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140
GERHARD R. KAISER (Gießen): »Durch solche Mittelgläser bricht sich im
letzten leicht das Licht zur Nacht.« Jean Pauls Rezension zu Mme de
Staels »De I'Allemagne« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 155
VI Inhaltsverzeichnis
HARTMUT STEINECKE (Paderborn): »Unsre neueste Erfindung: eine pro
ductive Kritik«. Thesen und Materialien zur Diskussion um Kritik als
Literatur bei den Jungdeutschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175
KARLHEINz STIERLE (Konstanz): L'homme et l'reuvre. Sainte-Beuves Li-
teraturkritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 185
DIRK GörrscHE (Münster i. W.): Liebeserklärungen und Verletzungen-
zur Literaturkritik von Martin Walser und Ingeborg Bachmann .... 197
NIKOLINA BURNEvA (Veliko Tärnovo): Literaturkritik und Fiktion in
Christa Wolfs Prosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 213
BENNo WAGNER-PITZ (Siegen): Diskussionsbericht . . . . . . . . . . . . .. 221
3. Tag: Literaturkritik und philosophische Ästhetik
RÜDIGER BUBNER (Tübingen): Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 231
HEINRICH NIEHUES-PRÖBSTING (Münster i. W.): Über den Zusammen-
hang von Rhetorik, Kritik und Ästhetik . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 237
CARSTEN ZELLE (Siegen): Schönheit und Schrecken. Zur Dichotomie
des Schönen und Erhabenen in der Ästhetik des achtzehnten Jahr-
hunderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 252
JENS KULENKAMPFF (Duisburg): Zum Begriff der Kunstkritik ....... 271
JÜRGEN SÖRING (Neuchätel): Das ästhetische Syndrom - Diagnose und
Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 286
FRIEDRIcH VOLLHARDT (Hamburg): Literaturkritik und philosophische
Ästhetik an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: Problemkon-
stellationen im Frühwerk von Georg Lukacs (1910-1918) . . . . . . .. 302
HEINRICH KAULEN (Bonn): »Die Aufgabe des Kritikers«. Walter Benja-
mins Reflexionen zur Literaturkritik 1929-1931 . . . . . . . . . . . . .. 318
ANDREI CORBEA·HorSIE (Jassy): Der Literatur-Kritiker als Literaturkriti-
ker. Bemerkungen zu dem (doch) resignierten Adorno. . . . . . . . .. 337
CHRISTOPH MENKE-EGGERS (Konstanz): »Deconstruction and Criticism«
- Zweideutigkeiten eines Programms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 351
BIRGIT SANDKAuLEN-BocK (München): Diskussionsbericht . . . . . . . .. 367
4. Tag: Literaturkritisches Werten
RENATE VON HEYDEBRAND (München): Einführung. . . . . . . . . . . . .. 383
MARTIN SWALES (London): Der Moraltrompeter von Cambridge? Zu F.
R. Leavis ...................................... 391
ürro LORENz (Göttingen): Pro domo - der Schriftsteller als Kritiker. Zu
Peter Handkes Anfängen ............................ 399
THoMAs ANZ (München): Literaturkritisches Argumentationsverhalten;
Ansätze zu einer Analyse am Beispiel des Streits um Peter Handke
und Botho Strauß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 415
HARRO MÜLLER-MIcHAELs (Bochum): Didaktische Wertung - Ein Bei-
trag zur Praxis literarischen Urteilens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 431
Inhaltsverzeichnis VII
REINHOLD VIEHOFF (Siegen): Literaturkritik 1973 und 1988 - Aspekte
des literaturkritischen Wertewandels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 440
JÖRG DREWS (Bielefeld): Über den Einfluß von Buchkritiken in Zeitun-
gen auf den Verkauf belletristischer Titel in den achtziger Jahren . .. 460
HEINRICH VORMWEG (Köln): Literaturkritik ist keine Wissenschaft . . .. 474
ALBREcHT KoscHoRKE (München): Diskussionsbericht ........... 487
HANS ULRICH GUMBRECHT (Stanford): Bericht über die Schlußdiskussion 501
Personenregister ................................... 507
Vorbemerkungen
Unter dem Titel »Literaturkritik« fand vom 26. bis zum 29. September 1989 in
der Nähe von Marbach am Neckar (»Haus Steinheim«) ein internationales und
interdisziplinäres Symposion statt. Seine schriftlichen Vorlagen und die Haupt
linien der Diskussionen sind im vorliegenden Band dokumentiert. Die Reihe
der >Germanistischen Symposien<, zu denen die Konferenz gehörte, wird seit
mehr als anderthalb Jahrzehnten durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
gefördert. Einer Idee Albrecht Schönes folgend, ist sie vorzugsweise solchen
Gegenständen und Problemen gewidmet, die fächerübergreifendes Arbeiten
erfordern und für die eine diskussionsintensive Veranstaltungsform besondere
Impulse verspricht.
Literaturkritik - ein >germanistisches< Thema? Überhaupt eines, zu dem sich
gemeinsame wissenschaftliche Grundlagen formulieren lassen? Die Erfor
schung der Literaturkritik, ihrer Prinzipien wie ihrer historischen Entwicklung,
gehört nicht gerade zu den glanzvollen Kapiteln in der Geschichte der Litera
turwissenschaften, zum al in Deutschland. Über Literaturkritik ist seit ihrem
Bestehen gestritten worden. In ihrem Teilbereich >Rezensionswesen< beschäf
tigt sie die meisten derer, die sich für Literatur interessieren und am >literari
schen Leben< teilnehmen. Aktuelle Streitfälle mit ihren Intrigen, Subjektivis
men und Machtmißbräuchen lassen immer wieder an ihrer Seriosität, ja an
ihrer Existenzberechtigung zweifeln. Sie hat als Institution alle ihre Krisen
überlebt, auch alle Prinzipiendiskussionen, wie sie von Zeit zu Zeit auszubre
chen pflegen. Seit Ende der 60er Jahre sind sie Gegenstand immer neuer Sam
melbände und Themenhefte.
Das Funktionale, oft Taggebundene hat Literaturkritik nicht zu den >großen<
Themen der Literaturwissenschaft aufsteigen lassen. Die Gipfelgestalten wie
Lessing oder Friedrich Schlegel sind gewiß oft gewürdigt. Seit etwa zwei Jahr
zehnten haben auch unsere Kenntnisse über historische Teilfelder und über
einzelne bedeutende Kritiker - oft ohnehin schon prominente Autoren der
Literaturgeschichte - merklich zugenommen. Es existieren mehrere Versuche
des monographischen Überblicks. Aber gerade sie lassen bei näherem Zusehen
die großen Lücken unseres Wissens erkennen.
Hinzu treten begriffliche Komplikationen und Konfusionen. Der deutsche
Terminus >Literaturkritik< ist bekanntermaßen erheblich enger als etwa >lite
rary criticism< im amerikanischen Gebrauch, der >Literaturwissenschaft< ein
schließt. Man hat dies nicht selten als Symptom für die relative Abschottung
der deutschen Literaturwissenschaft gegen die aktuelle, öffentliche Auseinan-
X Vorbemerkungen
dersetzung über Literatur gedeutet. Auch wenn im einzelnen mancher Versuch
zur Öffnung unternommen wurde, etwa durch Beteiligung von immer mehr
Zunftkollegen am Feuilleton: Spezialisierung und terminologische Hermetisie
rung großer Teile der fachwissenschaftlichen Produktion selbst haben den Gra
ben zugleich verbreitert. Und mit den elektronischen Massenmedien steht die
Kommunikation über Literatur vor strukturellen Umschichtungen, die noch
kaum präzise faßbar, geschweige denn wissenschaftlich analysiert sind.
Schon bisher konnte es mit Gründen zweifelhaft sein, etwa Friedrich Schle
gels >Kritik<, als höchste Form der Poesie, zusammen mit der Buchbespre
chung in einem Lokalblatt unter den gleichen weiten Begriff der >Literaturkri
tik< zu subsumieren. Soll nun auch noch die literarische Talkshow im Fernse
hen darunter fallen? Und die Phänomene scheinen noch weiter auseinanderzu
driften, wenn man sie zu den avancierten Ästhetik-Diskussionen unseres Jahr
hunderts, von Benjamin über Adorno bis zur >Postmoderne<-Welle, in Bezie
hung setzt.
Ein Versuch scheint an der Zeit, sowohl über den Status historischer Modell
untersuchungen als auch über aktuelle Prinzipiendebatten in eine Bestandsauf
nahme anhand überschaubarer Teilfelder einzutreten. Die deutschen Verhält
nisse können dabei im Zentrum stehen, jedoch den Blick zugleich, in kontra
stiv präzisierender Absicht, zu romanischen und angelsächsischen Ländern hin
öffnen. Die philosophische Ästhetik indes, in ihren historischen Ausformun
gen, hält die Kardinalfrage im Bewußtsein, inwiefern von >Kritik< prinzipiell
und in den geschichtlichen Stufen überhaupt die Rede sein könne.
Unter diesen Prämissen haben sich im Auftrag der Senatskommission für
germanistische Forschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft vier Kolle
gen, Renate von Heydebrand, Rüdiger Bubner, Hans Ulrich Gumbrecht und
der Unterzeichnete zusammengetan. Entsprechend dem für die >Germanisti
schen Symposien< geltenden Regelwerk haben sie einen Ausschreibungstext
formuliert, der im Dezember 1987 sowie in den ersten Monaten des Jahres
1988 in einer Reihe wissenschaftlicher Zeitschriften des In- und Auslandes er
schien.
Die wesentlichen Partien seien hier noch einmal wiedergegeben, zugleich als
inhaltliche und organisatorische Detaillierung des Unternehmens:
»Über die Legitimität der Literaturkritik, über ihre Pflichten wie über ihre
tatsächlichen Wirkungen und Funktionen wird gestritten, seit es Literaturkritik
gibt. Kaum eine andere Institution des literarischen Lebens erregt derart >par
teiisches< Interesse. Speziell für Deutschland ist die Tendenz zur Trennung von
der >zünftigen< Literaturwissenschaft oft festgestellt und beklagt worden. Sie ist
der Erforschung der Literaturkritik, ihrer geschichtlichen Erscheinungen und
ihrer theoretischen Grundlagen, nicht günstig gewesen. Die heftigen, meist
ganz auf die Gegenwart gerichteten Normdebatten der 60er und 70er Jahre
haben diese Situation ebensowenig verändert wie etwa der zunehmende Trend
zur professoralen Zeitungsrezension.
Vereinzelte neuere Fallstudien und historische Überblicke lassen erkennen,
daß die Zwischenposition der Literaturkritik, nicht als Defizit, sondern als