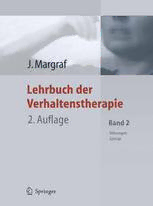Table Of ContentMargraf (Hrsg.): Lehrbuch der Verhaltenstherapie, 2. Auflage
Band 2: Störungen - Glossar
Jürgen Margraf
(Hrsg.)
Lehrbuch
der Verhaltenstherapie
Band 2:
Störungen - Glossar
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Mit 51 Abbildungen und 31 Tabellen
~ Springer
Prof. Dr. Jü rgen Margraf
Klinische Psychologie und Psychotherapie
Psychologisches Institut der Universität Basel
und Psychiatrische Universitätsklinik Basel
Wilhelm-Klein-Str.27
4025 Basel, Schweiz
Nachdruck 2005
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlieh geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung,
des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfil
mung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben,
auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses
Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätz
lich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
springer.de
ISBN 978-3-662-08349-9 ISBN 978-3-662-08348-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-08348-2
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996, 2000
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2000.
Softcover reprint ofthe hardcover 2nd edition 2000
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Ge
währ übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer
Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Planung: Renate Scheddin
Projektmanagement: Renate SchuIz
Design: deblik, Berlin
SPIN 11376040
Satz: K+V Fotosatz GmbH, Beerfelden
Gedruckt auf säurefreiem Papier 26/3160/SR - 5 4 3
Vorwort zur 2. Auflage
Im Vorwort zur ersten Auflage des Lehrbuchs der Ich danke den Autorinnen und Autoren der
Verhaltenstherapie hatte ich bekannt, daß mir die zweiten Auflage für ihre enorme Arbeit, für die
ses Projekt besonders am Herzen liegt. Um so Übernahme auch »schwieriger« Themen und für
mehr hat mich die positive Aufnahme des Buches z. T. zeitraubende Überarbeitungen. Ich danke
bei Lesern und Kritikern gefreut, die sich an auch den Lesern und Kritikern, die wertvolle An
einer großen Zahl positiver Buchbesprechungen regungen für die Neuauflage beisteuerten. Weiter
und an der Notwendigkeit mehrerer Nachdrucke hin bedanke ich mich bei Kerstin Raum von der
in kurzen Abständen ablesen ließ. Einfache Nach Universität Dresden und bei den Mitarbeiterinnen
drucke können jedoch nicht der raschen Weiter des Springer-Verlags. Und schließlich gilt mein
entwicklung gerecht werden, die die Verhaltens ganz besonderer Dank wieder meiner Frau Silvia
therapie noch immer - oder sogar mehr denn je Schneider für ihre ebenso unermüdliche wie unei
- auszeichnet. gennützige Unterstützung.
Die Tatsache, daß bereits nach so kurzer Zeit Es ist mir ein besonderes Anliegen, daran zu
eine erweiterte und aktualisierte Neuauflage erfor erinnern, daß seit dem Erscheinen der ersten Auf
derlich wurde, kann auch als Beleg für die These lage im Jahre 1996 mit Irmela Florin und Johan
von der besonders intensiven Fortentwicklung der nes C. Brengelmann zwei Personen verstorben
Verhaltenstherapie gewertet werden. Die vorlie sind, denen die Verhaltenstherapie im deutsch
gende zweite Auflage erweitert das Lehrbuch da sprachigen Raum und darüber hinaus ganz We
her um eine ganze Reihe wichtiger Themen, ohne sentliches zu verdanken hat. Ihrem Andenken
jedoch die nach meiner Meinung bewährte möchte ich die Neuauflage des Lehrbuches der
Grundstruktur der ersten Auflage zu verändern. Verhaltenstherapie widmen.
Gleichzeitig wurden die bereits vorhandenen Ka
pitel wo immer erforderlich ergänzt und aktuali Jürgen Margraf
siert. Basel, im Sommer 1999
Vorwort zur 1. Auflage
eine Gruppe von Experten aus dem deutschspra
Lehrbuch der Verhaltenstherapie - warum?
chigen und internationalen Raum als Autoren ge
wonnen. Die der großen Autorenzahl innewohnen
Die Verhaltenstherapie befindet sich in ständiger
de Vielfalt kann eine Stärke, aber auch ein Problem
Weiterentwicklung. Während sich Anfang der
darstellen. Durch Vorgabe gemeinsamer Richtlinien
60er Jahre noch mancher fragte, ob denn über
und intensive Bearbeitung haben Herausgeber und
haupt genügend Substanz für eigene Zeitschriften
Verlag versucht zu erreichen, daß sich vor allem die
oder Handbücher vorhanden sei, ist heute die
positiven Seiten der Vielfalt auswirken. Der beacht
Informationsflut kaum noch zu übersehen. Mittler
liche Umfang des zweibändigen Lehrbuches geht
weile ist die Verhaltenstherapie die am besten abge
dabei sowohl auf die große Differenziertheit der
sicherte Form von Psychotherapie; bei vielen
Verhaltens therapie als auch auf den Wunsch zu
Störungen ist sie die Methode der Wahl. Aber den
rück, die Beiträge hinreichend konkret für die
noch wird kompetente Verhaltenstherapie noch
praktische Umsetzung zu gestalten. Auch wenn
immer zu selten angeboten, fehlt eine angemes
dies manchmal schwerer als erwartet war, hoffe
sene gesetzliche Regelung psychologischer Psycho
ich doch, daß wir uns unserem Anspruch wenig
therapie und sind Patienten, Fachleute und Admi
stens angenähert haben. Dabei machte der Um
nistrationen unzureichend informiert. Gleichzeitig
fang auch Einschränkungen notwendig. So wurde
erfordert aber die wachsende Bedeutung der Ver
der große Bereich der Verhaltensmedizin vollstän
haltenstherapie in Versorgung, Ausbildung und
dig ausgeklammert, da hierfür eigene ausführliche
Forschung bei immer mehr Menschen einen adä
Darstellungen vorliegen.
quaten Überblick.
Die Differenziertheit der Verhaltenstherapie
stellt hohe theoretische und praktische Ansprüche
an diejenigen, die sie ausüben. Ihre kompetente
Anwendung setzt daher eine fundierte Ausbildung Warum der Begriff »Verhaltenstherapie«?
voraus. Diese muß nicht nur Grundlagenwissen
aus der Psychologie und ihren Nachbardiszipli
Die meisten Psychotherapeuten betrachten sich
nen, sondern auch klinisch-psychologisches Stö
als Eklektiker, und der Wunsch nach einer
rungs- und Veränderungswissen sowie hinrei
Überwindung des Schulenstreites und dem Auf
chend konkrete Anwendungsfertigkeiten vermit
bau einer »allgemeinen Psychotherapie« ist weit
teln. Wenngleich kein Lehrbuch alle diese Punkte
verbreitet. Warum also nicht ein Lehrbuch der all
umfassend abdecken kann, so wird doch die Auf
gemeinen Psychotherapie? Aussagen zu einer all
bereitung des Wissensstandes in einem praxis
gemeinen Psychotherapie können leicht auf einem
orientierten Lehrbuch einen Beitrag zur besseren
so hohen Abstraktionsniveau liegen, daß sie kaum
Verfügbarkeit leisten, so daß mehr Menschen von
noch konkrete Inhalte aufweisen. Zudem erscheint
den in der verhaltenstherapeutischen Forschung
es mir nicht sinnvoll, eine nur oberflächliche Ge
erzielten Fortschritten profitieren können.
meinsamkeit vorzugeben. üb die breite psycho
therapeutische Grundorientierung, die die Verhal
tenstherapie heute ist, einmal mit anderen Ansät
zen zu einer »allgemeinen Psychotherapie« zu
Warum in dieser Form? sammenwachsen wird, ist nicht absehbar. Fraglich
ist auch, ob der Psychotherapie - anders als ande
Da die Verhaltenstherapie heute von keinem Einzel ren Wissenschaften - jemals der große Wurf einer
nen mehr im Detail überblickt werden kann, wurde »allgemeinen« Theorie gelingen kann (man denke
VIII Vorwort
nur an die Physik). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hen. Das Lehrbuch wurde nicht in erster Linie für
sind die psychotherapeutischen Grundorientierun Patienten und ihre Angehörigen geschrieben. Bü
gen jedenfalls zu unterschiedlich, als daß sie pro cher reichen als Therapie meist nicht aus, sie kön
blemlos zusammengeführt werden könnten. Dar nen aber sehr wohl über Therapie informieren. Sol
über hinaus sind Konkurrenz und gegenseitige Kri che Informationen können nützliche Entschei
tik ein wichtiger Entwicklungsantrieb, wie nicht zu dungsgrundlagen sein. Für den knappen Über
letzt die Geschichte der Verhaltenstherapie zeigt. blick stehen im deutschsprachigen Raum mehrere
Als genuin psychologischer Heilkundeansatz populärwissenschaftliche Bücher zur Verfügung.
könnte die Verhaltenstherapie mit besonderem Wenn jedoch Umfang, Preis oder Fachsprache
Recht als psychologische Behandlung oder (in po nicht abschrecken, spricht auch nichts gegen die
tentiell gesetzeskonformer Sprache) als psychologi Lektüre eines Lehrbuches. Sollte eine Behandlung
sche Psychotherapie bezeichnet werden. Anderer angebracht sein, wird es in der Regel aber sinnvoll
seits hat sich Verhaltenstherapie als Begriff einge sein, die schriftlichen Informationen noch einmal
bürgert, ist quasi ein »Markenbegriff« geworden, persönlich mit Therapeut oder Therapeutin zu be
unter dem sich immer mehr Menschen etwas vor sprechen.
stellen können. Der Begriff und die ihm innewoh
nende Tradition sollte daher nicht leichtfertig auf
gegeben werden. Auch eine genauere Festlegung ei
ner bestimmten Ausrichtung (z.B. »kognitive Ver
Aufbau und Gestaltung des Lehrbuches
haltenstherapie«) erscheint mir für ein umfassen
des Lehrbuch wenig sinnvoll. Verhaltenstherapeu
tische und kognitive Verfahren sind Teile einer ge Das Lehrbuch besteht aus zwei einander ergän
meinsamen Grundströmung, deren wichtigste ge zenden Bänden, die in fünf große Bereiche und
meinsame Klammer die Fundierung in der empiri einen Anhang untergliedert sind. Die Inhaltsberei
schen Psychologie ist. Folgerichtig wird in Studium che umfassen Grundlagen, Diagnostik, störungs
und postgradualen Ausbildungsgängen zwischen übergreifende Verfahren und Rahmenbedingun
kognitiven und verhaltensorientierten Methoden gen (Band 1) sowie das störungsspezifische Vor
nicht stärker unterschieden als innerhalb der Grup gehen (Band 2). Die praktische Arbeit mit dem
pe der kognitiven oder der verhaltens orientierten Lehrbuch soll durch ausführliche Sachwort- und
Verfahren. Deshalb wird im vorliegenden Lehr Autorenregister sowie ein umfassendes Glossar er
buch darauf verzichtet, eine neuere oder »moder leichtert werden. Die Methoden- und Störungska
nere« Form begrifflich abzugrenzen. Allerdings pitel folgen einheitlichen Gliederungen, die im
muß die Auffassung von Verhaltenstherapie, die folgenden Kasten dargestellt sind. Da jede Regel
dem Lehrbuch zugrundeliegt, explizit kenntlich ge schädlich werden kann, wenn sie zu dogmatisch
macht werden. Dies geschieht ausführlich in dem ausgelegt wird, konnten die Autoren aber im Ein
einleitenden Kapitel »Grundprinzipien«. zelfall von diesen Vorgaben abweichen.
Aufbau der Verfahrenskapitel
An wen wendet sich das Lehrbuch? 1. Darstellung der Methode
2. Anwendungsbereiche
3. Alternativen und ggf. Fortentwicklungen
Das Lehrbuch wendet sich vor allem an Studenten,
4. Literatur
Ausbildungskandidaten, Praktiker und Forscher
5. Weiterführende Literatur
aus den Bereichen klinische Psychologie, Psychia
trie und Psychotherapie sowie deren Nachbardiszi
Aufbau der Störungskapitel
plinen. Darüber hinaus sollen auch Interessenten
aus Gesundheits- und Erziehungswesen, Kostenträ 1. Darstellung der Störung
gern, Verwaltung und Politik angesprochen wer 2. Kognitiv-verhaltenstheoretisches Störungs-
den. Die einzelnen Kapitel sollen möglichst auch konzept
ohne Bezug auf den Rest des Buches verständlich 3. Therapeutisches Vorgehen
sein, was natürlich manchmal auf Grenzen stößt. 4. Fallbeispiel
Weiterführende Literaturempfehlungen, ein aus 5. Empirische Belege
führliches Glossar und ein praktischer Anhang 6. Literatur
(mit Informationen z.B. zu Fachgesellschaften, 7. Weiterführende Literatur
Fachzeitschriften etc.) sollen die Nutzbarkeit erhö-
Vorwort IX
Zwei Bemerkungen zur Terminologie:
Danksagungen
• Es gibt verschiedene Wege, das Problem unan
gemessener geschlechtsspezifischer Begrifflich
keiten anzugehen. Am wenigsten geeignet er Ein Lehrbuch wie das vorliegende ist kein Ein
scheinen mir Doppelnennungen, Schrägstrich Personen-Projekt, sondern erfordert umfangreiche
lösungen oder das große »I«, Sofern die Ge Unterstützung, die ich hiermit anerkennen und
schlechtszugehörigkeit keine spezielle Rolle für die ich mich bedanken möchte. Dank gilt in
spielt, werden im vorliegenden Lehrbuch Be erster Linie meiner Frau Silvia Schneider und
griffe wie Patient oder Therapeut grundsätzlich meinem Sohn Jonas, die mich lange Zeit über das
geschlechtsneutral verwandt, betreffen also normale Maß hinaus mit der Arbeit an dem Pro
stets beide Geschlechter. Abweichungen von jekt teilen mußten. Anerkennen möchte ich ganz
dieser Regel werden explizit vermerkt. besonders die vielfältigen fachlichen Ratschläge
• Dem in der Medizin etablierten Patientenbe meiner Frau. Dank und Anerkennung schulde ich
griff wurde im Zuge der Kritik am »medizini auch den Mitarbeitern der Abt. Klinische Psycho
schen Modell«" vorgeworfen, er drücke ein Ab logie und Psychotherapie an der TU Dresden so
hängigkeitsverhältnis aus und entspreche nicht wie des Dresdner Institutes der Christoph-Dor
dem Ideal des aufgeklärten, mündigen Partners nier-Stiftung für Klinische Psychologie. Die orga
in der therapeutischen Beziehung. Als Alterna nisatorische Koordination des Projektes wurde
tive wurde mancherorts der Klientenbegriff von Kerstin Raum in beeindruckender Weise be
vorgeschlagen, der frei von den genannten Be wältigt. Frank Jacobi leistete wertvolle Arbeit bei
deutungen sein sollte. Aufschlußreich ist hier der Übersetzung und Bearbeitung vor allem der
die Wortgeschichte [vgl. Kluge: Etymologisches englischsprachigen Manuskripte. Klaus Dilcher
Wörterbuch der deutschen Sprache (22. Aufl.). und Juliane Junge waren als studentische Hilfs
Berlin: De Gruyter, 1989]. »Patient« bedeutet kräfte eine große Stütze. Heiko Mühler gab kom
wortwörtlich »Leidender«. Im 16. Jahrhundert petente Hilfe bei der zeitraubenden Bearbeitung
wurde der Begriff aus dem lateinischen »pa des Glossars. Sehr herzlich möchte ich mich bei
tiens« (duldend, leidend) gebildet, um kranke den Autoren der Kapitel bedanken, die manchmal
oder pflegebedürftige Personen zu bezeichnen. viel Geduld aufbrachten (wegen Anpassungen an
Ungefähr zur gleichen Zeit wurde »Klient« das Gesamtkonzept, langwierigen Überarbeitun
ebenfalls aus dem Latein entlehnt (von gen oder Zeitverzögerungen durch die unver
»diens«, älter »duens«). Die wörtliche Bedeu meidbaren Nachzügler). Meine Entschuldigung
tung dieses Begriffes lautet »Höriger« (abgelei gilt denjenigen, die die Terminvorgaben einhiel
tet vom altlateinischen Verb duere: hören). Kli ten, mein zusätzlicher Dank denen, die wegen
enten waren ursprünglich landlose und unselb Krankheiten oder anderer Unwägbarkeiten kurz
ständige Personen, die von einem Patron ab fristig »einsprangen«. Ihre Geduld ganz besonders
hängig waren. Dieses Abhängigkeitsverhältnis unter Beweis gestellt hat Heike Berger, die im
bedingte zwar gewisse Rechte (z.B. Rechts Springer-Verlag für die Realisierung des Projektes
schutz durch den Patron), vor allem aber eine verantwortlich war. Sie hat das Projekt in jeder
Vielzahl von Pflichten. Drei Gründe sprachen Phase seiner langen Entstehung ebenso kompetent
demnach für die Verwendung von »Patient« an wie engagiert unterstützt. Meine dankbare Aner
stelle von »Klient«: kennung gilt auch Stefanie Zöller und Bernd Stoll
(1) Die tatsächliche Bedeutung des Begriffs vom Springer-Verlag sowie dem sachkundigen
»Klient« widerspricht der erklärten Absicht Lektorat von Renate Schulz, Simone Ernst, Mi
seiner Einführung. riam Geissler und Regine Körkel-Hinkfoth. Alle
(2) Eine bloße terminologische Verschleierung zusammen haben wir den Patienten zu danken,
des teilweise realen »Machtgefälles« zwi deren aktive Mitarbeit in der Verhaltenstherapie
schen Behandelnden und Behandelten ist besonders wichtig ist.
wenig sinnvoll. Während mehrerer Jahre wurde der forscheri
(3) Der Begriff »Patient« beschreibt adäquat sche Teil meiner Beschäftigung mit der Verhal
das Leiden hilfesuchender Menschen. tenstherapie durch Sachbeihilfen und Personal
mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft un
terstützt (Aktenzeichen Ma 1116/1-1 bis 1-5, Ma
1116/4-1). Dies ermöglichte mir unter anderem
den Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe, die wäh
rend meiner Marburger Zeit zudem von der akti
ven, uneigennützigen Förderung durch meine da-
X Vorwort
malige Chefin Irmela Florin und vom Austausch rekten Niederschlag in Konzeption und Autoren
mit den dortigen Kollegen profitierte. Heute bietet schaft des Lehrbuches fanden. Um den fruchtba
mir die TU Dresden ein anregendes Umfeld, wo ren Austausch fortzusetzen, möchte ich ausdrück
bei der Aufbau der klinischen Psychologie und lich darum bitten, Rückmeldung oder Vorschläge
Psychotherapie der tatkräftigen und entschei an meine im Innenumschlag angegebene An
dungsstarken Unterstützung durch die Universität schrift zu schicken.
viel verdankt. Der Aufbau eigener verhaltensthe Das vorliegende Buch ist ein Projekt, das mir
rapeutischer Ambulanzen in Marburg und Dres besonders am Herzen liegt. Widmen möchte ich
den, die Zusammenarbeit mit psychosomatischen, es meinem Vater, einem ebenso rationalen wie
verhaltensmedizinischen und psychiatrischen Kli emotionalen Mann.
niken, der ständige Kontakt mit niedergelassenen
Kollegen und die regelmäßige Tätigkeit in der
psychotherapeutischen Fort- und Weiterbildung Jürgen Margraf
gaben ebenfalls wesentliche Impulse, die ihren di- Dresden, im Frühjahr 1996
Inhaltsverzeichnis
16 Raucherentwöhnung 299
Band 2
H. Unland
17 Schizophrenie 309
STÖRUNGEN
K. Hahlweg
1 Paniksyndrom und Agoraphobie 1 18 Partnerschafts- und Eheprobleme 337
J. Margraf, S. Schneider B. Schröder, K. Hahlweg
2 Spezifische Phobien 29 19 Sexuelle Störungen 349
L.-G. Öst G. Kockott
3 Sozialphobie 43 20 Dissoziative, vorgetäuschte
H. R. Juster, E. J. Brown, R. G. Heimberg und Impulskontrollstörungen 377
P. Fiedler
4 Zwangsstörungen 61
P. M. Salkovskis, A. Erde, J. Kirk 21 Persönlichkeitsstörungen 395
P. Fiedler
5 Generalisiertes Angstsyndrom 87
J. Turowsky, D. H. Barlow 22 Borderlinepersönlichkeitsstörungen 413
M. Bohus
6 Posttraumatische Belastungsstörungen 107
E. B. Foa, B. O. Rothbaum, A. Maercker 23 Psychische Störungen des Kindes-
und Jugendalters 437
7 Depression 123 S. Schneider
M. Hautzinger
24 Probleme bei Neugeborenen
8 Suizidalität 137 und Kleinkindern 463
A. Schmidtke, S. Schaller D. Wolke
9 Schlafstörungen 149 25 Kindlicher Autismus 481
R. R. Bootzin P. Rios
10 Hypochondrie und Gesundheitsangst 165 26 Stottern 493
P. Fiedler
P. M. Salkovskis, A. Erde
27 Geistige Behinderung 501
11 Somatisierungsstörung 189 J. Rojahn, G. Weber
W. Rief
28 Altersprobleme 517
12 Chronischer Schmerz 209 F. Karlbauer-Helgenberger, J. Zulley, P. Buttner
B. Kröner-Herwig
GLOSSAR 551
13 Eßstörungen 223
Anhang
R. G. Laessle, H. Wurmser, K. M. Pirke
Hinweise auf Fachgesellschaften und
14 Adipositas 247 Zeitschriften mit unmittelbarer
V. Pudel Bedeutung für die Verhaltenstherapie 639
Weiterbildungsinstitute 642
15 Schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit
Sachverzeichnis zu Band 2 645
von psychoaktiven Substanzen 269
G. Bühringer Namenverzeichnis zu Band 2 653