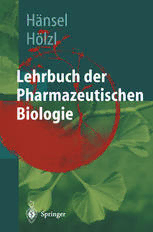Table Of ContentR. Hansel· J. Holzi (Hrsg.)
Lehrbuch der pharmazeutischen Biologie
Springer
Berlin
Heidelberg
New York
Barcelona
Budapest
Hongkong
London
Mailand
Paris
Santa Clara
Singapur
Tokio
Rudolf Hansel . Josef Holzl (Hrsg.)
Lehrbuch
der pharmazeutischen
Biologie
Ein Lehrbuch fur Studenten der Pharmazie
im zweiten Ausbildungsabschnitt
Beitrage von:
W. Ax, Th. Dingermann, R. Fescharek,
E. Graf, H. Haberlein, E. Teuscher
Mit 159 Abbildungen und 28 Tabellen
Springer
Dr. rer. nat. RudolfHiinsel
Universitlitsprofessor, emeritiert,
friiher Institut fUr Pharmakognosie und Phytochemie
der Freien Universitlit Berlin
Professor
Dr. rer. nat. Josef Holzl
Philipps-Universitlit MarburglLahn
Institut fiir Pharmazeutische Biologie
Deutschhausstra6e 171/2
35037 Marburg
ISBN-13:978-3-642-64628-7 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York
Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme
Lehrbuch der pharmazeutischen Biologie : ein Lehrbuch ftir
Studenten der Pharmazie im zweiten Ausbildungsabschnitt ;
mit 28 Tabellen / Rudolf Hilnsel ; Josef Holzl (Hrsg.). Beitr.
von: W. Ax ... -Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona;
Budapest; Hongkong ; London; Mailand ; Paris; Santa Clara
; Singapur; Tokio: Springer 1996
ISBN-13:978-3-642-64628-7 e-ISBN-J3:978-3-642-60958-9
DOI:IO.I007/978-3-642-60958-9
NE: Hansel, Rudolf [Hrsg.]: Ax, Wolfgang
Das Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der "Obersetzung, des
Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung
oder der Vervielfaltigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei
nur auszugsweiser Verwertung', vorbehalten. Eine Vervielfiiltigung dieses Werkes oder von Tellen dieses Werkes ist
auch im Einzelfall nur in Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrecbtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland vom 9. September 1965 in der jewells geltenden Fassung zulassig. Sie ist grundaatzlicb vergiitungs
pflicbtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1996
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berecbtigt aucb
ohne besondere Kennzeichnung nicbt zu der Annahme, daB solche Namen int Sinne der Warenzeicben- und
Markenscbutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann benutzt werden diirften.
Produkthaftung: Fiir Angaben iiber Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewahr
iibernommen werden. Derartige Angaben miissen vom jeweiligen Anwender int Einzelfall anhand anderer Literatur
stellen auf ihre Ricbtigkeit iiberpriift werden.
Herstellung: PRODUserv Springer Produktions-Gesellschaft, Berlin
Satz: Fotosatz-Service Kohler OHG, Wiirzburg
SPIN: 10019831 13/3020/5 43 2 1 0 -Gedruckt auf saurefreiem Papier
Vorwort
Die Approbationsordnung fur Apotheker von 1989 sieht eine Ausbildung im Fach
Pharmazeutische Biologie vor. Der Priifungsstoff des Zweiten Abschnittes der
Pharmazeutischen Priifung umfaBt: Herkunft, Anbau, Ziichtung, Gewinnung, Sta
bilisierung und Standardisierung der gebrauchlichen Arzneipflanzen und
Drogen sowie deren Erkennung, Reinheits- und Qualitatspriifung; makro
skopische, mikroskopische, chromatographische, chemische, chemisch-physika
lische und biologische Verfahren zur Untersuchung von gebrauchlichen Drogen,
Inhaltsstoffe pflanzlicher und tierischer Drogen einschlieBlich der Farbstoffe
und Aromen sowie die Isolierung und pharmazeutische Verwendung; Grundziige
der Biosynthese von Naturstoffen; Chemotaxonomie, Arzneimittel, Wirkstoffe
und Hilfsstoffe soweit sie aus oder mit Hilfe von lebenden Organismen gewon
nen werden; Gewinnung von Arzneimitteln aus und durch biotechnologische
Verfahren und entsprechende Produkte; Umwandlung von Stoffen; Wirkung
von Antibiotika; Resistenzprobleme. Kenntnis iiber Arzneimittel der besonde
ren Therapierichtungen, Phytopharmaka und Naturheilmittel; Grundziige der
Immunbiologie; Immunsera und Impfstoffe; Blutbestandteile; Blut-, Plasma-,
Serumkonserven; Blutersatzmittel.
Diese Lehrinhalte bilden kein zusammenhangendes, logisch oder methodisch
einheitliches Wissensgebiet. Die Pharmazeutische Biologie ist eine Querschnitts
wissenschaft mit Saugwurzeln in zahlreiche naturwissenschaftliche, medizinische
und technologische Teildisziplinen. Diese Heterogenitat der Lehrinhalte bringt es
mit sich, daB wohl an keiner Universitat der gesamte Priifungsstoff in gleicher
Breite gelehrt wird, vielmehr haben sich an den einzelnen Universitaten unter
schiedliche Unterrichtsschwerpunkte herausgebildet. An zahlreichen Universita
ten besteht der Schwerpunkt darin, Herkunft und chemische Zusammensetzung
pflanzlicher Arzneidrogen zu beschreiben sowie Basiswissen zur Untersuchung
von Drogen zu vermitteln. Diesem Lehrziel hat sich das bisher in 5 Auflagen
erschienene Lehrbuch der Pharmakognosie von Steinegger und Hansel verschrie
ben. In stark gekiirzter Fassung und neu iiberarbeitet wurde diese klassische
Drogenkunde in das vorliegende Lehrbuch iibernommen. Neu dabei ist: Das
Gerippe dieses Abschnitts ist in Form von "Kasten" herausgehoben und soH die
Priifungsvorbereitung erleichtern. Das Kernziel des vorliegenden neuen Lehr
buches aber ist es, moglichst aHe in' der Approbationsordnung aufgezahlten
Wissensgebiete abzuhandeln. Da wir der Auffassung sind, daB eine gute Lehre eine
gute Forschungsarbeit voraussetzt, haben wir als Verfasser fiir die Abschnitte
"Sondergebiete" Autoren gewonnen, die auf dem betreffenden Gebiet iiber For
schungserfahrung verfugen. Erstmalig in einem Lehrbuch der Pharmazeutischen
Biologie werden die Besonderen Therapierichtungen Homoopathie, Anthroposo
phie und Phytotherapie ausfiihrlich dargesteHt. Neu sind alle Abschnitte des Teiles
VI Vorwort
"Sondergebiete": Allgemeines iiber Arzneipflanzen und Drogen inklusive iiber
Anbau und Ziichtung von Arzneipflanzen, Antibiotika, Immunsystem, Impfstof
fe, Blut- und Plasmaprodukte, Gentechnologie sowie die bereits erwiihnten Ab
schnitte iiber die Besonderen Therapierichtungen. Wir mochten uns an dieser
Stelle bei allen Autoren fiir ihre Sorgfalt und Miihe bedanken: bei den Herren
Professoren W. Ax., Th. Dingermann, R. Fescharek, E. Graf, H. Haberlein und
E. Teuscher.
Die Pharmazeutische Biologie, die hiermit vorgelegt wird, ist ein "Mehr
mannerbuch", das die Vielfalt des Faches, wie es sich nun einmal in Deutschland
historisch entwickelt hat, widerspiegelt. Das Buch versucht, jedem etwas zu brin
gen; dem Student solI die Moglichkeit geboten werden, sich ortsspezifisch das
jeweils passende Priifungspensum zusammenzustellen.
Das Buch enthlilt 125 farbige Abbildungen von Arzneipflanzen als Standortauf
nahme oder in Form eines Teilausschnittes. Diese Abbildungen beanspruchen
selbstverstandlich nicht, eine wissenschaftliche Arzneipflanzenkunde zu ersetzen.
Sich die Namen von Stammpflanzen einzupragen, gleicht nicht selten einem
Vokabellernen; die Abbildungen, so hoffe n wir, erleichtern assoziativ die Verbin
dung zu den Objekten des ersten Priifungsabschnittes. Vielleicht auch wirken
die Illustrationen einladend, das Buch mit ein wenig mehr Freude zur Hand zu
nehmen.
Ein Teil der Abbildungen stammt von Herrn A. Scherfer, Wetzlar und yom
Institut fUr Pharmazeutische Biologie der Universitat Marburg. Ansonsten sind
wir fUr die Beschaffung gerade seltener Abbildungen der Firma Dr. Willmar
Schwabe, Karlsruhe, insbesondere Herrn F. Stempfle, jetzt Deutsche Homoo
pathie-Union, zu groBtem Dank verbunden, nicht zuletzt Herrn Herbert E. Maas,
von dem einige der technisch schonsten Aufnahmen stammen.
Kritik und Verbesserungsvorschlage fUr kiinftige Auflagen nehmen wir dank
bar entgegen.
Miinchen, Marburg
Oktober 1995 R. Hansel, J. Holzl
Autorenverzeichnis
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Ax Dr. Hanns Hiiberlein
Am Kornacker 76 Philipps-Universitat MarburglLahn
35041 Marburg Institut fur Pharmazeutische Biologie
DeutschhausstraBe 171/2
Prof. Dr. Theo Dingermann 35037 Marburg
Johann Wolfgang Goethe-Universitat
Fachbereich Biochemie, Pharmazie Prof. Dr. rer. nat. RudolfHiinsel
und Lebensmittelchemie WestpreuBenstraBe 71
Institut fur Pharmazeutische Biologie 81927 Munchen
Biozentrum
Marie-Curie-StraBe 9 Prof. Dr. Josef Holzi
60439 Frankfurt/Main Philipps-Universitat Marburg/Lahn
Institut fur Pharmazeutische Biologie
Dr. med. Reinhard Fescharek DeutschhausstraBe 171/2
Behringwerke AG 35037 Marburg
Arzneimittelsicherheit
Postfach 11 40 Prof. Dr. Eberhard Teuscher
35001 Marburg Ernst-Moritz-Arndt-Universitat
Greifswald
Prof. Dr. Engelbert Graf Institut fur Pharmazeutische Biologie
Philosophenweg 18 JahnstraBe 15a
72076 Tiibingen 17489 Greifswald
Inhalt
Teill
1 Triacylglyceride, Wachse, Phosphoglyceride 3
1.1 Triacylglyceride . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 ~ttduren . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Triacylglyceride mit essentiellen Fettsauren 4
1·1.3 Kokosfett · . 5
1·1.4 Palmkernfett 6
1.1·5 ErdnuBol · . 6
1.1.6 Leinol (Lini oleum) 7
1.1·7 Olivenol · . 8
1.1.8 RizinuBol 9
1.1·9 Kakaobutter 11
1.1.10 Mandelol 12
1.1.11 FischOle und Fischleberole 13
........
1.2 Wachse 14
1.2.1 Carnaubawachs 14
1.2.2 Jojobawachs 15
1.2·3 Wollwachs ... 16
1.2·4 Bienenwachs 16
1·3 Phosphoglyceride (Phosphatidsaurederivate) 17
1·3·1 Pflanzenlezithin (essentielle Phospholipide) 17
1.3·2 Sojalezithin 18
......
Literatur 19
2 Kohlenhydrate 22
2.1 Zucker 22
2.1.1 Glucose (Dextrose) 22
2.1.2 Fruchtzucker (D-Fructose) 23
2.1·3 Gereinigter Honig 24
· .........
2.1·4 Sorbitol 25
2.1·5 Mannitol · ........ 25
2.1.6 Lactose und Lactoseumwandlungsprodukte 26
2.1·7 Rohrzucker (Saccharose) 27
2.2 Polysaccharide · ....... 27
2.2.1 Starke und Starkemehl 27
2.2.2 Zellulose · .... 30
2.2·3 Islandisches Moos 32
X Inhalt
2.2.4 Agar ............... . 33
2.2.5 Gummi arabicum (Acacia-Gummi) 35
2.2.6 Tragant (Astragalus-Gummi) 37
2.2.7 Bockshornsamen 39
2.2.8 Eibischwurzel .. 40
2.2.9 Flohsamen 42
2.2.10 Huflattichblatter 45
2.2.11 Lindenbliiten 46
2.2.12 Blasentang 48
2.2.13 Hibiskus. . 50
2.2.14 Hagebutten 51
2.2.15 Sonnenhut 52
2.3 Inulin: Wegwarte 55
Literatur 56
3 Isoprenoide 63
3·1 Terminologie, die Isoprenregel, Einteilung, Vorkommen 63
3·2 Iridoide und Secoiridoide 64
3.2.1 Terminologie, Unterteilung 64
3.2.2 Spitzwegerich....... 66
3.2.3 Baldrian und Valepotriate 67
3.2.4 Enzian........ 71
3.2.5 Tausendgiildenkraut 73
3·3 Sesquiterpene . . . 74
3.3.1 Artemisinin 74
3.3.2 Guajazulen 75
3.3.3 Helenalin 75
3.3.4 Valerensaure 76
3-3.5 Schafgarbenkraut 76
3.3.6 Wermutkraut (Absinth) 78
3-3.7 Lowenzahn 80
3.3.8 Arnika ....... . 81
3·4 Diterpene .......... . 83
3·5 Triterpene einschlieBlich Steroide 85
3.5.1 Herzwirksame Glykoside 86
3.5.2 Wolliger Fingerhut und Lanataglykoside 87
3.5.3 Roter Fingerhut und Purpureaglykoside 90
3.5.4 Strophanthus ... 91
3.5.5 MaiglOckchenkraut 94
3.5.6 Meerzwiebel 96
3.5.7 Adoniskraut .... 98
3.5.8 Oleanderblatter.. 99
3.5.9 Saponine (Saponoside) 101
3.5.10 Primelwurzel 105
3.5-11 Senegawurzel ..... 106
Inhalt XI
3.5-12 SiiBholzwurzel ..................... 108
3.5-13 Ginsengwurzel ..................... 111
3.5-14 RoBkastaniensamen und daraus hergestellte Praparate 114
3.5-15 Anhang: Myrrhe 116
Literatur 117
4 Atherische Ole 127
4.1 Atherische Ole und Drogen mit iiberwiegend Monoterpenen 128
4.1.1 Pfefferminze und Pfefferminzol 128
4.1.2 Minzol 131
4.1.3 Krauseminzol.......... 132
4.1.4 Melissenblatter ........ . 133
4.1.5 Rosmarinblatter und Rosmarinol 134
4.1.6 Salbeiblatter und SalbeiOl 136
4.1.7 Thymian 139
4.1.8 Wacholderbeeren 140
4.1.9 Fichtennadelol 142
4.1.10 Terpentinol ... 143
4.1.11 Pomeranzenschale 145
4.1.12 Korianderfriichte . 146
4.1.13 Kiimmel und Kiimmelol 148
4.1.14 Kampfer (Campher) 149
4.1.15 Eukalyptusblatter, Eukalyptusol und Cineol 151
4.1.16 Anhang: Pyrethrum ........... . 153
4.2 Atherische Ole und Drogen mit iiberwiegend Sesquiterpenen 154
4.2.1 Kamillenbliiten . . . . . . . . . . . . 154
Kamillenol, Bisabolol und Guajazulen ....... . 157
Romische Kamille ................. . 158
4.2.4 Javanische Gelbwurz (Curcumae xanthorrizae rhizoma) 160
4.2.5 Kurkumawurzelstock.................. 161
4.3 Atherische Ole und Drogen mit iiberwiegend Phenylpropanen 162
4.3.1 Anis und Anisol . . . . 162
4.3.2 Fenchel und Fenchelol 164
4.3.3 Zimtrinde....... 164
4.3.4 Nelkenol und Eugenol 168
4.3.5 Ingwer 169
Literatur 171
5 Phenolische Verbindungen 181
5-1 Cumarine (Kumarine) 181
5.1.1 Steinklee 184
5-1.2 Ammi-visnaga-Friichte 186
5.1.3 Methoxsalen 187
5-2 Lignane . . . . . . 188
5-2.1 Podophyllin. 188