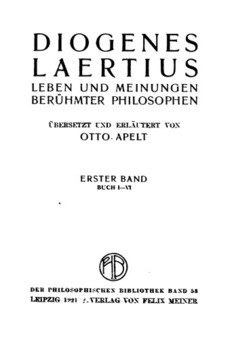Table Of ContentD I O G E N E S
L A E R T I U S
LEBEN UND M EINUNGEN
BERÜHMTER PHILOSOPHEN
ÜBERSETZT UND ERLÄUTERT VOX
OTTO-APELT
ERSTER BAND
BUCH 1—VI
DER PHILOSOPHISCHES BIBLIOTHEK BAXD 5S
LEIPZIG l«äl : - VERLAG VOX FELIX MEIXER
EX
'BIBLIOTHECA.''
\
¡REGIA Α(·Λί)ΓΛί.:
GEOΚ<· i
AUG.
Druck von Paul Dflnnliaupt, Cöthen i. Anh.
Vorwort.
•
Die vorliegende Übersetzung macht durchaus nicht
den Anspruch ein auch nur vorläufiger Ersatz zu sein
für die noch immer ausstehende kritische Ausgabe des
Diogenes Laertius, dessen letzte in Deutschland erschie
nene Ausgabe meines Wissens die Tauchnitzsche vom
Jahre 1833 mit ihren weiteren Abdrücken ist. Die längst
notwendige und ersehnte kritische Ausgabe, die, wie ich
im Verlaufe meiner Arbeit nach bereits begonnenem
Drucke zufällig erfuhr, jetzt in Vorbereitung ist, ist eine
interne Angelegenheit der Philologie. Bei meiner Arbeit
handelt es sich um etwas anderes: um Abtragung einer
alten Schuld der Philologie an die nicht philologische
Lesewelt, soweit sie für alte Philosophie Interesse hat.
Es war nicht unberechtigt, wenn kürzlich die Verfasserin
einer freien Übertragung von Stücken des Diogenes Laer
tius einen temperamentvollen Appell an die Philologen
richtete, sich ihrer Pflichten gegen die Laienwelt in dieser
Hinsicht bewußt zu werden. Schon längst vorher hatte
der Verleger der Philosophischen Bibliothek in Erkennt
nis des vorhandenen Bedürfnisses sein Augenmerk darauf
gerichtet, seine bekannte Bibliothek durch eine vollstän
dige Übersetzung des Diogenes zu ergänzen, doch dauerte
es lange, ehe ich mich entschließen konnte, seinem
Wunsche gemäß die Ausführung der Arbeit zu über
nehmen. Das Hauptbedenken war eben das Fehlen einer
kritischen Ausgabe. Die Cobetsche Ausgabe hat zwar
ihre großen Verdienste, doch weiß jeder, der sich ihrer
bedient, wie störend das Fehlen des kritischen Apparates
ist. Immerhin sind im Verlaufe der letzten Jahrzehnte
nicht unansehnliche Teile des Ganzen bekannt geworden
durch die Arbeiten von Bonnet, Diels, Wachsmut, Usener,
Arnim und anderen. Es erschien also nicht allzu ge
wagt, sich der Befriedigung des Bedürfnisses anzu
nehmen. Wenn die kurzen erklärenden Anmerkungen
sich ab und zu auf Textfragen einlassen mußten, so ist
das fast der einzige spezifisch philologische Tribut, den
die Sachlage mir für die Anmerkungen auferlegte. In
der Übersetzung macht sich die Berücksichtigung philo
logischer Interessen nur bei Wiedergabe der Schriften
kataloge insofern geltend, als ich da in den wichtigsten
Fällen, nämlich bei Aristoteles, Theophrast und Chrysipp,
die griechischen Titel ab und zu mit einigen Verweisungen
hinzugefügt habe, die für die genauere Auffassung un
entbehrlich sind. Vielleicht dürfte auch das ziemlich
ausführlich gehaltene Register, wenn auch zunächst für
das Bedürfnis der Laien berechnet, doch auch dem Philo
logen einigen Nutzen bieten, schon durch die bequemere
Form der Verweisungen nach Büchern und Paragraphen
als der einzig zweckmäßigen im Gegensatz zu der um
ständlichen und dabei häufig genug ungenauen und irre
führenden Bezeichnungsweise bei Hübner und Cobet,
welches letzteren Index nichts weiter ist als ein glatter
Abdruck des Hübnerschen.
Die letzte (und wohl zugleich auch erste) voll
ständige Übersetzung liegt weit zurück. Est ist die
in zwei Bänden erschienene Übersetzung von August
Bor heck, Wien und Prag 1807, dann auch Leipzig
1809, für ihre Zeit eine achtbare Leistung, der in den
erzählenden Partien eine gewisse körnige Altertümlich
keit des Ausdrucks einigen Reiz verleiht. Kurze Zeit
vorher war eine Übersetzung erschienen von J. F. und
P. L. Snell,. Gießen 1806, die sich indessen auf Auszüge
beschränkt. Erst unsere Zeit hat wenigstens einige Bei
träge zu einer neuen Übersetzung geliefert, nämlich die
oben erwähnte Schrift (Titanen und Philosophen von
Anna Kolle, Charlottenburg A. Seydel Nachfolger) und
eine Übersetzung (nebst kritischen Bemerkungen) des
zehnten Buches von A. Kochalsky, Leipzig 1914.
Mein Absehen war auf eine lesbare Übersetzung des
Überlieferten gerichtet, die den Diogenes wiedergeben soll
wie er in seinem Buche leibt und lebt, nicht wie er etwa
nach dem Wunsche eines Bearbeiters oder eines Lesers
hätte leiben und leben sollen. Der Leser muß also die
ganze Fülle der Zitate über sich ergehen lassen, in denen
Diogenes sehr zum Nachteil des Flusses der Darstellung
schwelgt: eine starke Belastung des Lesers, aber eine um
so wertvollere Beigabe für den Forscher auf dem Gebiete
der Geschichte der griechischen Philosophie. Die Er
läuterungen zu diesem reichen Quellenmaterial in den
Anmerkungen-beschränken sich in der Regel auf kurze
Hinweise auf die einschlägige Literatur.
Ich kann dies Vorwort nicht schließen, ohne der
treuen Beihilfe zu gedenken, die mir bei Abfassung des
Buches meine Tochter Dr. Mathilde Apelt in unermüd
licher Bereitwilligkeit mit Rat und Tat geleistet hat.
Dresden, 1. November 1920.
Otto Apelt.
Inhaltsverzeichnis.
Seite
Übersicht über die Literatur...............................XXV—XXVIII
Erstes B u c h ................................................................... 1— 61
Prooemium................................................................... 1— 10
Thaies Kapitel I ....................................11— 21
Solon „ II ....................................22— 32
Chilon „ I I I ....................................33— 36
Pittakos „ I V ....................................36— 40
Bias „ V ....................................40— 43
Kleobulos „ V I .......................... 43— 45
Periander „ V II....................................46— 49
Anacharsis „ VIII....................................50— 52
Myson „ IX .....................................52— 54
Epimenides „ X ....................................54— 58
Pherekydes „ X I ....................................58— 61
Zweites B u c h ..............................................................62—128
Anaximander Kapitel I .....................................62— 63
Anaximenes „ II ....................................63— 64
Anaxagoras „ I I I .....................................64— 68
Archelaos „ I V .....................................69— 70
Sokrates „ V .....................................70— 83
Xenophon „ V I ....................................84— 89
Aischines „ V II.....................................89— 91
Aristippos „ VIII....................................91—109
Phaidon „ I X .....................................109
Eukleides „ X ....................................110—113
Stilpon „ X I ....................................113—116
Kriton „ X II....................................117
Simon „ XIII....................................117—118
Qlaukon „ XIV....................................118
Simias „ X V ....................................119
Kebes „ XVI....................................119
Menedemos „ XVII............................... . 119—128
D r i t t e s B u c h ..............................................................129—173
Platon Kapitel I ....................................129—173
Dogmen........................................................................147—173
Seite
V i e r t e s B u c h .................................................................174—206
Speusippos Kapitel I ......................................174—176
Xenokrates „ II ......................................176—182
Poiemon „ I I I .........................................182—184
Krates „ I V .........................................184—186
Krantor „ V ......................................186—188
Arkesilaos „ V I .........................................188—197
Bion „ V II............................................197—202
Lakydes „ VIII............................................202—203
Karneades „ I X ............................................203—205
Kleitomachos „ X .........................................205—206
Fünftes B u c h ................................................................207—257
Aristoteles Kapitel I .........................................207—226
Theophrast „ II .........................................227—241
Straton „ I I I ............................................241—244
Lykon „ I V ............................................244—248
Demetrios „ V .........................................248—253
Herakleides „ VI 253—257
S e c h s t e s B u c h .................................................................258—307
Antisthenes Kapitel I ........................................258-^266
Diogenes
v. Sinope II ........................................267—295
Monimos „ I I I .........................................296
Onosik ritos „ I V .........................................297
Krates „ V .........................................297—301
Metrokies „ V I ...........................................301—302
Hipparchia „ V II............................................303—304
Menippos „ VIII............................................304—305
Menedemos „ I X ............................................305—307
Anmerkungen zu Buch I—V I ..................................308—341
Einleitung.
Das Buch, um dessen Übersetzung es sich in den vor
liegenden beiden Bänden handelt, nimmt eine ganz ein
zigartige Stellung in der gesamten Weltliteratur ein. Es
ist eine populäre Geschichte der griechischen Philo
sophie als einer mit dem griechischen Volkstum engver-
wachsenen Sache. Kein anderes Volk der Erde war oder
ist in der Lage, in diesem doppelten Sinne sich eine Ge
schichte seiner eigenen Philosophie darbieten zu können.
Denn wo wäre die Philosophie — ich meine die praktische
Philosophie, die Ethik, um die es sich hier zunächst nur
handeln kann — auch nur annähernd zu einer Volks
tümlichkeit gelangt wie bei den Griechen? Bei den
Griechen ist diese Bedeutung so ersichtlich, daß, wer ein
Bild von ihrem Volksleben in der Höhezeit ihrer Kultur
geben will, einen wesentlichen Zug vermissen lassen
würde, wenn er den Einfluß der Philosophie und ihrer
Träger auf den Volksgeist mit Stillschweigen übergehen
wollte. Die Philosophie war tatsächlich ein lebendiger
Faktor in dem Denken und Treiben der Griechen. Das
Auftreten ihrer Philosophent ihrWirken und ihre Schick
sale stellen zugleich ein Stück ihres Volkslebens dar und
wahrlich nicht das am wenigsten interessante.
Es wird immer eine bemerkenswerte Tatsache bleiben,
daß die Griechen bei ihrer hoch entwickelten Empfäng
lichkeit für jedes Schöne in Natur und Kunst alles Kunst-
schöne zwar in seiner Wirkung auf den Beschauer wohl
zu würdigen wußten, aber doch einen auffallenden Unter
schied machten in der Rangstellung derjenigen Künstler,
die sich dem Wesen ihrer Kunst zufolge mit der Materie
zu befassen haben, und denjenigen, die sich rein geistig
betätigen, einen Unterschied also zwischen Bildhauern
und Malern einerseits und Dichtern anderseits. Den
Dichtern aber schließen sich, was die höhere Wert
schätzung und die Stellung im geselligen Leben anlangt*,
unmittelbar die Denker, d. h. die Philosophen an. Man
kann sagen: die Forderung des Schönen für das Auge
war den Griechen so natürlich und selbstverständlich,
daß sie die dahin gehörenden Leistungen wie einen schul
digen Tribut entgegen nahmen, während ihnen rein geistige
Leistungen, in ihren gelungeneren Darbietungen wenig
stens, wie Offenbarungen aus einer höheren Welt er
scheinen mochten. Dabei bilden die Dichter das Mittel
glied zwischen den bildenden Künstlern und den Ver
tretern des reinen Gedankens, den Philosophen. Denn
als Herrscher im Reiche der freien Phantasie stellen sie
zwar immer irr engster Fühlung mit dem Formenreich
tum der Sinnenwelt, die sie ihren jeweiligen Zielen gemäß
nach den Gesetzen der Schönheit umgestalten, haben es
aber nicht mit der Materie selbst zu tun, sondern ntit der
Auffassungsweise und geistigen Welt des Menschen.
Der bedeutsame Schritt von der phantasievollen Auf
fassung der Natur und des Lebens zu der denkenden Be
trachtung derselben läßt die Griechen gewissermaßen sich
über sich selbst erheben. Denn je mehr sie für die Freude
am Anschaulichen und die künstlerische Verklärung der
selben geschaffen erscheinen, um so schwerer, söllte man
meinen, müßte ihnen der Schritt in das Reich des Ab
strakten, m. a. W. der Anfang der Philosophie, goworden
sein. Gleichwohl vollzog sich dieser tibergang nicht nur
mit einer gewissen Selbstverständlichkeit sondern auch'
mit bewundernswerter Stetigkeit des Fortschrittes. Mehr
und mehr suchen sich die Denker in der Welt der Ab
straktionen heimisch zu machen, ohne dabei aber doch
die Fühlung mit der Gedankenwelt und den Lebensbedin
gungen ihres Volkes in geselliger, staatlicher und reli
giöser Beziehung zu verlieren. Läßt man die lange Reih:1“
der namhaften Philosophen an sich vorübergehen, so
findet man darunter Ärzte, Gesetzgeber, Staatsmänner,
Kaufleute, FeJdherren, auch manche, die, aus den Kreisen
des Gewerbes oder des Handwerkes hervorgegangen, es
bis zur Gründung einer eigenen Schule oder zur Vor
standschaft über eine bereits bestehende brachten. Die
Öffentlichkeit des Volkslebens, wie sie, begünstigt durch
ein glückliches Klima und den angeborenen Geselligkeits
trieb der Südländer, schon an Werktagen sich allent
halben geltend machte, fand ihren erhöhten Ausdruck —
von den großen nationalen Festtagen in Olympia, auf
dem Isthmos usw. gar nicht zu reden — an den fest
lichen Tagen, die in reicher Fülle der Verehrung der
Stammesgötter geweiht waren: hier berührte sich vor
nehm und gering, arm und reich, alt und jung, gebildet
\md ungebildet in unbefangener Offenherzigkeit. Neu
gierde einerseits, Mitteilungsbedürfnis anderseits ließ es
an reger Unterhaltung niemals fehlen, die, getragen von
dem Gefühle der Zusammengehörigkeit und Einheit,
nicht wenig dazu beitrug, die auch in Griechenland nicht
fehlenden Standesvorurteile auf ein vergleichsweise sehr
bescheidenes Maß zu beschränken. Der demokratische
Geist der Stadtverfassungen einerseits, der politische Ehr
geiz der Abkömmlinge altangesehener Familien ander
seits sorgten schon an sich für eine gewisse Ausgleichung
•der Ansprüche; und was die Unterschiede der Bildung
anlangt, so stand von vornherein die Masse der Unge
bildeten dem Häuflein der Gebildeten nicht so schroff
gegenüber wie bei uns, wo die grobe sowie die meiste rein
mechanische Arbeit nicht einem Heere von Sklaven son
dern den Volksgenossen selbst anheimfällt. Der freie
Grieche war, bei leicht und billig zu beschaffender Be
friedigung der Lebensbedürfnisse, nicht überlastet mit
drückender Arbeit; es blieb noch Zeit und Stimmung
übrig für Befriedigung des Triebes nach Geistesbildung,
•eines Triebes, der bei uns auch in den bürgerlichen
Kreisen oft völlig überwunden wird von der nicht abzu-
'."eisenden Sorge für des Lebens Nahrung und Notdurft,