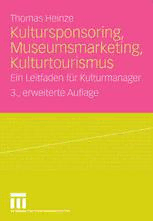Table Of ContentThomas Heinze
Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus
Thomas Heinze
Kultursponsoring,
Museumsmarketing,
Kulturtourismus
Ein Leitfaden für Kulturmanager
3., erweiterte Auflage
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
1.Auflage November 2000 (erschienen im Westdeutschen Verlag,Wiesbaden)
3.,erweiterte Auflage 2008
Alle Rechte vorbehalten
© VSVerlag für Sozialwissenschaften | GWVFachverlage GmbH,Wiesbaden 2008
Lektorat:Frank Engelhardt
Der VS Verlag für Sozialwissenschaften ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werkeinschließlichallerseiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohneZustimmungdes Verlags unzulässig und strafbar.Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspei-
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungen usw.in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung:KünkelLopka Medienentwicklung,Heidelberg
Druck und buchbinderische Verarbeitung:Krips b.v.,Meppel
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in the Netherlands
ISBN 978-3-531-15730-6
Inhaltsverzeichnis
Einfiihrung .......................................................................................
Grundlagen und Perspektiven des Kulturmanagement .............. 15
1 Kulturmanagement- Eine Ann~iherung ......... . ............................. 15
1.1 Kulturmanagement als Perspektive angewandter Kultur-
wissenschaft ....................................................................................... 15
1.2 Paradoxien des Kulturmanagement: Zwischen Erlebnisnachfrage,
kultureller Demokratie, transkultureller Verantwortung .................. 22
1.3 Konsequenzen far die Aus- und Weiterbildung ................................ 25
Ubungsaufgabe 1 .............................................................................. 27
Kunstkommunikation als Management von Bedeutungen
(Stefan Laddemann) .......................................................................... 28
2.1 Streit um das weil3e Bild: Yasmina Rezas Theaterstt~ck
,,Kunst" .............................................................................................. 28
2.2 Kunst + Kommunikation = Kunstkommunikation? .......................... 30
2.3 Eine Ehe mit Zugewinn: Was leistet Kunst far
Kommunikation? ............................................................................... 35
2.4 Kommunizieren mit Kunst: Drei Beispiele ....................................... 38
2.5 Kunstkommunikation und Perspektiven far das
Kulturmanagement ............................................................................ 51
2.6 Kein Erfolgsrezept: Von der Kunst zur Kommunikation in
fanf Schritten ..................................................................................... 53
121bungsaufgabe 2 ............................................................................... 56
Kultur und Wirtschaft: Perspektiven gemeinsamer
Innovation ........................................................................................ 57
3.1 Kultur und Wirtschaft systemtheoretisch beobachtet ........................ 57
3.2 Kulturf6rderung ................................................................................. 61
3.3 Perspektiven gemeinsamer Innovation .............................................. 63
3.4 Btirgerschaftliches Engagement ........................................................ 71
121bungsaufgabe 3 ............................................................................... 73
II Praxis des Kulturmanagement ....................................................... 75
Kultursponsoring ............................................................................. 75
1.1 Vom Mfizenatentum zum (Kultur-)Sponsoring. Die Entwicklung
des (Kultur-)Sponsoring .................................................................... 75
1.2 Definition und Wesensmerkmale des Sponsoring ............................. 76
1.3 Das Konzept des Sponsoring ............................................................. 77
1.4 Fazit ................................................................................................... 87
Ubungsaufgabe 4 ............................................................................... 87
2 Besucherorientiertes Museumsmarketing .................................... 88
2.1 Vorbemerkung ................................................................................... 88
2.2 Strategische Ausrichtung ................................................................... 88
2.3 Das Instrumentarium des besucherorientierten Marketing ............... 92
2.4 Praxisbeispiel: Das Robert Musil-Literaturmuseum in
Klagenfurt: Eine Stfirken-/Schwfichen-Analyse ............................... 106
U bungsaufgabe 5 ............................................................................... 118
3 Kulturtourismus .............................................................................. 119
3.1 Definition yon Kulturtourismus ........................................................ 119
3.2 Erlebnisorientierter Kulturtourismus ................................................ 120
3.3 Die Zielgruppe: Der Kultur-Tourist .................................................. 124
3.4 Voraussetzungen und Vorteile eines regionalen Kultur-
tourismus ........................................................................................... 125
3.5 Strategische 15berlegungen zu einem regionalen Kultur-
tourismus-Marketingkonzept ............................................................. 128
3.6 Fallstudie zum Kulturtourismus in der Regio Aachen 133
Obungsaufgabe 6 ............................................................................... 158
III Kulturwissenschaftliche Hermeneutik als Bezugsrahmen
fiir ein reflexives Kulturmanagement ................................ 159
)~sthetisches Denken undKulturmanagement ...................... 159
l]bungsaufgabe 7 ........................................................... 167
2 Kulturmanagement als Vermittlung von Kunst .................... 168
2.1 Das Kunstwerk als Gegenstand philosophischer Hermeneutik ...... 168
2.2 Asthetische Kommunikation ............................................. 171
2.3 Das autonome Kunstwerk ................................................. 175
2.4 Das Kunstwerk als ktinstlerischer Text .................................. 179
2.5 Das Verfahren der strukturalen Analyse und Interpretation
eines fisthetischen Objekts 184
IV Kritische Theorie und Kulturmanagement 189
Das Konzept eines reflexiven Kulturmanagement 189
Kulturindustrie 191
Kritische Theorie und Kulturmanagement 194
Obungsaufgabe 8 196
Kritik der Warenfisthetik 197
Konsequenzen fiir ein reflexives Kulturmanagement 203
0bungsaufgabe 9 205
V Systemtheoretischer Bezugsrahmen (Otto F. Bode) ...................... 207
Systeme, funktionale Differenzierungen, Wirtschaft,
Kultur und Management ................................................................ 207
1.1 Der Konstruktionsplan der Theorie sozialer Systeme ....................... 208
1.2 Gesellschaft als autopoietisches System ........................................... 214
1.3 Wirtschaft als autopoietisches Funktionalsystem .............................. 224
1.4 Organisationen als autopoietische Systeme ...................................... 229
1.5 Kultur als Programm nicht trivialer Maschinen ................................ 232
1.6 Kulturmanagement nicht trivialer Organisationen ............................ 235
Obungsaufgabe 10 ............................................................................. 240
Anhang/MusterlOsungen ................................................................. 241
Literatur ........................................................................................... 257
gnurhiifniE
Die seit Ende der achtziger Jahre zu beobachtende Institutionalisierung yon
Kulturmanagement (als Aus- und Weiterbildung) folgt der Erkenntnis, dass
(cid:12)9 vor dem Hintergrund begrenzter oder sich verringernder staatlich-6ffent-
licher FinanzierungsmSglichkeiten eine Professionalisierung und Okonomi-
sierung der Kulturarbeit dringend geboten ist;
(cid:12)9 aufgrund steigender Qualifikationsanforderungen an Bildung, Kultur und
Wirtschaft auch h6here Anforderungen an das daftir zustfindige Personal
gestellt werden mt~ssen.
Anliegen dieser Publikation ist es, Grundlagen und Orientierungen ft~r die (uni-
versitY.re) Lehre und Forschung im Kulturmanagement aufzuzeigen sowie Per-
spektiven ft~r eine Professionalisierung der Akteure in den Feldern Bildung,
Kultur und Wirtschaft zu entwickeln. Entsprechend dem breiten Aufgabenspekt-
rum zielt sie auf die Vermittlung von Kenntnissen sowohl im kulturwissen-
schaftlichen als auch im betriebswirtschaftlichen Bereich. Ihr ,,innovatorischer"
Charakter liegt in der Verschrfinkung dieser Kompetenzen, die bisher getrennt-
hier die kunst-, kultur-, bildungs- und geisteswissenschaftliche, dort die be-
triebswirtschaftliche, 0konomische Ausbildung- vermittelt wurden. Dart~ber
hinaus trfigt diese Arbeit dazu bei, das Berufsbild des Kulturmanagers, das in
der Diskussion seit Anfang der 90er Jahre fiuf3erst kontrovers behandelt worden
ist, begrifflich schfirfer zu fassen.
Der Begriff Kulturmanagement hat vor allem durch die rasante Ver0ffentli-
chung von zumeist rezeptologischen Handbt~chern eine inflationfire Bedeutung
erhalten, die den wissenschaftlichen Diskurs zunehmend erschwert. Um gegen
diese Entwicklung anzusteuern, bedarf es einerseits einer theoretischen Fundie-
rung und Operationalisierung sowie einer praxisorientierten Handhabung von
Kulturmanagement und andererseits einer definitorischen Abgrenzung des Pra-
xisfeldes ,,Kultur" und somit auch des Kulturmanagement. Kultur wird im Sinne
der hier favorisierten ,,Systemtheorie" verstanden als Ensemble oder Register
aller sozial verffigbaren Themen, die in eigens daf'tir geschaffenen gesellschaft-
lichen Einrichtungen zum Zweck der Kommunikation aufbewahrt, aufbereitet,
entwickelt und implementiert werden (Fuchs/Heinze 1994:142 f.).
Das Arrangement dieser Einrichtungen, wie immer sie beschaffen sein -3/m
gen, unterliegt dabei selbst der thematischen Evolution, die sie erm/Sglicht. We-
sentlich ist, dass diese Definition die Konstellation der je gepflegten und zur
Pflege bestimmten Themen vom Bereich der dafar zustfindigen Einrichtungen
unterscheidet. Diese Unterscheidung ist der Ansatzpunkt far die theoretische
Bestimmung dessen, was gemeinhin und in inflationfirer Weise als Kulturmana-
gement bezeichnet wird. Kulturmanagement meint- hier pointiert formuliert-
diejenige Profession, die mit der Organisation infrastruktureller Bedingungen
der M6glichkeit kultureller Prozesse befasst ist, insofern diese Prozesse gesell-
schaftliche (kommunikative) Prozesse sind (ebd.: 143). Damit ist zugleich klar,
dass Kulturmanagement in keiner Weise Kultur produziert, wie immer es auch
an ihr partizipiert. Kulturmanagement stellt die Umwelt kultureller Prozesse. In
dieser Funktion liegt seine Pragmatik begrt~ndet. Das macht es notwendig, in der
darauf bezogenen Ausbildung beides, die kulturellen Prozesse und die Bedin-
gungen ihrer M/Sglichkeit, zu studieren. Dieses ,,und" markiert zugleich, dass
Kulturmanagement nichts anderes als eine ,,Grenzg~ngerprofession" sein kann.
Kulturmanagement bezeichnet ein M6glichmachen von Kultur, eine Technik
des Zubereitens, des Gestaltens von Terrains, des Verftigbarmachens von Res-
sourcen, von Planungs-, Rechts- und Wirtschafts-Know-how unter modernen
gesellschaftlichen Bedingungen und nicht ein Dirigieren kultureller Prozesse.
Als zentrale Ziele kOnnen- im Blick auf die Organisation infrastruktureller
Bedingungen der M6glichkeit von Kultur- folgende genannt werden:
(cid:12)9 Kulturmanagement fOrdert Prozesse, mit denen Zusammenhfinge (Vernet-
zungen) im Differenten sichtbar gemacht werden. Kulturmanagement for-
ciert Differentialitfit und Konnektivitfit zugleich.
(cid:12)9 Kulturmanagement hebt also den kommunikativen Charakter kultureller
Prozesse hervor und setzt ihn im Sinne einer Stfirkung der Kommunikati-
onssensibilit~it und Kommunikationsf'fihigkeit ein.
(cid:12)9 Kulturmanagement sucht, entsprechend der transferenziellen Funktion von
Kultur (vgl. I/3) in einer (post)modernen Gesellschaft, die codebedingten
,,gaps" zwischen den Funktionssystemen nicht zu schliegen, sondern vor
Augen zu fahren. Damit wirkt es der isolationistischen Tendenz entgegen,
Kultur als einen Sonderbereich aufzufassen, der sich im Kontakt mit einzel-
nen Funktionssystemen kontaminiert. Stattdessen kommt es darauf an, vor-
urteilsfrei den Umstand zu nutzen, dass kulturelle Prozesse global anfallen.
(cid:12)9 Kulturmanagement organisiert und erm6glicht kommunikative Strukturen,
die die Zahl und Qualitfit kultureller Beobachtungsm6glichkeiten lokal stei-
gem.
Was bisher relativ abstrakt diskutiert wurde, wird pragmatisch dann, wenn man
sich klar macht, dass Kulturmanagement sich zu arrangieren hat mit kulturpoli-
tischen Maximen und Strategien sowie lokalen (kommunalen) Gegebenheiten.
Weder Kultur noch das auf sie bezogene Management schweben im luftleeren
Raum. Sie sind sehr konkrete kommunikative Prozesse, die sich an keiner Stelle
aus dem Bereich loslOsen, den sie tragen und der sie trfigt.
Daraus ergibt sich ein aul3erordentlich komplexes Netzwerk von rechtlich,
wirtschaftlich und politisch miteinander verquickten Strukturen, die das jeweili-
ge kulturelle Feld definieren. Im Zuge der wachsenden Industrialisierung, Tech-
nisierung und elektronischen (sichtbaren und unsichtbaren) Vernetzung aller
gesellschaftlichen Prozesse, damit auch der kulturellen Prozesse, muss dabei so-
wohl den neu entstehenden Formen von Kultur Rechnung getragen wie die Ver-
flechtung der internationalen Kulturszene beachtet werden. Aus diesem Span-
nungsverhfiltnis resultiert aber auch die zunehmende Komplexitfit kultureller
Prozesse. Mit Sicherheit werden kulturelle Angebote schwieriger ,,konsumier-
bar" werden. Je mehr Differentialitfit und Vernetzung sie spiegeln, desto deutli-
cher treten ,,Kulturvermittlungsprobleme" auf. Diese Probleme reassert in den
Zielekanon von Kulturmanagement aufgenommen werden.
Die Gegenwartsdiagnose ,,Postmoderne" hat Pluralitfit zum Focus. Die Post-
moderne beruht auf der Einsicht, dass ,,die Diversitfit der Lebensformen, Orien-
tierungsmuster, Sprachspiele und Bedarfnisstrukturen unaberschreitbar und
legitim ist" (Welsch 1993:214). Far ein innovatives Kulturmanagement bedeu-
tet dies, dass es auch Ressourcen zur Produktion von noch hie Dagewesenem
nutzt. Die Zukunft wird ein Leben innerhalb unterschiedlicher sozialer und
kultureller Kontexte sein, sowie ein Leben, das in sich mehrere Entwarfe durch-
lfiuft und verbindet. Darauf muss Kulturmanagement adfiquat reagieren. Zu
seiner Aufgabe geh6rt es geradezu, die Erfahrung von Unstrukturiertem zu er-
m6glichen, Ungesehenes zu schaffen, Objekte im Geist des Ereignisses zu ges-
talten (ebd: 217). ,,Das ist kein Freibrief far Dilettanten, sondern ein Aufruf zu
professionellem Mut". Es gilt, die Rahmenbedingungen unserer Lebensverhglt-
nisse, d.h. unserer Kultur, zu verfindern.
Bezaglich der Verhfiltnisbestimmung yon Kultur- und Wirtschaftsmanage-
ment stellt sich die Frage, ob Kulturmanagement als Sonderfall der allgemeinen
Managementlehre betrachtet werden kann (Schrey6gg 1993), d.h. ob mit Be-
schr~inkung auf die der Betriebswirtschaft entlehnte Managementlehre ein syste-
11
matisch durchdachtes und auf den Kulturbetrieb wie auf Kulturprojekte ange-
passtes Management vorgelegt werden kann.
Die Logik des Wirtschaftsmanagement basiert bekanntlich darauf, dass es
mit einem sehr reduzierenden und vereinfachenden Medium, dem Medium des
Geldes, die Umwelt beobachtet. Sie erscheint unter diesem Blickwinkel in der
Form yon M~rkten. Aus der Beobachtung yon Umwelt in der Sprache (Be-
schreibung) des Geldes ist zu lernen, dass man flexibel und innovativ handeln
muss, sei es, dass man neue Produkte auf dem Markt anbietet, sei es, dass die
Organisation den Anforderungen der Umwelt 31~meg zu verfindern ist. In diesem
Sinne kann von managerialem Denken in der Wirtschaft gesprochen werden.
Far Kulturmanagement sind vor allem die konzeptionellen 12Iberlegungen der
modernen Organisations- und Verwaltungssoziologie (Pankoke 2000) zu strate-
gischem Denken von zentraler Bedeutung. Strategisches Denken stellt eine
Herausforderung in dem Sinne dar, dass man nicht nur- z.B. durch Ver~nde-
rung des Angebotes- auf sich ver~indernde Umwelten der ,,Erlebnisgesell-
schaft" reagiert, sondem mit dem Anspruch auftritt, in diese turbulente Umwelt
Entwicklungsperspektiven einzubringen und diese Perspektiven, d.h. kulturelle
Impulse, Investitionen und Innovationen, einer Bewertung (Evaluation) hin-
sichtlich ihrer Wirkungen in der Gesellschaft zu unterziehen.
Modernes Wirtschafts- und Kulturmanagement wird sich an Paradigmen des
ganzheitlichen, vernetzten und nach der Methode von Versuch und Irrmm sich
voran tastenden Handelns orientieren massen (Bendixen 1993a: 17). Nach die-
sem Verstfindnis sind Manager
,,rationale Systemlenker und konstruktive Unruhestifter. eiS versuchen auf der einen
Seite, Prozesse beherrschbar zu machen und eis zielorientiert zu formen. Auf der an-
deren Seite aber streben eis nach Innovationen nicht zuletzt deshalb, weil die durch
erzeugten Rationalitfit Stetigkeiten und Gleichf6rmigkeiten einen Grad na Routine -re
reichen k6nnen, der unflexibel macht und gesehen fisthetisch eine Monotonie hervor-
bringt, von der sich der Markt abwenden etnnS(k wie von einem abgeleierten Schla-
ger" (Bendixen 1993b: .)211
Das heil3t: Managementpraxis ist auch in Wirtschaftsunternehmen eine Gestal-
tungskunst und ersch6pft sich nicht in Funktionen und Tfitigkeiten, die der Steu-
erung und Rationalisierung des Betriebes dienen. Neben zweckrationalem Han-
deln ist also gleichgewichtig innovatives Handeln gefragt.
Far die Praxis des Kulturmanagement stellt sich die Forderung, eine den Be-
dingungen und Bedarfnissen der Kultur bzw. der Kanste kompatible Kultur des
Management zu entwickeln, die sich in manchen Hinsichten von den Praktiken
und Mentalitfiten des Wirtschaftsmanagement entfernt. Die Aufgaben- und Ziel-
strukturen far kulturelle Einrichtungen weisen nfimlich einen erheblich
21