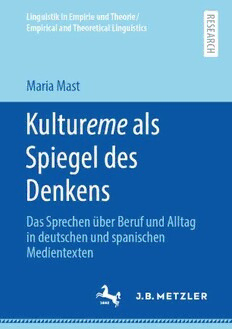Table Of ContentLinguistik in Empirie und Theorie/
Empirical and Theoretical Linguistics
Maria Mast
Kultureme als
Spiegel des
Denkens
Das Sprechen über Beruf und Alltag
in deutschen und spanischen
Medientexten
Linguistik in Empirie und Theorie/
Empirical and Theoretical Linguistics
Reihe herausgegeben von
Igor Trost, Bad Abbach, Deutschland
Annamária Fábián, Bad Abbach, Deutschland
Torsten Leuschner, Gent, Belgien
Armin Owzar, Freiburg im Breisgau, Deutschland
Judith Visser, Bonn, Deutschland
Die Reihe Linguistik in Empirie und Theorie ist der Untersuchung linguistischer
Phänomene auf allen sprachlichen Ebenen gewidmet. Durch die fachliche
Breite des Herausgebergremiums und des wissenschaftlichen Beirats dieser
Reihe umfasst ihr Portfolio die germanistische, anglistische, romanistische,
slavistische Linguistik und die Linguistik des Ungarischen. Dabei werden
sowohl empirische als auch theoretische Fragestellungen der gesprochenen und
der geschriebenen Sprachforschung berücksichtigt. Neben innovativen einzel-
philologischen Arbeiten richtet sich diese Reihe auch an Autorinnen und Autoren
sprachübergreifender kontrastiver Analysen. Neben Monographien und Sammel-
bänden werden in der Reihe Linguistik in Empirie und Theorie auch heraus-
ragende Qualifikationsarbeiten kostenfrei veröffentlicht. Deshalb möchte das
Herausgebergremium gezielt auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler ermutigen, sich um die Veröffentlichung ihrer Qualifikationsarbeiten in
der Reihe zu bemühen. Eine Publikation ist auf Deutsch und Englisch möglich.
Dank Springer Link sind die Publikationen der Reihe Linguistik in Empirie und
Theorie weltweit verfügbar.
Ein wissenschaftlich und interdisziplinär ausgewiesenes Herausgeberteam mit
einem Beirat renommierter Expertinnen und Experten sichert die Qualität der
Reihe durch eine Begutachtung im doppelten Peer-Review-Verfahren.
The book series Empirical and Theoretical Linguistics is dedicated to the
linguistic study of all domains of language. Thanks to the wide range of
disciplines represented in the editoral team and the advisory committee, the
series is able to encompass German, English, Romance, Slavic and Hungarian
linguistics. Innovative studies of empirical and theoretical topics concerning
spoken and written language in individual languages are invited, as are
crosslinguistic and contrastive investigations.
Besides monographs and edited collections, the series Empirical and Theoretical
Linguistics publishes high-quality doctoral and postdoctoral theses. The editors
therefore encourage early career researchers specifically to submit their book-
length manuscripts for publication in the series. Contributions may be written in
German or English. Thanks to Springer Link, publications in the series Empirical
and Theoretical Linguistics are available worldwide.
Quality is ensured through double peer review by an editorial team of
experienced academics in collaboration with a cross-European advisory
committee of renowned specialists.
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/16336
Maria Mast
Kultureme als
Spiegel des
Denkens
Das Sprechen über Beruf und Alltag
in deutschen und spanischen
Medientexten
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Ekkehard Felder
Maria Mast
Berlin, Deutschland
Die Dissertation an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ist im Rahmen des
Promotionskollegs „Sprachkritik als Gesellschaftskritik im europäischen Vergleich“
entstanden und erhielt ein Stipendium der Landesgraduiertenförderung Baden-
Württemberg. Das Iberoamerika-Zentrum Heidelberg finanzierte einen Forschungs-
aufenthalt an der Universidad Pompeu Fabra in Barcelona. Die Autorin war Mitglied
der Heidelberger Graduiertenschule für Geistes- und Sozialwissenschaften.
Originaltitel der eingereichten Dissertation: Kultureme im intra- und interlingualen
Vergleich als sprachspezifischer Spiegel des Denkens. Eine vergleichende Analyse am
Diskurs über Beruf und Alltag.
ISSN 2662-5725 ISSN 2662-5733 (electronic)
Linguistik in Empirie und Theorie/Empirical and Theoretical Linguistics
ISBN 978-3-662-61946-9 ISBN 978-3-662-61947-6 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-61947-6
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer-Verlag GmbH,
DE, ein Teil von Springer Nature 2020
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen
etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die
Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des
Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
J.B. Metzler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein
Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany
Geleitwort
In dem Zeitraum vom 1. Juni 2002 bis zum 31. Dezember 2015 – also in der Zeit spanne,
die Maria Mast in ihrer linguistischen Medienuntersuchung in den Blick nimmt –
schien Europa mitunter an einem Scheideweg zu stehen. Nach den wirtschafts-
politischen Erschütterungen der sogenannten europäischen Bankenkrise in der
zweiten Hälfte der 2000er Jahre und den sozialpolitischen Herausforderungen durch
Migration in den 2010er Jahren wird Europa in der Wahrnehmung vieler Zeitgenossen
nicht mehr als nachhaltig stabil wahrgenommen. Im Gegenteil stellen sich viele der
Grundsatzfragen des europäischen Zusammenschlusses erneut, die zur Jahrtausend-
wende konsensual beantwortet schienen, etwa: Was verbindet die Menschen in Euro-
pa? Was trennt sie? Aus heutiger Sicht – im Jahre 2020, in dem ein Coronavirus namens
Sars-Cov-2 die Welt stillstehen lässt – ist der folgende Satz nahezu trivial, aber er muss
dennoch wieder holt werden: Europa hat auf Dauer nur eine gemeinsame Zukunft,
wenn es nicht nur als Institutionengeflecht und Strukturgebilde wahrgenommen wird,
sondern die Menschen, die in den europäischen Ländern etwas übereinander wissen,
Gemeinsamkeiten kennen, aber auch Unterschiede und mögliche Reibungen thema-
tisieren. Um diesem Desiderat gerecht zu werden, muss der Blick auch auf den Alltag
und die Wahrnehmung desselben gelenkt werden. Und dies tut die Autorin auf eine
inspirierende Weise.
Mit ihrer linguistischen Analyse verdeutlicht sie den enormen Einfluss der Sprache
auf unser Empfinden und Denken und deckt das Zustandekommen unseres Selbst-
verständnisses auf: Denn im sprachlichen Material, in dieser Arbeit in den Medien-
texten, zeigen sich kulturelle Gesellschaftsauffassungen. Der Mehrwert der Un-
tersuchung liegt darin, konvergierende und divergierende Gesellschaftsentwürfe
und Rollenwahrnehmungen in zwei europäischen Ländern – nämlich Spanien und
Deutschland – zu identifizieren. Und das tut sie, indem sie die sprachliche Konstituti-
on von Beruf und Alltag fokussiert und ihre Konzeptualisierung in deutschen und spa-
nischen Medientexten transparent macht. Gesellschaftlich relevante Linguistik zeigt
hier eindrucksvoll, wie sehr unser Denken, Wissen und Fühlen wesentlich durch die
mediale Konstruktion beeinflusst ist: Was wir über die Alltagswelt im eigenen und
in einem anderen Land denken, ist geprägt durch diese sprachliche Vermittlung und
die mediale Interaktion kultureller Wahrnehmungsfolien, die uns als Orientierungs-
konzepte dienen.
Die sprachlich instruierten Wahrnehmungsfolien und evozierten Denkmuster trans-
parent zu machen, ist im und für den europäischen Kontext identitätsstiftend, denn
schließlich ist es uns nur in geringem Ausmaß möglich, uns über Primärerfahrun-
gen individuelles Wissen zuzulegen. Größtenteils sind wir auf medienvermittelte
Wirklichkeitsdarstellungen und ihre sprachliche Ordnung – man könnte auch sagen
„Zubereitung“ – angewiesen, wenn wir uns ein Bild von der Welt machen. Die in den
VI Geleitwort
Medienwissenschaften von Siegfried J. Schmidt (1996) in Die Welten der Medien stark
gemachte Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Realität ist hierbei heuristisch
hilfreich: Unter Wirklichkeit wird die subjektive, mit den originären Sinnen erfahrbare
und begreifbare Welt verstanden, Realität ist das medial konstituierte und sprachlich
also zwangsläufig gestaltete Szenario davon: die Medienrealität als vermittelte Welt.
Vor diesem Hintergrund der Differenzierung sind wir als Medienrezipienten des
sogenannten Informationszeitalters in erheblichem Maße mit Realität konfrontiert,
also mit sprachlichen Produkten, die Wirklichkeit zeigen wollen. In der Rezeption von
gesellschaftspolitisch und kulturell relevanten Wissensbeständen haben wir es dem-
nach mit gestalteten Materialien in sprachlicher Form zu tun. Individuell erfahrbare
Wirklichkeit kann sich, muss sich aber nicht decken mit der kollektiv rezipierbaren
(Medien-)Realität. Massenmediale Sprach- und Bildzeichen sind daher ein perspek-
tivierter Ausschnitt von Welt. Der Weltausschnitt ist interessengeleitet konstituiert
worden, es handelt sich um eine mögliche Realität im Spektrum verschiedener Wirk-
lichkeiten.
Der Arbeit liegt die erkenntnisleitende Frage zugrunde, ob sich – und zwar in der
medialen Darstellung von alltäglicher Aufgabenbewältigung einerseits und fachbe-
zogenen Berufsanforderungen in kompetitiven Wirtschaftssystemen andererseits –
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Deutschland und Spanien identifizieren las-
sen, die im sprachlichen Zugriff schon (vor)angelegt sind. Die Ergebnisse, welche die
Kultur spezifik der Konzepte im Deutschen und Spanischen offenlegen, werden aus
dem Blickwinkel der Forschungen in einem neuen Kulturem-Begriff verdichtet und
sind auch für ein nicht-linguistisches Publikum interessant.
Der Autorin ist zu dieser hoch relevanten soziokulturellen Fragestellung nur zu gra-
tulieren. Sie ist nicht nur Germanistin, sondern auch Romanistin – und von daher
zu dieser sprachvergleichenden Untersuchung im Deutschen und Spanischen bestens
befähigt.
Ich wünsche dem Buch große Aufmerksamkeit und hoffe auf weitere Untersuchungen
dieser Art.
Prof. Dr. Ekkehard Felder
Heidelberg, im Mai 2020
Beiratsgremium "Linguistik in Empirie und Theorie | Empirical and
Theoretical Linguistics"
• Jannis Androutsopoulos (Hamburg) (German Linguistics)
• Irmtraud Behr (Paris 3) (German Linguistics)
• Uta Helfrich (G.A.-U. Göttingen) (Romance Linguistics)
• Alfred Lameli (Freiburg) (German Linguistics)
• Alexander Lasch (TU Dresden) (German Linguistics)
• Antje Lobin (J.G.-U. Mainz) (Italian and French Linguistics)
• Konstanze Marx (Greifswald) (German Linguistics)
• Tanja Mortelmans (Antwerpen) (German Linguistics)
• Aleksandra Salamurović (F.S.-U. Jena) (Slavic Linguistics and German
Linguistics)
• Renata Szczepaniak (Bamberg) (German Linguistics)
• Stefanie Ullmann (Cambridge) (English Linguistics and Computational
Linguistics)
• Hélène Vinckel-Roisin (Paris 4) (German Linguistics)
Beiratsgremium "Sprache, Geschichte, Politik und Kommunikation |
Language, History, Politics and Communication“
• Peter Ernst (Universität Wien) (German Linguistics)
• Hans-Werner Eroms (Universität Passau) (German Linguistics)
• Heiko Girnth (Philipps-Universität Marburg) (German Linguistics)
• Sabine Heinemann (Karl-Franzens-Universität Graz) (Romance Linguistics)
• Uta Helfrich
• Michel Lefèvre (Montpellier 3) (German Linguistics)
• Dietmar Osthus (Universität Duisburg Essen) (Romance Linguistics)
• Aleksandra Salamurović (Friedrich-Schiller-Universität Jena) (Slavic
Linguistics and German Linguistics)
• Sibylle Sauerwein (Paris Nanterre - Paris 10) (German Linguistics and
Romance Linguistics)
• Sven Staffeldt (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) (German
Linguistics)
• Stefanie Ullmann (Cambridge) (English Linguistics and Computational
Linguistics)
Danksagung
Ich danke meinen Eltern für die Inspiration, den Blick aus unserem schmalen Tal
hinaus auf andere Länder zu werfen. Danke an Andreas Wundersee (Satz) und an
Friederike Mayer-Lindenberg (Korrektorat), die dieses Buch wie so vieles in meinem
Leben schöner und besser gemacht haben. Für viele gemeinsam verbrachte Stunden
in der Universitätsbibliothek, aufbauende Kaffeepausen und inspirierende Gespräche
danke ich meiner Heidelberger Crew. Ebenso meinen Schwestern, die wissen, wann es
an der Zeit ist, zu verbessern – und wann, zuzuhören.
Ohne Stipendium hätte ich nicht promovieren können. Dafür und für den
motivierenden Rahmen danke ich dem Heidelberger Forschungskollektiv zur
„Sprachkritik als Gesellschaftskritik im europäischen Vergleich“. Besonders Verena
Weiland sowie meine Zweitbetreuerin Prof. Sybille Große haben diese Arbeit durch
ihre romanistische Perspektive und durch umsichtige Fragen zur sprachvergleichenden
Korpusanalyse weitergebracht. Immer ansprechbar und hilfreich war Katharina Jacob.
Sie hat mir klar gemacht, dass Wissenschaftlerinnen auch nur Menschen sind – und
man selbst zu einer werden kann, wenn man sich nur lange und intensiv genug mit
einem Thema beschäftigt.
Zuletzt danke ich meinem Doktorvater Prof. Ekkehard Felder, der mir stets Mut
gemacht hat, weiterzuschreiben und weiterzudenken. Sein Seminar zur Angewandten
Sprachwissenschaft hat mich in meinem ersten Semester so sehr überfordert und
begeistert, dass ich den Rest meines Studiums nicht mehr von dem Thema ablassen
konnte.
Vorwort
Manchmal lernen wir ein neues Wort, das uns in einer Momentaufnahme vor Au-
gen führt, wie anders Menschen verschiedener Kulturen die Welt in ihrer Sprache
verstehen. Ein solches Wort bringt uns etwas Unbekanntes näher. Nehmen wir das
spanische Wort „la merienda“, das vielleicht mit „Vesper“ ins Deutsche übersetzt
werden kann. Eigentlich beschreibt der Ausdruck das Konzept des Nachmittags-
snacks, bei dem salzige oder süße Kleinigkeiten verspeist werden – typischerweise
ein kleines Baguette, mit Schinken oder mit Käse, an einem Sonntagnachmittag auch
churros mit heißer Schokolade. Der Ausdruck „churros“, der im Deutschen keine
Entsprechung hat, macht uns auf eine lexikalische Lücke aufmerksam: Da wir diese
Art des frittierten und mit Zucker bestreuten Brandteiggebäcks, das in dickflüssige
heiße Schokolade getunkt wird, nicht kennen, benötigen wir auch kein Wort dafür.
In Deutschland kennen wir Krapfen oder Berliner, die zwar etwas anderes sind, uns
aber das spanische Konzept der ›churros‹ verstehen lassen. Den Ausdruck „Vesper“
verwendet man überwiegend in Süddeutschland für die kleine Zwischenmahlzeit,
ebenso für das Vesperbrot, typischerweise in einer Brotdose, dazu beispielsweise noch
ein Apfel. In Hamburg würde man dazu wohl eher „Stulle“ sagen. Muss der Apfel
dann weggelassen werden?
Es ist kein Zufall, dass die genannten Beispiele für kulturspezifische Wörter aus dem
Sinnbezirk des ESSENS stammen, denn er begleitet unser Leben als anthropologische
Konstante und legt ein kulturspezifisches Sprechen darum besonders nahe. Bei den in
der vorliegenden Arbeit untersuchten Diskursthemen BERUF und ALLTAG handelt es
sich ebenfalls um zentrale Themen des Menschseins, die zeit- und raumübergreifend
wirksam sind. Eine Betrachtung, die die Kulturspezifik dieser Bereiche in den Fokus
rückt, verspricht, das Denken, Fühlen und Wollen der untersuchten Sprachgemein-
schaft bezüglicher dieser für das Leben maßgeblich prägender Aspekte zu ergründen.
Eine solche Perspektive werde ich in der folgenden Studie vorschlagen.