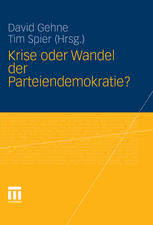Table Of ContentDavid Gehne · Tim Spier (Hrsg.)
Krise oder Wandel der Parteiendemokratie?
David Gehne
Tim Spier (Hrsg.)
Krise oder Wandel
der
Parteiendemokratie?
Festschrift für Ulrich von Alemann
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
1. Auflage 2010
Alle Rechte vorbehalten
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2010
Lektorat: Frank Schindler
VS Verlag für Sozialwissenschaften ist eine Marke von Springer Fachmedien.
Springer Fachmedien ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfälti gungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im
Sinn e der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher
von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany
ISBN 978-3-531-16670-4
Inhaltsverzeichnis
David Gehne/Tim Spier
Krise oder Wandel der Parteiendemokratie?
Festschrift zum 65. Geburtstag von Ulrich von Alemann 7
I. Parteien in systemischer Perspektive
Martin Morlok
Politische Chancengleichheit durch Abschottung? Die Filterwirkung
politischer Parteien gegenüber gesellschaftlichen Machtpositionen 19
Jörg Bogumil
Parteien in der Kommunalpolitik. Hoffnungsträger oder Auslaufmodell? 37
Frank Decker
Das Präsidentenamt in der Parteiendemokratie 49
Theo Schiller
Politikergebnisse der Parteien – Schwachstellen der deutschen Parteienforschung 66
Josef Schmid
Führung und Parteien – Über ein schwieriges Verhältnis in einem
demokratischen System 80
Elmar Wiesendahl
Zwei Dekaden Party Change-Forschung. Eine kritische Bilanz 92
II. Parteien in nationaler Perspektive
Karl-Rudolf Korte
Parteienwettbewerb. Wählen und Regieren im Schatten der Großen Koalition 121
Stefan Marschall/Christoph Strünck
Von der Reformpartei zur Partei der Reformen?
Die SPD auf der Suche nach ihrer Zukunft 132
Franz Walter
Sammlung und Spaltung des bürgerlichen Lagers. Die Erosion und politische
Ausdifferenzierung bürgerlicher Politik begann schon unter Adenauer 150
Alf Mintzel
Das Abenteuer Parteienforschung im geteilten Deutschland
der 1960er und 1970er Jahre 160
III. Parteien in internationaler und komparativer Perspektive
Klaus von Beyme
Populismus und Rechtsextremismus in postmodernen Parteiensystemen 177
Sabine Kropp
Koalitionsbildungen und Koalitionsstabilität in Mittel- und Südosteuropa.
Überlegungen und Ergebnisse zu einem wenig bestellten Forschungsfeld 190
Reinhard Meyers
Staatsklassen als Transformationsbremser?! Anmerkungen zur Entwicklung
des rumänischen Parteiensystems seit der Wende: ein Werkstattbericht 210
Michael Th. Greven
Sind Parteien in der Politik alternativlos oder ist ihre Rolle historisch begrenzt?
Die Parteienforschung angesichts von „Globalisierung“, „Transnationalisierung“
und „Europäisierung“ 225
Schriftenverzeichnis Prof. Dr. Ulrich von Alemann 236
Verzeichnis der Autoren 248
Krise oder Wandel der Parteiendemokratie?
Festschrift zum 65. Geburtstag von Ulrich von Alemann
David H. Gehne/Tim Spier
Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Auch in akademischen Kreisen lautet die
Antwort auf diese Frage häufig: ein Buch, genauer: eine Festschrift. Ulrich von Alemann
hat im Jahr 2009 seinen 65. Geburtstag gefeiert. Diesen Anlass haben die Herausgeber
dieses Bandes genutzt, um einen wichtigen Aspekt des wissenschaftlichen Schaffens des
Jubilars in das Zentrum dieser Publikation zu rücken: die Parteienforschung. Wir haben uns
für eine inhaltliche Fokussierung der Festschrift entschieden, da die Zeit für einen umfas-
senden Blick auf das Lebenswerk Ulrich von Alemanns noch nicht gekommen ist. Es ist
ihm aufgrund einer hochschulrechtlichen Besonderheit vergönnt, noch drei Jahre über die
eigentliche Pensionsgrenze hinaus tätig zu sein. Und das ist auch gut so.
Ziel der Festschrift war dabei nicht nur, wichtige Weggefährten des Jubilars zu Wort
kommen zu lassen, sondern auch prägende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die-
ses Forschungsfeldes für eine Mitarbeit zu gewinnen, um so Stand und Perspektiven der
Parteienforschung in Deutschland abzubilden.
1 Der Stellenwert der Parteienforschung im Werk Ulrich von Alemanns
Um einen Eindruck vom Stellenwert der Parteienforschung im wissenschaftlichen Werk
des Jubilars zu gewinnen, wird im Folgenden kurz seine wissenschaftliche Biografie an-
hand von beruflichen Meilensteinen und wichtigen Publikationen zusammengefasst. Dabei
kann nur ein Ausschnitt der thematischen Vielfalt im Werk Ulrich von Alemanns berück-
sichtigt werden, da eine umfassende Würdigung seines Werkes den Rahmen einer Einfüh-
rung in diese Festschrift zur Parteienforschung sprengen würde.1 Vor allem seine bedeut-
samen Rollen als Berater von politischen Akteuren in Bund und Land, nicht zuletzt als
Mitglied der Parteienfinanzierungskommission des Bundespräsidenten Johannes Rau
2000/2001, als vielgefragter Kommentator aktueller Ereignisse in den Medien und als en-
gagierter Hochschullehrer können hier nur am Rande Berücksichtigung finden, obwohl sie
ihm sehr wichtig sind. Denn Ulrich von Alemann versteht sich als Mittler zwischen den
Welten, zwischen Wissenschaft und Politik, zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und
zwischen Lehrenden und Lernenden, da er, wie er es selbst ausdrückt, „ganz altmodisch an
die Aufklärungsfunktion der Wissenschaft glaubt“ und an ihre Aufgabe, politische Mün-
digkeit und Kritikfähigkeit zu fördern und zu verbreiten.
Ulrich von Alemann wurde am 17. August 1944 in Seebach/Thüringen geboren. Er
studierte Politikwissenschaft, Soziologie, Staatsrecht und Geschichte in Münster, Köln und
Bonn. Er verbrachte 1969/70 ein Studienjahr an der University of Alberta in Edmonton und
erwarb 1971 einen Master of Arts. In seiner Master of Arts Thesis (Titel: „The Impact of
Institutional Devices on Intra-Party Democracy. Theoretical Reflections and the Case of
German Party Law“), gekürzt veröffentlicht als Aufsatz in der Politischen Vierteljahres-
1 Ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Schriften des Jubilars findet sich am Ende dieses Bandes.
8 David H. Gehne/Tim Spier
schrift (von Alemann 1972), nimmt Ulrich von Alemann ein zentrales Thema der Parteien-
forschung auf. Ausgehend von Michels These der Oligarchisierung analysiert er, wie weit
mit Hilfe des damals neuen Parteiengesetzes Parteien demokratisiert werden konnten.
Schon zwei Jahre später wurde Ulrich von Alemann bei Prof. Dr. Karl Dietrich Bracher an
der Universität Bonn promoviert mit der Arbeit „Koalitionssysteme und Parteiendualismus.
Eine Kritik von Parlamentarismustheoremen“. Ursprünglich als empirische Studie in An-
lehnung an Douglas Rae konzipiert, konzentrierte sich der Autor schließlich auf die histo-
risch-theoretischen Aspekte von verschiedenen Ansätzen der Parlamentarismustheorie und
deren Einfluss auf die Parteientheorie (von Alemann 1973). In den darauf folgenden Jahren
erweiterte sich der thematische Fokus hin zu einer breiteren Auseinandersetzung mit Parti-
zipationsformen im Rahmen eines größer angelegten DFG-Projektes (von Alemann 1975).
1977 vertrat Ulrich von Alemann zunächst den Lehrstuhl von Prof. Dr. Claus Offe in
Bielefeld und wurde zum Jahresende 1977 zum Professor für Politikwissenschaft an der
Pädagogischen Hochschule Rheinland in Neuss ernannt. Ausgehend von einem empiri-
schen Projekt zur Erforschung der Funktion und Strukturen von Parteien und Verbänden
am Beispiel von SPD und Gewerkschaften (von Alemann/Heinze 1979) erschloss Ulrich
von Alemann sich ein neues Themenfeld, das seine wissenschaftliche Tätigkeit der näch-
sten Jahre bestimmen sollte. Zum einen wurde die theoretische Debatte um Pluralismus und
(Neo-)Korporatismus vorangetrieben (von Alemann 1981a), zum anderen aber auch das
Thema des Einflusses von Verbänden und Interessenorganisation auf das politische System
neu aufgegriffen (von Alemann/Forndran 1983; von Alemann 1987). 1980 wechselte Ul-
rich von Alemann auf einen Lehrstuhl für Politische Wissenschaft an der Universi-
tät/Gesamthochschule Duisburg. Dort blieb er vier Jahre und hatte schließlich von 1984 bis
1998 trotz weiterer Rufe an die Universitäten Stuttgart und Potsdam eine Professur an der
FernUniversität in Hagen inne. Von 1984 bis 1989 leitete Ulrich von Alemann ein großes
Forschungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen zur sozialverträglichen Technikge-
staltung mit ca. 100 Einzelprojekten, das Niederschlag in zahlreichen Publikationen gefun-
den hat (z.B. von Alemann/Schatz 1986; von Alemann u.a. 1992). Von 1994 bis 1996 leite-
te er zusammen mit Prof. Dr. Josef Schmid das Forschungsprojekt „Organisationsstruktur
und Organisationsreform der ÖTV“ (von Alemann/Schmid 1998) und baute parallel dazu
die „Forschungs-Initiative Verbände“ auf.
Seit 1998 lehrt und forscht Ulrich von Alemann an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf. Im Jahr 2000 erschien erstmals die Einführung in das Parteiensystem Deutsch-
lands, die mittlerweile in der vierten Auflage vorliegt und damit endgültig den Rang eines
Standardwerkes erreicht hat (von Alemann 2010). Dieses Buch steht stellvertretend für den
besonderen Stil des Jubilars. Es ruht auf einem breiten wissenschaftlichen Fundament, ist
umfassend im Zugang und doch in einer Sprache geschrieben, die bildreich und verständ-
lich ist, so dass auch Studierende und interessierte Laien einen Zugang zu dieser komplexen
Materie finden können.
Das sich seit Mitte der 1990er Jahre wandelnde Verhältnis von Medien und Parteien
war ein weiteres wichtiges Thema, das Ulrich von Alemann in zahlreichen Publikationen
analysiert und diskutiert hat (z.B. von Alemann 1997; von Alemann/Marschall 2002). Ul-
rich von Alemann wurde 2000 in die Parteienfinanzierungskommission des damaligen
Bundespräsidenten Johannes Rau berufen, deren Empfehlungen die Neuordnung der Partei-
enfinanzierung stark geprägt hat. Mit den Schattenseiten der privaten Parteienfinanzierung
hatte sich Ulrich von Alemann jedoch schon infolge der Flick-Spendenaffäre Anfang der
Krise oder Wandel der Parteiendemokratie? 9
1980er Jahren eingehend befasst. Dies gipfelte in der theoretischen Neuvermessung der
politischen Korruption im Rahmen des vom Jubilar herausgegebenen Sonderbands der
Politischen Vierteljahresschrift unter dem Titel „Dimensionen politischer Korruption“ (von
Alemann 2005). Seit dem Jahr 2003 ist Ulrich von Alemann stellvertretender Direktor des
„Instituts für deutsches und europäisches Parteienrecht und Parteienforschung“ an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und hat in dieser Funktion die Weiterentwicklung
des Instituts hin zu einer interdisziplinären Kooperation von Politikwissenschaftlern und
Juristen begleitet und zahlreiche Drittmittelprojekte zu Themen wie Parteienfinanzierung
und politische Korruption durchgeführt. Seit 2009 leitete er zusammen mit Prof. Dr. Mar-
kus Klein die „Deutsche Parteimitglieder-Studie 2009“ (von Alemann/Spier 2008). Sie
untersucht die sozialstrukturelle, psychographische und aktivitätsbezogene Zusammenset-
zung der Mitgliedschaft der deutschen Parteien sowie die Motive des Parteibeitritts, der
innerparteilichen Aktivität und des Parteiaustritts. Als Teilreplikation der Potsdamer Par-
teimitgliederstudie aus dem Jahr 1998 stehen insbesondere das dynamische Moment des
Wandels über den Zeitraum eines Jahrzehnts sowie dessen Auswirkungen auf die Entwick-
lung der Parteiendemokratie in der Bundesrepublik im Vordergrund. Dieser kurze Abriss ist
also kein Abgesang auf den Parteienforscher Ulrich von Alemann, denn mit Spannung
erwarten wir die Publikation erster Ergebnisse dieser Studie.
2 Krise oder Wandel der Parteiendemokratie?
Die Beschreibung und Bewertung der Veränderungen im Gefüge der Parteiendemokratie
waren stets Leitmotive der Forschung Ulrich von Alemanns. Die wichtigsten empirischen
Entwicklungen lassen sich in acht Punkten zusammenfassen (von Alemann 2003: 187ff):
Die Mitgliedschaft der Parteien geht seit den 1980er Jahren zurück – unterbrochen nur
durch einen kurzen Aufschwung im Zuge der Wiedervereinigung. Die Wahlbeteiligung als
wichtiger Ausdruck der Partizipationsbereitschaft der Bevölkerung sinkt nahezu stetig und
hat bei den letzten zwei Bundestagswahlen jeweils bundesdeutsche Tiefstwerte erreicht.
Dabei ist besonders die Entfremdung Jugendlicher von der Politik bedenklich, was sich
unter anderem in der noch stärker zurückgehenden Wahlbeteiligung von Jungwählern zeigt.
Der Konzentrationsgrad des Parteiensystems verringert sich systematisch; die beiden
Volksparteien CDU/CSU und SPD können immer weniger Wählerstimmen auf sich verei-
nigen. Der Anteil von sogenannten Stammwählern, die sich kontinuierlich für ein und die-
selbe Partei entscheiden, vermindert sich. Gleichzeitig mehren sich politische Skandale,
über die in den Medien berichtet wird, gerade im Bereich der Parteienfinanzierung. Das
Vertrauen in Parteien und Politiker geht überdies drastisch zurück. Selbst die jeweils in
Opposition befindliche Volkspartei kann in der Regel nicht mehr von der gestiegenen Un-
zufriedenheit profitieren, was insbesondere für die SPD gilt.
Man kann diese empirischen Befunde als Symptome für eine Krise der deutschen Par-
teiendemokratie begreifen (vgl. etwa Vester 2003; Landfried 2004). Allein: Diese Deu-
tungsweise ist keineswegs zwingend und geht mit der Gefahr einher, durch plakativ-
generalisierende normative Bewertungen die komplexen Ursachen der Einzelphänomene zu
verdecken. Der Begriff der „Krise“ ist zur Bewertung von Veränderungen im Parteiensys-
tem offenbar schnell bei der Hand. Bereits 1981 unternahm Ulrich von Alemann eine kriti-
sche Bestandsaufnahme der in Medien und Wissenschaft diskutierten „Parteienkrisen“ seit
10 David H. Gehne/Tim Spier
Gründung der Bundesrepublik. Er kam schon damals auf zehn als gravierend empfundene
„Krisen“ (von Alemann 1981b: 111), wobei sowohl ihre numerische Zahl wie auch ihre
wahrgenommene Intensität inzwischen deutlich zugenommen haben dürfte.
Wieso werden Veränderungen im Parteiensystem in Deutschland so häufig krisenhafte
Tendenzen attestiert? Es gibt zumindest drei Faktoren, die eine Deutung von Wandlungs-
tendenzen als Krisen in der Debatte begünstigen: Erstens sind in der politischen Kultur
Deutschlands Ressentiments gegen Parteien immer noch tief verwurzelt. Sie mögen ihre
Ursprünge in der konservativ-bürgerlichen Ablehnung des „Parteienstreits“ im 19. Jahr-
hundert haben, sich aus negativen Erfahrungen der Weimarer Republik speisen oder Reak-
tion auf die Monopolisierung staatlicher Gewalt durch die Staatsparteien in den beiden
deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts sein. Der Anti-Parteien-Affekt ist jedenfalls in
einem Teil der Publikationen, die eine krisenhafte Entwicklung der deutschen Parteiende-
mokratie konstatieren, deutlich zu spüren (vgl. etwa von Arnim 2009). Zweitens wird die
Charakterisierung von Wandlungstendenzen als Krisen auch durch die Medienlandschaft
begünstigt. Der Nachrichtenwert einer Entwicklung steigt, je mehr ihr dramatische und
negative Eigenschaften zugeschrieben werden können. Die kaum mehr zu erfassende An-
zahl von Krisen, die allein der SPD inzwischen attestiert wurden, ist beredtes Zeugnis für
diese Tendenz. Schließlich mischt sich drittens in die Bewertung des Wandels auch allzu
oft eine geradezu nostalgische Perspektive: Wer den Zustand der heutigen Parteiendemo-
kratie mit der in der Hochzeit der parteipolitischen Partizipation etwa in den 1970er Jahren
vergleicht, wird unschwer negative Trends entdecken, etwa sinkende Mitgliederzahlen,
sinkende Wahlbeteiligung und steigende Unzufriedenheit mit den politischen Parteien.
Doch ist es angemessen, diesen Vergleichspunkt zu wählen? Sind nicht vielleicht die
1970er Jahre in der längeren historischen Perspektive die erklärungsbedürftige Ausnahme,
die vielleicht nur unter besonderen Bedingungen wie hohem wirtschaftlichen Wachstum,
einem relativ finanzkräftigen Staatswesen und einem ausgeprägten gesamtgesellschaftli-
chen Wohlstand zustande gekommen sind?
Hier sind wir bei einem Punkt angelangt, der Ulrich von Alemann im Bereich der Par-
teienforschung stets wichtig war: Die unaufgeregte Analyse des Wandels in all seinen em-
pirischen Facetten, jenseits jeglichen Alarmismus. Für die Analyse des Wandels der Partei-
endemokratie sollten vier Punkte beachtet werden: Zunächst sollten einzelne Wandlungs-
tendenzen zunächst separat nach spezifischen Ursachen untersucht werden, ohne mögli-
cherweise bestehende Zusammenhänge zu ignorieren. Weiterhin ist es wichtig, für Verglei-
che die längere historische Perspektive zu berücksichtigen, um besser beurteilen zu können,
was der Regelfall, was hingegen die Ausnahme ist. Darüber hinaus sollten Parteien nicht
als reaktionsunfähige Organisationen aufgefasst werden, die hilflos gesellschaftlichen Ver-
änderungen ausgesetzt sind. Sie selbst können sich natürlich verändern und an gewandelte
Rahmenbedingungen anpassen (von Alemann/Spier 2009). Sollte man auch unter Beach-
tung dieser Kriterien zu der Erkenntnis kommen, dass die Parteiendemokratie in ihrer heu-
tigen Form an Funktionsfähigkeit verloren hat, so stellt sich bei der normativen Bewertung
dieser Entwicklung schließlich immer noch die Frage: Was sind die Alternativen zur Par-
teiendemokratie? Können sie als negativ wahrgenommene gesellschaftliche Entwicklungen
wirklich beheben? Oder bringen sie ihre eigenen, spezifischen Defizite und Problem mit
sich?