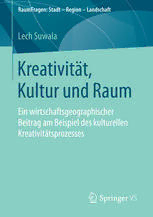Table Of ContentRaumFragen:
Stadt – Region – Landschaft
Herausgegeben von
O. Kühne, Weihenstephan-Triesdorf, Deutschland
S. Kinder, Tübingen, Deutschland
O. Schnur, Tübingen, Deutschland
Im Zuge des „spatial turns“ der Sozial- und Geisteswissenschaft en hat sich die Zahl
der wissenschaft lichen Forschungen in diesem Bereich deutlich erhöht. Mit der
Reihe „RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft “ wird Wissenschaft lerinnen und
Wissenschaft lern ein Forum angeboten, innovative Ansätze der Anthropogeo-
graphie und sozialwissenschaft lichen Raumforschung zu präsentieren. Die Reihe
orientiert sich an grundsätzlichen Fragen des gesellschaft lichen Raumverständ-
nisses. Dabei ist es das Ziel, unterschiedliche Th eorieansätze der anthropogeogra-
phischen und sozialwissenschaft lichen Stadtund Regionalforschung zu integrieren.
Räumliche Bezüge sollen dabei insbesondere auf mikro- und mesoskaliger Ebene
liegen. Die Reihe umfasst theoretische sowie theoriegeleitete empirische Arbeiten.
Dazu gehören Monographien und Sammelbände, aber auch Einführungen in Teil-
aspekte der stadt- und regionalbezogenen geographischen und sozialwissenschaft -
lichen Forschung. Ergänzend werden auch Tagungsbände und Qualifi kationsarbei-
ten (Dissertationen, Habilitationsschrift en) publiziert.
Herausgegeben von
Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Prof. Dr. Sebastian Kinder, Universität Tübingen
PD Dr. Olaf Schnur, Universität Tübingen
Lech Suwala
Kreativität, Kultur
und Raum
Ein wirtschaftsgeographischer
Beitrag am Beispiel des kulturellen
Kreativitätsprozesses
Lech Suwala
Humboldt-Universität zu Berlin
Deutschland
Dissertation Humboldt-Universität zu Berlin, 2012
ISBN 978-3-658-06580-5 ISBN 978-3-658-06581-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-06581-2
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio-
nalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufb ar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die-
sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be-
trachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürft en.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer Science+Business Media.
www.springer-vs.de
für meinen Vater Josef Suwala
Vorwort
Eine Monographie hat genauso wie ein ‚Pokalspiel’ seine eigenen Gesetze, bei de-
nen das Resultat im Vornherein kaum zu prognostizieren ist. So verhält es sich im
Übrigen auch mit der ‚Kreativität’, dem Hauptuntersuchungsgegenstand der vorlie-
genden Arbeit.
Die Idee zu dieser Untersuchung entwickelte sich sowohl aus meiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit an der Humboldt-Universität zu Berlin als auch bei einer
privatwirtschaftlichen Politikberatung in Berlin. In beiden Fällen arbeitete ich eng
an der Schnittstelle der Kreativitäts-, Innovations- und Entrepreneurshipforschung.
Dabei wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen oder praxisorientier-
ten Projekten bei denen ich mitwirkte – wie im Übrigen auch in der sonstigen
Community – willkürlich und inflationär von kreativen/innovativen Menschen oder
Entrepreneuren, kreativen Gemeinschaften, kreativen/innovativen Industrien oder
gar kreativen/innovativen Städten gesprochen und Kreativität durch Kreativität
beschrieben. Diese Umstände veranlassten mich schließlich, einen ganzheitlichen
Ansatz zum Kreativitätsprozess zu entwickeln, und gleichzeitig die fragmentierten
Forschungsstränge zu diesen Themen innerhalb der gegenwärtigen – durch vielsei-
tige Einflüsse gekennzeichneten – Wirtschaftsgeographie im Hinblick auf kulturelle
Kreativität zu systematisieren.
Dass diese Arbeit schließlich einen guten Ausgang gefunden hat, ist vielen Per-
sonen aus dem beruflichen und privaten Umfeld zu verdanken, die mir entweder in
zahlreichen fachbezogenen Gesprächen und Diskussionen Ideen, Anregungen und
Verbesserungsvorschläge unterbreitet haben, oder durch die ich in mannigfaltiger
Hinsicht eine mentale, soziale oder materielle Unterstützung erfahren habe. Allen
voran möchte ich Prof. Dr. Elmar Kulke, meinem Doktorvater, danken, der sich
sowohl auf die Umsetzung einer theoretischen Forschungsarbeit eingelassen hat als
auch entscheidend durch die systematische Betreuung, die kritische Auseinanderset-
zung und durch die materielle Unterstützung für Austauschaktivitäten mit anderen
Wissenschaftlern oder für Konferenzreisen zum Erfolg dieses Vorhabens beigetra-
gen hat. Dieser Dank gilt in besonderem Maße auch den beiden Betreuern und
Gutachtern, Prof. Dr. Sebastian Kinder und Prof. Dr. Hans-Joachim Kujath für
ihre schnelle Hilfe, ihre reichhaltigen Hinweise und schließlich für die Übernahme
der Gutachten. Schließlich hatte ich das Vergnügen, mit Allen John Scott, dem
8 Vorwort
Urheber des Ansatzes des kreativen Feldes zu sprechen und ihm die Fortschritte
meiner Arbeit mehrmals vorzustellen.
Insgesamt wurde die Konzeption sowie Teile dieser Arbeit im Rahmen des
wirtschaftsgeographischen Colloquiums an der Humboldt-Universität sowie auf
zahlreichen nationalen und internationalen Workshops und Konferenzen (2008 AK
Industriegeographie in Eschwege, 2009 AAG in Las Vegas, RSA in Cardiff, ECE in
Toronto; 2010 ERSA in Jönköping, 2011 bei einem wissenschaftlichen Austausch in
Tokyo, SIEM in Berlin und GCEG Seoul) vorgestellt. Dabei hatte ich zudem die
Möglichkeit mit zahlreichen führenden nationalen (Carsten Becker, ilse Helbrecht,
Oliver Ibert, Bastian Lange, Ivo Mossig) und internationalen Wissenschaftlern
(Nick Clifton, Richard Florida, Hiroshi Matsubara, Päivi Oinas, Dominic Power,
Norma Rantisi, Kevin Stolarick) zu diesem Themenbereich ausführliche Gespräche
zu führen. Einen besonderen Dank möchte ich auch den Professoren Ludwig El-
lenberg und Rolf D. Schlunze für ihre fachliche und menschliche Beratung sowie
Charles Vacher und Takashi Kasagami für ihre wissenschaftsstiftende Unterstüt-
zung aussprechen. Darüber hinaus danke ich zahlreichen Fachkollegen: Sascha
Brinkhoff, Peter Dannenberg, Peter Dirksmeier, Doreen Jacob, Juhl Jörgensen,
Brian Hracs, Christian Hundt, Dieter Kogler, Friedemann Koll, Hogni Hansen, Atle
Hauge, Suntje Schmidt, Josef Strasser und Karin Wessel für wertvolle Tipps und
Jana Lahmer, Robert Kitzmann und Mattias Romberg für die administrative und
redaktionelle Unterstützung. Janina Dobrusskin gebührt schließlich ein ganz beson-
derer Dank für die gewissenhafte Unterstützung bei der Transformation der Arbeit
in ein publizierfähiges Format.
Schließlich gebührt ein großer Dank meiner Frau Thi Minh Vu und meiner
Mutter Krystyna Suwala sowie dem Rest der Familie für das Verständnis, das
Durchhaltevermögen und die bedingungslose Unterstützung. Freunden (Sven
Goosmann, Michael Hacker, Benedict Leicht, Ralf Mädler, Oliver Michler, Franzis-
ka & Johanna Schulze, Steffen Schmaler, Stefan & Thomas Siegemund, Tobias
Grebing, Tobias Wiesel und Axel Willkomm) danke ich für das ‚Berliner Aus-
gleichsprogramm’. Diese Arbeit ist meinem verstorbenen Vater Josef Suwala ge-
widmet.
Lech Suwala
Zusammenfassung
„Kreativität“ ist in aller Munde. Insbesondere im vergangenen Jahrzehnt hat sich
‚Kreativität’ in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu einem einflussreichen The-
ma entwickelt. Es wird dabei sogar behauptet, dass Kreativität die strategische Res-
source der Zukunft schlechthin für Wettbewerbsvorteile darstellt. In Industrielän-
dern wird bereits gegenwärtig von dem Aufstieg einer ‚kreativen Klasse’ und einem
regulativen Paradigmenwechsel gesprochen, der einer Formationskrise entspricht
und mit der Agrarkulturalisierung, Industrialisierung oder dem Übergang zu einer
Dienstleistungsgesellschaft vergleichbar ist.
Trotz dieses ‚Kreativitätshypes’ und einer Flut von Studien, Forschungsberich-
ten und Veröffentlichungen, existiert eine Reihe gravierender Mängel beim wissen-
schaftlichen Verständnis von Kreativität und insbesondere von kultureller Kreativi-
tät, einer speziellen Form der Kreativität, die das Fundament der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft bildet.
Vor diesem Hintergrund versucht die vorliegende Monographie einen Beitrag
zu einem ganzheitlichen Verständnis des Kreativitätsprozesses am Beispiel der
kulturellen Kreativität aus einer wirtschaftsgeographischen Perspektive zu leisten.
Dabei wird auf der Basis einer Synthese, Transformation und Extrapolation von
Erkenntnissen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen (vor allem der
Geographie, der Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie und der Psychologie),
ein systemisches Modell des Kreativitätsprozesses an der Schnittstelle von Kreativi-
tät, Kultur und Raum entwickelt.
Die Untersuchung ermöglicht dadurch ein differenziertes und disziplinüber-
greifendes Kreativitätsverständnis, einen detaillierten Blick auf den (kulturellen)
Kreativitätsprozess sowie Einsichten zu wechselseitigen Wirkungsweisen von (kul-
tureller) Kreativität und dem Raum, die im Rahmen einer umfangreichen Auseinan-
dersetzung mit dem Wesen, der Entstehung, Bedeutungszuweisung der (kulturellen)
Kreativität und dem Verhältnis von (kultureller) Kreativität und dem Raum erarbei-
tet wurden.
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass Kreativität zunächst nach unterschied-
lichen Formen (kulturell, wissenschaftlich, technologisch, wirtschaftlich) differen-
ziert werden kann. Dabei sind insbesondere im Rahmen des kulturellen Kreativi-
tätsprozesses neben den wirtschaftlichen Aktivitäten auf kulturell kreativen Märkten
sowohl soziale Beziehungen innerhalb kulturell kreativer Communities als auch das
kognitive Auffassungsvermögen kulturell kreativer Individuen für eine wirtschafts-
10 Zusammenfassung
geographische Betrachtung interessant geworden, weil sie selber Bestandteile der
Wertschöpfungskette sind.
Da der resultierende flexible und hybride Entstehungs- und Wertzuweisungs-
prozess weder auf der betrieblichen (Unternehmen), der zwischenbetrieblichen
(Netzwerk) noch auf der sozialen Ebene (Milieu) ausreichend koordiniert werden
kann, empfiehlt sich für die Konzeptualisierung des kulturellen Kreativitätsprozes-
ses der Feldbegriff. Innerhalb dieses Feldes übernimmt darüber hinaus der Raum in
dreifacher Hinsicht eine strukturierende und/oder koordinierende Funktion: erstens
durch Erfahrungsvorteile kreativer Individuen, die sich in der Perzeption von kultu-
rellen Landschaften widerspiegeln; zweitens durch Nähevorteile, die mittels Interak-
tionen in Communities soziale Orte schaffen und drittens durch Agglomerations-
vorteile, die aus der Konzentration ökonomischer Aktivitäten an wirtschaftlichen
Standorten herrühren.
Diese räumlich bedingten Externalitäten können in besonderen räumlichen
Konfigurationen (z.B. Städten) als sich überlappende lokalisierte Feldeffekte begrif-
fen werden, die eine einzigartige Atmosphäre innerhalb von kulturell kreativen
Feldern generieren können. Die Atmosphäre hat den Charakter eines öffentlichen
Gutes und spannt dabei einen multiskaligen Potentialraum aus gegenseitigen Ein-
flüssen von kulturellen Landschaften, gesellschaftlichen Orten und wirtschaftlichen
Standorten auf, der kulturelle Kreativität begünstigen kann.