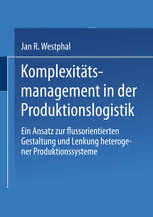Table Of ContentJan R. Westphal
Komplexitäts-
management in der
Produktionslogistik
Ein Ansatz zur flussorientierten
Gestaltung und Lenkung heteroge-
ner Produktionssysteme
Westphal
Komplexitätsmanagement in der Produktionslogistik
GABLER EDITION WISSENSCHAFT
R.
Jan Westphal
Komplexitätsmanagement
in der Produktionslogistik
Ein Ansatz zur flussorientierten
Gestaltung und Lenkung
heterogener Produktionssysteme
Mit einem Geleitwort
von Prof. Dr. Sebastian Kummer
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek -CI
Westphal, Jan R.:
Komplexitătsmanagement in der Produktionslogistik : ein Ansatz zur Aussorientierten Gestaltung
und lenkung heterogener Produktionssysteme 1 Jon R. Westphal.
Mit einem Geleitw. von Sebastian Kummer. - 1. AuA ..
(Gabler Edition Wissenschaft)
Zugl.: Dresden, Techn. Univ., Diss., 2001
ISBN 978-3-8244-7475-2 ISBN 978-3-663-08644-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-08644-4
1. Au Rage Oktober 2001
Alle Rechte vorbehalten
©Springer Fachmedlen Wlesbaden 2001
Ursprunglich erschienen bei Deutscher Universitats-Verlag GmbH, Wiesbaden 2001
lektorat: Brigitte Siegel 1 Sabine Scholler
www.duv.de
Dos Werk einschliel3lich aller seiner Teile isi urheberrechtlich geschutzt. Jede
Verwertung auf3erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes isi ohne
Zustimmung des Ve;rloges unzulăssig und strofbar. Dos gilt insbesandere fur
Vervielfăltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergobe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besandere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Worenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wăren und daher von jedermann benutzt werden durften.
Gedruckt auf săurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
ISBN 978-3-8244-7 475-2
V
Geleitwort
Das Management der Komplexität in der Produktionslogistik ist sowohl aus theoretischer
als auch aus praktischer Sicht eine der schwierigsten Aufgaben der Logistik. Seine Bedeutung
ist unumstritten, zumal das stetige Wachstum der Komplexität eine Art Naturgesetz zu sein
scheint.
Mit zunehmender Kundenorientierung stiegen seit den 70er Jahren die Anzahl der Produkte
und Produktvarianten sowie die Individualisierungsanforderungen stark an. Kaum bewältigt,
so stellen sich unter dem Schlagwort des Supply Chain Managements neue Herausforderun
gen. Betriebs- und unternehmensübergreifend sollen die Logistikprozesse koordiniert und
flussorientiert gestaltet werden. Die Vielzahl der Knoten und Kanten solcher Netzwerkbezie
hungen bedingen eine erneute Komplexitätssteigerung. Der Verweis auf Supply Chain Mana
gement Software, die die unternehmensübergreifende Abstimmung gewährleisten soll, er
scheint im historischen Vergleich wie die vor Jahren gehegte Hoffnung, PPS-Systeme und das
CIM würden die innerbetrieblichen Koordinationsprobleme lösen. Obwohl jeder weiß, dass
sich diese Hoffnungen kaum erfiillt haben, verspricht man sich von neuen unternehmensüber
greifenden Computersystemen eine Lösung der Komplexitätsprobleme.
Die vorliegende Arbeit folgt keinem modischen Trend, sie geht einen anderen, grundsätzli
cheren Weg. Ausgehend von einer kritischen Analyse der Schwächen der PPS-Systeme wird
auf Basis der Systemtheorie ein Ansatz flir die flussorientierte Gestaltung und Lenkung von
Produktionssystemen entwickelt. Dieser hat das Ziel, das Problem der Komplexitätssteige
rung als Konsequenz zunehmender Individualisierungsanforderungen zu lösen. Hierzu wird
zunächst ein eigenständiges Rahmenkonzept entwickelt, das die Einflussfaktoren der Kom
plexität, die Beschreibung der Eigenschaften von Produktionsbereichen sowie die organisato
rische, planerische Fragestellung behandelt.
Die Arbeit bleibt jedoch nicht bei der Beschreibung. In Ergänzung bestehender PPS
Systeme wird ein auf Markov-Ketten basierender Ansatz zur Unterstützung der Produktions
lenkung durch Simulation entwickelt. Entsprechend dem Stand der Forschung verwendet Herr
Westphal flir die Modeliierung eine hierarchische Regelkreisstruktur. Die Arbeit legt aus
fUhrlieh dar, wie die Vorgehensweise erfolgen soll und warum die Bedingungen flir den Ein
satz von Markov-Ketten gegeben sind.
Die Arbeit bildet so einen interessanten Beitrag zur Produktionslogistik. Die konsequente
Anwendung von Markov-Ketten bei der Simulation von produktionslogistischen Prozessen ist
durchaus ein flir die Theorie innovativer Vorschlag. Es ist der Arbeit zu wünschen, dass die
Diskussion hierüber sich fruchtbar flir die Theorie der Produktionslogistik auswirkt.
Prof. Dr. Sebastian Kummer
VII
Vorwort
Die kundenspezifische Individualisierung der Erzeugnisse verstärkt die Bedeutung von ei
nem der wichtigsten Kostenfaktoren in produzierenden Unternehmen: der Komplexität der
Lenkung des Produktionsprozesses.
Die Komplexität äußert sich in der Anzahl der zu berücksichtigenden Variablen der Um
weltzustände und der Handlungsalternativen sowie in der Struktur ihrer Beziehungen. An die
Stelle linearer Fertigungsabläufe treten vernetzte, inhomogene Prozeßstrukturen mit einer
hohen Anzahl von Schnittstellen. Zusätzliche bereichsübergreifende Planungs-, Koordinati
ons- und Kontrollprozesse verringern als komplexitätsbedingte Kosten die Effizienz des Pro
duktionsprozesses.
Die Leitidee dieser Arbeit war die Überzeugung, daß die traditionellen Organisations
strukturen und PPS-Systeme den Anforderungen an eine flexible Fertigung nicht gerecht wer
den können, so daß ein ganzheitlicher Lösungsansatz, der zum einen die Organisationsstruk
turen des Produktions- und des Lenkungssystems und zum anderen geeignete Koordinations
instrumente umfaßt, zu entwickeln war.
Die grundlegende Frage der Organisation des Produktionsprozesses ist, wie eine hohe Kun
dennähe im Leistungsprogramm, eine geringe Komplexität und eine hohe Effizienz der Pro
zesse zugleich realisiert werden können. Der hierfiir notwendigen Integration von Organisati
onsstruktur, Produktionsprozeß sowie Planungs- und Informationssystemen wurde bisher in
der Produktionslogistik zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Der in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Gestaltungsansatz zeigt, daß, aufbauend auf den
Erkenntnissen der Systemtheorie, der Kybernetik, der Theorie der hierarchischen Systeme
und der Logistik als flußorientierter Führungsfunktion, ein ganzheitlicher Ansatz fiir die Ge
staltung der Organisationsstrukturen und die flußorientierte Lenkung des Produktionsprozes
ses entwickelt werden kann.
Der Kerngedanke des Gestaltungsansatzes ist ein verstärktes Denken in Prozessen und
Netzwerken. Entsprechend dem Grundsatz "structure follows strategy" erfordert die Malerial
flußorientierung eine Veränderung der bisherigen Planungs- und Führungsorganisation. Die
systembildende Funktion der Logistik beinhaltet die Gestaltung einer prozeßorientierten Or
ganisationsstruktur und der darauf ausgerichteten Planungs-, Kontroll- und Informationssy
steme. Traditionelle hierarchische Strukturen werden abgelöst durch sich selbst organisieren
de Einheiten und kurze Regelkreise.
VIII Vorwort
Spätestens bei der Formulierung des Vorwortes wird dem Verfasser bewußt, daß das Pro
motionsvorhaben nur dank der Unterstützung vieler, die an dieser Arbeit mitgewirkt oder zu
Ihrem Werden beigetragen haben, erfolgreich war.
Meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Sebastian Kummer, danke ich herzlich für die Be
treuung meiner Dissertation und für seine Gedanken zu den Grundlagen eines flußorientierten
Logistik-Managements. Diese stellen ein wesentliches Fundament der vorliegenden Arbeit
dar. Darüber hinaus gilt ihm mein besonderer Dank dafür, daß er mir die Chance gab, ein
Thema, das nur ganzheitlich betrachtet werden kann, zu bearbeiten und meine Dissertation
erfolgreich zu beenden. Ich hoffe, daß wir die gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren
fortführen können. Mein Dank gebührt ferner der Vorsitzenden der Promotionskommission,
Frau Prof. Dr. Ulrike Stopka, sowie Herrn Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky und Herrn Prof.
Dr. Klaus-Peter Kistner, die sich als Gutachter zur Verfügung stellten, für ihre wertvollen
Anregungen.
Herr Prof. Dr. 0. Rentz, der mich bereits während meines Studiums des Wirtschaftsingeni
eurwesens an der Universität Karlsruhe (TH) mit der Signalflußanalyse und der Laplace
Transformation vertraut gemacht hat, und Herr Prof. Dr. H. Dittrich weckten in mir die Be
geisterung für die Systemtheorie und die Kybernetik.
Die Dissertation profitierte von der sehr guten Lehrstuhlatmosphäre. In dieser Hinsicht gilt
mein Dank allen Kollegen am Lehrstuhl ftir Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Verkehrs
betriebslehre und Logistik, an der Fakultät ftir Verkehrswissenschaften "Friedrich List" der
Technischen Universität Dresden. Genannt seinen hier Herr Dipl.-Volksw. Roberto Fuster
und Herr Dipl.-Volksw. Hans-Joachim Schramm. Ihnen verdanke ich zahlreiche inhaltliche
Anregungen. Bedanken möchte ich mich auch bei den studentischen Hilfskräften und der Se
kretärin unseres Lehrstuhls. Besonders herzlich danke ich Frau Dipl.-Verk.-wirtsch. Kirsten
Bünemann. Durch ihre Unterstützung in der entscheidenden Phase der Dissertation hat sie
maßgeblich zum Erfolg dieser Arbeit beigetragen.
Von ganzem Herzen danke ich meiner Familie, insbesondere meinen Eltern, die mich wäh
rend der Promotionszeit in vielerlei Hinsicht unterstützten, und meinen Freunden, die mich
durch die Höhen und Tiefen während der Erstellung meiner Dissertation begleitet und mir
Rückhalt und Zuversicht gegeben haben. Ihnen und meinem zu früh verstorbenen Freund
Frank Paulsen widme ich diese Arbeit.
Jan R. Westphal
Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XV
Abkürzungsverzeichnis XIX
Kapitell Einführung in die Problemstellung
1.1 Komplexitätsmanagement als Gestaltungsaufgabe 1
1.1.1 Der Wandel der Absatzmärkte als Herausforderung an traditionelle
Produktionssysteme
1.1.2 Die Beherrschung der Komplexität als Herausforderung 2
1.1.2.1 Grenzen der zentralen Produktionslenkung 6
1.1.2.2 Gestaltung einer zukunftsorientierten Organisationsstruktur 8
1.1.2.3 Paradigmenwechsel von der Funktions-zur Systemorientierung 10
1.1.2.4 Anforderungen an einen neuen Gestaltungsansatz 11
1.1.2.5 Theoretische Grundlagen eines systemorientierten Gestaltungsansatzes 14
1.2 Zielsetzung und Aufbau dieser Arbeit 16
1.2.1 Zielsetzung der Arbeit 16
1.2.2 Thesen der Dissertation 18
1.2.3 Aufbau der Arbeit 21
Kapitel2 Problemstellung und theoretische Grundlagen
2.1 Traditionelle Verfahren der Produktionsplanung und -steuerung 25
2.1.1 Begriffund Inhalt der Produktionsplanung und -Steuerung 25
2.1.2 Entwicklung traditioneller PPS-Systeme 27
2.1.2.1 Tayloristisch geprägte Organisationsstrukturen 27
2.1.2.2 Philosophie und Aufbau traditioneller PPS-Systeme 29
2.1.2.2.1 Datenverwaltung 30
2.1.2.2.2 Produktionsprogrammplanung 31
2.1.2.2.3 Primärbedarfsplanung 31
2.1.2.2.4 Materialbedarfsplanung 32
2.1.2.2.5 Kapazitätsplanung 32
2.1.2.2.6 Schnittstelle zwischen Produktionsplanung und -Steuerung 35
2.1.2.2. 7 Produktionssteuerung 35
X Inhaltsverzeichnis
2.1.3 Schwachstellen traditioneller PPS-Systeme 36
2.1.3.1 Das Problem der Philosophie traditioneller PPS-Systeme 36
2.1.3.2 Problembereich Komplexitätsverständnis 41
2.1.3.3 Fehlende Integration der Sach-und der Formalzielebene 43
2.1.3.4 Problembereich Berücksichtigung der Organisationsstruktur 44
2.1.3.5 Das Dynamikdefizit traditioneller PPS-Systeme 45
2.1.3.6 Defizite traditioneller PPS-Systeme aus der Perspektive der Logistik 46
2.1.3.7 Das offene Entscheidungsfeld 47
2.1.3.8 Problem Strukturgleichheit der Abbildung der Systeme im Modell 49
2.1.4 Weitere Ansätze zur Produktionsplanung und -steuerung 52
2.1.4.1 Hierarchische PPS-Systeme 52
2.1.4.2 Die Belastungsorientierte Auftragsfreigabe 52
2.1.4.3 Optimized Production Technology 55
2.1.4.4 Weitere Ansätze 57
2.2 Kybernetische Grundlagen 59
2.2.1 Die systemorientierte Betrachtungsweise 59
2.2.2 Systembetrachtung des Leistungssystems 61
2.2.3 Die Black-Box-Methode als Gestaltungsansatz 63
2.2.4 Traditionelle und systemische Denkansätze 66
2.2.5 Die zielgerichtete Beeinflussung des Systemverhaltens unter Anwendung
kybernetischer Prinzipien 68
2.2.6 Komplexität und Varietät 74
2.2.6.1 Begriff, Ursachen und Symptome der Komplexität 74
2.2.6.2 Die Komponenten der Komplexität 77
2.2.6.3 Das Gesetz der erforderlichen Varietät 81
2.2. 7 Notwendigkeit der Handhabung der Komplexität 84
2.2.8 Die Schaffung von Ordnung als Ziel des Varietätsengineering 87
2.2.9 Eignung der Systemtheorie zur Handhabung der Komplexität 90
2.2.1 0 Anpassung des Zielsystems des Unternehmens 91
2.2.10.1 Zielgrößen der Kundennähe im Leistungsprogramm 92
2.2.10.2 Zielgrößen der Effizienz des Leistungserstellungsprozesses 95