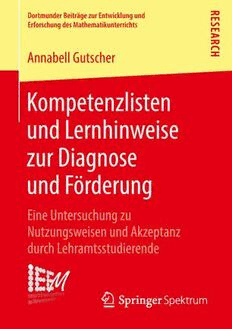Table Of ContentDortmunder Beiträge zur Entwicklung und
Erforschung des Mathematikunterrichts
Annabell Gutscher
Kompetenzlisten
und Lernhinweise
zur Diagnose
und Förderung
Eine Untersuchung zu
Nutzungsweisen und Akzeptanz
durch Lehramtsstudierende
Dortmunder Beiträge zur Entwicklung
und Erforschung des Mathematik
unterrichts
Band 34
Reihe herausgegeben von
S. Hußmann,
M. Nührenbörger,
S. Prediger,
C. Selter,
Dortmund, Deutschland
Eines der zentralen Anliegen der Entwicklung und Erforschung des Mathematik
unterrichts stellt die Verbindung von konstruktiven Entwicklungsarbeiten und
rekonstruktiven empirischen Analysen der Besonderheiten, Voraussetzungen und
Strukturen von Lehr und Lernprozessen dar. Dieses Wechselspiel findet Ausdruck
in der sorgsamen Konzeption von mathematischen Aufgabenformaten und Unter
richtsszenarien und der genauen Analyse dadurch initiierter Lernprozesse.
Die Reihe „Dortmunder Beiträge zur Entwicklung und Erforschung des Mathe
matikunterrichts“ trägt dazu bei, ausgewählte Themen und Charakteristika des
Lehrens und Lernens von Mathematik – von der Kita bis zur Hochschule – unter
theoretisch vielfältigen Perspektiven besser zu verstehen.
Reihe herausgegeben von
Prof. Dr. Stephan Hußmann,
Prof. Dr. Marcus Nührenbörger,
Prof. Dr. Susanne Prediger,
Prof. Dr. Christoph Selter,
Technische Universität Dortmund, Deutschland
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/12458
Annabell Gutscher
Kompetenzlisten
und Lernhinweise
zur Diagnose
und Förderung
Eine Untersuchung zu
Nutzungsweisen und Akzeptanz
durch Lehramtsstudierende
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Christoph Selter
Annabell Gutscher
Technische Universität Dortmund
Fakultät für Mathematik, IEEM
Dortmund, Deutschland
Dissertation Technische Universität Dortmund, Fakultät für Mathematik, 2017
Tag der Disputation: 11.09.2017
Erstgutachter: Prof. Dr. Christoph Selter
Zweitgutachter: Prof. Dr. Bernd Wollring
Dortmunder Beiträge zur Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts
ISBN 9783658212797 ISBN 9783658212803 (eBook)
https://doi.org/10.1007/9783658212803
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Springer Spektrum
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen und MarkenschutzGesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: AbrahamLincolnStr. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Geleitwort
Vor dem Hintergrund einer großen Heterogenität unter den Schülerinnen und
Schülern haben die Leitprinzipien der Diagnose und individuellen Förderung in
den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung in den bildungspolitischen, didak-
tischen und professionstheoretischen Diskussionen und Entwicklungsbemühun-
gen gewonnen.
Studien in der Unterrichtsforschung haben darüber hinaus gezeigt, dass Lehr-
und Lernprozesse dann effektiv und nachhaltig gestaltet werden können, wenn
sie an individuelle Lernstände der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und diese
adaptiv weiterentwickeln. Dies gilt gleichermaßen für das Lernen leistungsstär-
kerer und -schwächerer Schülerinnen und Schüler.
Die große Bedeutung der diagnostischen Kompetenz von Lehrerinnen und
Lehrern sowie einer Handlungskompetenz im Bereich individueller Förderung
für ein erfolgreiches Lernen im Unterricht wurde zudem vielfach durch Profes-
sions- und Unterrichtsforschung empirisch belegt.
Aus diesen Gründen wird das Themenfeld Diagnose und individuelle För-
derung auch in den Vorgaben für die Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen
als eine zentrale Aufgabe hervorgehoben. Die Umsetzung dieses Themas in kon-
kreten Lehrveranstaltungen wird zwar in zunehmendem Maße realisiert; über die
Wirksamkeit und Lernförderlichkeit dieser Veranstaltungen liegen jedoch so gut
wie keine empirischen Ergebnisse vor.
Das betrifft einerseits die Teile des Studiums, in denen die Studierenden
Diagnose und Förderung erlernen und in Praktika erproben, andererseits insbe-
sondere auch die Studienelemente, in denen sie Diagnose und Förderung erleben,
in denen sie also nicht diejenigen sind, die Kompetenzen von Lernenden diagnos-
tizieren und fördern, sondern in denen ihre eigenen Kompetenzen diagnostiziert
und gefördert werden.
In diese Lücke stößt die Arbeit von Annabell Gutscher, die in diesem Sinne
Unterstützungsangebote für Studierende für die Erstsemester-Veranstaltung
‚Arithmetik und ihre Didaktik’ in sehr erfindungsreicher und engagierter Weise
entwickelt und die Wirksamkeit von ausgewählten Angeboten empirisch erfasst
hat. Im Zentrum der Arbeit steht die Untersuchung des Nutzungsverhaltens sowie
der Akzeptanz der Studierenden in Bezug auf zwei Unterstützungsangebote, näm-
lich die Kompetenzlisten und die damit verbundenen Lernhinweise. Dabei ist es
Frau Gutscher gelungen, aus der Vielzahl der vorliegenden Daten diejenigen aus-
zuwählen, deren Analyse zu interessanten, weil für die konzeptionelle Weiterent-
wicklung und die konkrete Ausgestaltung hilfreichen Resultaten führt.
Die Arbeit überzeugt insgesamt durch die gedankliche Schärfe, mit der die
themenspezifische Literatur nicht nur analysiert, sondern in ein kohärentes Ge-
dankengebäude überführt wird, aus dem schlüssige Forschungsfragen abgeleitet
VI Geleitwort
werden. Die Analysen stechen durch eine saubere Aufarbeitung der Daten und
eine sehr gut nachvollziehbare Darstellung der Resultate hervor. Besondere
Beachtung verdient die eigenständige, kreative Entwicklungsarbeit in der Ent-
wicklung der Unterstützungsangebote, die die Grundlage der Analysen bilden.
Prof. Dr. Christoph Selter
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei den vielen Personen bedanken, die mich
beim Erarbeiten und Verfassen meiner Dissertation unterstützt haben.
Besonderer Dank gebührt Prof. Dr. ChristophSelter, der mich als Doktorvater
während des gesamten Prozesses begleitet hat. Er hat mich durch zahlreiche fach-
liche Gespräche, Ratschläge und Anmerkungen unterstützt und mir dennoch den
Freiraum gelassen, meine eigenen Vorstellungen und Ideen einzubringen. Zu
einem angenehmen und produktiven Arbeitsklima trug nicht zuletzt bei, dass
Christoph das ‚Miteinander’ großschreibt.
Auch Prof. Dr. Bernd Wollring, der die Rolle des Zweitgutachters übernahm,
möchte ich für die gewinnbringenden Gespräche und Anregungen danken. Er
zeigte sich stets interessiert an meiner Arbeit und nahm sich Zeit, wo und wann
er konnte, um mit mir über diese zu sprechen.
Ebenso möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen am IEEM und vor
allem der AG-Selter danken. In unserer Arbeitsgruppe habe ich mich immer gut
aufgehoben gefühlt und wusste, dass ich mich auf meine Kolleginnen und Kolle-
gen verlassen kann. Besonders die vielen fachlichen Diskussionen sowie die kon-
struktive Zusammenarbeit weiß ich nicht nur sehr zu schätzen, sie haben auch
maßgeblich zum Gelingen meiner Promotion beigetragen. Insbesondere muss ich
mich bei denen bedanken, die meine Arbeit so ausdauernd Korrektur gelesen ha-
ben. Hier sind auch einige aus dem Kreise meiner Familie und Freunde involviert
gewesen.
Für ihre Expertise und Unterstützung im Bereich der Statistik möchte ich zu-
dem Dr. Henrike Weinert danken. Sie stand mir bei allen statistischen Fragen be-
ratend zur Seite und unterstützte mich auch, wenn SPSS mal wieder nicht das tat,
was ich gerne wollte.
Ebenfalls möchte ich meinen Dank Thomas Rohkämper aussprechen. Seine
technische Unterstützung machte es möglich, dass das Online-Portal, in dem die
hier untersuchten Kompetenzlisten eingebettet waren, nach meinen Vorstellungen
gestaltet werden konnten.
Zu guter Letzt möchte ich meinem Ehemann Tommi dafür danken, dass er –
vor allem in der Endphase – ein einsilbiges, in die Arbeit vertieftes, so gut wie
nur noch im Arbeitszimmer anzutreffendes Wesen ertragen, seine Nahrungs-
mittelversorgung sichergestellt und immer ein offenes Ohr für es gehabt hat.
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort ........................................................................................................... V
Danksagung .................................................................................................... VII
Abbildungsverzeichnis .................................................................................. XIII
Tabellenverzeichnis ......................................................................................... XV
Diagrammverzeichnis ................................................................................... XIX
Einleitung ............................................................................................................ 1
1 Pädagogische Diagnostik ........................................................................... 3
1.1 Definition und Merkmale .................................................................. 3
1.2 Dimensionen von Diagnostik ............................................................. 9
1.3 Quantitativ-produktorientierte Diagnosen .................................... 16
1 .3.1 Noten und Klassenarbeiten ........................................................ 17
1 .3.2 Standardisierte Verfahren ........................................................... 21
1.4 Qualitativ-prozessorientierte Diagnosen ....................................... 23
1.4.1 Lernprozesse wahrnehmen und transparent beurteilen..............24
1 .4.2 Lernende einbeziehen – Selbstgesteuertes Lernen anregen ....... 29
2 Prozessorientierte Diagnostik in der Schule .......................................... 37
2.1 Kontinuierliche Standortbestimmungen ....................................... 38
2.2 (Selbst-)Diagnose- und Rückmeldebögen ...................................... 41
2.3 Leistungen zeitlich flexibel überprüfen ......................................... 46
2.4 Dialogische Diagnose.......................................................................49
2.5 Reflexion über Lernverhalten und Selbstregulation .................... 52
2.6 Leistungen transparent und differenziert prüfen ......................... 53
3 Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften ...................................... 57
3.1 Konzeptualisierungen ...................................................................... 57
3.1.1 Professionelle Kompetenzen ...................................................... 57
3 .1.2 Diagnostische Fähigkeiten.........................................................62
3.2 Empirische Befunde ......................................................................... 68
3.2.1 Fachliche und fachdidaktische Kompetenzen ............................ 69
3 .2.2 Diagnostische Fähigkeiten ......................................................... 73
3.2.3 Zusammenfassung ...................................................................... 76
3.3 Ansätze zur Verbesserung der Lehrerausbildung ......................... 78
3.3.1 Förderung fachlicher und fachdidaktischer Kompetenzen ........ 79
3 .3.2 Förderung diagnostischer Fähigkeiten ....................................... 86
3.3.3 Zusammenfassung ...................................................................... 93
X Inhaltsverzeichnis
4 Untersuchungsdesign ............................................................................... 95
4.1 Rahmenbedingungen ....................................................................... 95
4.1.1 Situation in der Veranstaltung ‚AriDid’ ..................................... 96
4 .1.2 Einsatz von Kompetenzlisten und Lernhinweisen ................... 104
4.2 Ziele der Untersuchung und Forschungsfragen ........................... 113
4.2.1 Nutzungsverhalten .................................................................... 114
4 .2.2 Akzeptanz ................................................................................. 116
4.2.3 Zusammenhänge ....................................................................... 117
4.3 Datengewinnung und Auswertung ................................................ 119
4.3.1 Nutzungsverhalten ................................................................... 120
4 .3.2 Akzeptanz ................................................................................ 128
4.3.3 Zusammenhänge ...................................................................... 134
4.3.4 Ergänzende qualitative Interviews ........................................... 135
5 Ergebnisse zum Nutzungsverhalten ..................................................... 139
5.1 Bearbeitungshäufigkeit ................................................................. 140
5.1.1 Kompetenzlistenbezogene Auswertung ................................... 141
5 .1.2 Studierendenbezogene Auswertung ......................................... 145
5.1.3 Zusammenführung der Ergebnisse .......................................... 151
5.2 Kommentarhäufigkeit ................................................................... 152
5.2.1 Kompetenzlistenbezogene Auswertung ................................... 153
5 .2.2 Studierendenbezogene Auswertung ......................................... 166
5.2.3 Zusammenführung der Ergebnisse .......................................... 168
5.3 Art der Kommentare ..................................................................... 169
5.3.1 Kompetenzlistenbezogene Auswertung ................................... 170
5 .3.2 Studierendenbezogene Auswertung ......................................... 180
5.3.3 Zusammenführung der Ergebnisse .......................................... 183
5.4 Zusammenhänge zwischen den Nutzungsweisen ........................ 185
5.5 Zusammenfassung und Diskussion .............................................. 191
6 Ergebnisse zur Akzeptanz ..................................................................... 197
6.1 Einschätzung des Einflusses auf den Lernprozess ...................... 198
6.1.1 Kompetenzlisten ...................................................................... 198
6 .1.2 Lernhinweise ............................................................................ 212
6.2 Begleitung der Materialien ............................................................ 220
6.2.1 Kompetenzlisten ...................................................................... 220
6 .2.2 Lernhinweise ............................................................................ 223
6.3 Zusammenfassung und Diskussion .............................................. 224
7 Zusammenhänge zwischen den betrachteten Aspekten ..................... 229
7.1 Leistungen und Nutzungsverhalten ............................................. 230
7.1.1 Nutzungsaspekt N1 – Bearbeitungshäufigkeit ......................... 231
7 .1.2 Nutzungsaspekt N2 – Kommentarhäufigkeit ........................... 233