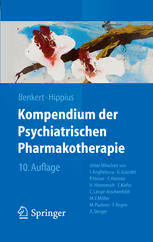Table Of ContentKompendium der
Psychiatrischen Pharmakotherapie
Otto Benkert
Hanns Hippius
Kompendium der
Psychiatrischen
Pharmakotherapie
10., vollständig überarbeitete
und aktualisierte Auflage 2014
Mit 8 Abbildungen
Unter Mitarbeit von
I.-G. Anghelescu, G. Gründer, P. Heiser,
C. Hiemke, H. Himmerich, F. Kiefer, C. Lange-
Asschenfeldt, M. J. Müller, M. Paulzen, F. Regen,
A. Steiger
123
Prof. Dr. med. O. Benkert Prof. Dr. med. F. Kiefer
Mainz Mannheim
Prof. Dr. med. H. Hippius PD Dr. med. C. Lange-Asschenfeldt
München Düsseldorf
Prof. Dr. med. I.-G. Anghelescu Prof. Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-Psych.
Liebenburg M. J. Müller
Marburg/Gießen
Prof. Dr. med. G. Gründer
Aachen Dr. med., Dipl.-Kfm. M. Paulzen
Aachen
Prof. Dr. med. P. Heiser
Nordhausen/Freiburg Dr. med. Francesca Regen
Berlin
Prof. Dr. rer. nat. C. Hiemke
Mainz Prof. Dr. med. A. Steiger
München
Prof. Dr. med. H. Himmerich
Leipzig
ISBN-978-3-642-54768-3 ISBN 978-3-642-54769-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-54769-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbib-
liografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Medizin
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesonde-
re die der Über setzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen
und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf ande-
ren Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur aus-
zugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen
dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen
des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in
der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwider-
handlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen
kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom
jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit
überprüft werden.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berech-
tigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären
und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Planung: Renate Scheddin, Heidelberg
Projektmanagement: Renate Schulz, Heidelberg
Lektorat: Karin Dembowsky, München
Projektkoordination: Heidemarie Wolter, Heidelberg
Umschlaggestaltung: deblik Berlin
Fotonachweis Umschlag: © Dieter Krieg »ohne Titel (Magnolie)«, Acryl/Leinwand, 1999
Herstellung: Fotosatz-Service Köhler GmbH – Reinhold Schöberl, Würzburg
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Medizin ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
www.springer.com
V
Vorwort
Das Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie liegt jetzt in
der 10. Auflage vor. Es ist in der Nachfolge der Psychiatrischen Phar-
makotherapie, die von 1974–1996 in weiteren sechs Auflagen erschie-
nenen ist, geschrieben worden.
Das Kompendium fasst die Kenntnis der klinischen Praxis und
der psychopharmakologischen Wissenschaft in einem kompakten,
zuverlässigen und aktuellen Leitfaden zusammen. Die Aktualität
wird durch die regelmäßig im Zwei-Jahres-Rhythmus erscheinende
Neuauflage sowie durch frei zugängliche Psychopharmaka-News
(www.kompendium-news.de) gesichert. Dem Leser wird parallel dazu
die Gelegenheit geboten, sich sehr schnell über den neuesten Stand zu
den einzelnen Präparaten im Pocket Guide – Psychopharmaka von A
bis Z mit eigenen Bewertungsschwerpunkten für die Praxis zu infor-
mieren.
Es ist unser Ziel, das gesicherte Wissen ausgewogen in das Kompendi-
um einzubringen. Neue Ergebnisse werden gesichtet, kritisch hinter-
fragt und sorgfältig aufgearbeitet. Daraus ergibt sich oft eine Wertung
möglicher Therapiestrategien. Mit unserem Bewertungsvorgehen ste-
hen wir zum Prinzip der evidenzbasierten Medizin. Efficacy-Studien
haben für uns einen hohen Stellenwert, die klinische Erfahrung geht
aber immer mit in die endgültige Empfehlung ein. Grundlegende Ab-
weichungen von den jeweils aktuellen Leitlinien werden vermerkt. Um
den Prozess der Bewertung für den Leser nachvollziehbar zu machen,
werden auch in dieser Auflage, wie schon in der letzten, ak tuelle
Studien der letzten 2 Jahre zitiert, die für die psychiatrische Pharmako-
therapie richtungweisend sein können.
Die Off-label-Anwendung von Psychopharmaka nimmt einen brei-
ten Raum ein. Wir bemühen uns, auf wissenschaftliche und klinisch
bedeutsame Erkenntnisse bei der Indikation von Psychopharmaka,
auch ohne Zulassung, frühzeitig aufmerksam zu machen. Durch
Kennzeichnung des Zulassungsstatus im 7 Präparateteil kann der
Leser die Indikationen und Dosierungen genau zuordnen. Auf eine
noch fehlende Zulassung bei wichtigen Indikationen und auf neue
Indikationen, die durch erste Studienergebnisse angedeutet werden
oder schon begründet sind, wird hingewiesen. Auch die Nutzenbe-
VI Vorwort
wertung von Psychopharmaka durch staatliche Institute wird zitiert
und diskutiert.
Die ausführliche Darstellung der Interaktionen von Psychopharmaka
bleibt weiterhin ein Schwerpunkt des Buches. Im 7 Präparateteil finden
sich zu jedem Psychopharmakon alle wichtigen Wechselwirkungen mit
klinischer Relevanz. Die Verweise auf die entsprechenden Tabellen im
Anhang erlauben es, alle wichtigen CYP-Enzym-Aktivitäten bei Kom-
binationen von Psychopharmaka zu erfassen. Neben der Tabelle der
Induktoren und Inhibitoren der CYP-Enzyme (7 Anhang INT) findet
sich jetzt neu auch die Tabelle der Substrate der CYP-Enzyme (7 An-
hang SUB) im Anhang. Darüber hinaus kann durch die Lektüre sowohl
der Leseanweisung zu den Interaktionen als auch des Abschnitts 7 16.3
das Verständnis zu den Arzneimittelwechselwirkungen sehr erleichtert
werden. Unser Ziel ist es weiterhin, dem Leser einen Rahmen vorzuge-
ben, der ihm kenntlich macht, wo die Risiken bei einer Kombinations-
therapie beginnen. Es gibt in vielen Fällen risikoärmere Kombinatio-
nen, die durch unser Informationssystem leicht erkennbar sind. Jedem
Arzt bleibt es natürlich vorbehalten, den von uns empfohlenen Rah-
men zu akzeptieren oder die Grenzen für sich weiter zu stecken.
Dies gilt grundsätzlich auch für alle anderen Empfehlungen dieses Bu-
ches, z. B. die Routineuntersuchungen. Die vorgeschlagenen Untersu-
chungen und Zeitpunkte bieten auf der Grundlage der vorhandenen
wissenschaftlichen Unterlagen den besten Schutz vor Risiken. Eine
Wunschvorstellung bleibt zurzeit noch die oftmals empfohlene Kom-
binationstherapie von Pharmakotherapie und Psychotherapie. Das Für
und Wider wird im Kompendium sorgfältig ausgelotet, sodass sich der
behandelnde Arzt mit diesem Wissen den örtlichen Realitäten der psy-
chotherapeutischen Versorgung besser anpassen kann.
Neu wurden wichtige Elemente des US-amerikanischen Diagnosesys-
tems DSM-5 in die Indikationskapitel integriert, dabei bleiben die be-
kannten Diagnosen nach dem Klassifikationssystem psychischer Stö-
rungen ICD-10 deutlich erkennbar. Erst nach Erscheinen der im
deutschsprachigen Raum dann gültigen ICD-11 etwa 2015 wird ent-
schieden sein, welche Begriffe und Neuordnungen aus dem DSM-5
übernommen werden. Aber schon jetzt zeichnen sich durch die Über-
nahme einiger Änderungen bessere Ordnungsstrukturen in unseren
10 Medikamentenkapiteln ab, und neue Forschungspotenziale tun sich
auf. So ist etwa an die neue Gruppe der »Störungen durch schwere Be-
lastungen und Stress« in 7 Kap. 1 die Erwartung geknüpft, dass zukünf-
Vorwort VII
tig die pharmakotherapeutische Forschung auch bei stressbedingten
Depressionen intensiviert wird. Das Gleiche gilt für die neue Diagnose
»Verhaltenssüchte« in 7 Kap. 7. In 7 Kap. 3 sind nun die »schizoaffekti-
ven Störungen« eindeutig den schizophrenen Störungen zugeordnet.
Die neue Diagnose »Substanz-/arzneimittelinduzierte Störung« schließt
jeweils die Indikationsliste für die Medikamentengruppen ab; damit
können psychische Störungen, die durch Arzneimittel verursacht wer-
den, in jedem Kapitel an der gleichen Stelle aufgefunden werden (neben
einer Übersichtstabelle in 7 Kap. 12). Und um schließlich ein letztes
Beispiel zu nennen: Die Entwicklungsstörungen, die bis in das Erwach-
senenalter hineinreichen, fanden sich bisher in verschiedenen Kapiteln.
Sie sind jetzt, entsprechend den DSM-5-Vorgaben, in 7 Kap. 10 unter
»Medikamente zur Behandlung von ADHS und anderen Entwicklungsstö-
rungen« zusammengefasst. Die Neuerungen wurden behutsam ausge-
wählt. Nicht übernommen wurde zum jetzigen Zeitpunkt z. B. der Aus-
tausch des Begriffs »Demenz« gegen »kognitive Störungen«. Die Ände-
rung wäre zu einschneidend gewesen, sodass die abschließende Emp-
fehlung der ICD-11-Kommission abgewartet werden soll.
Es werden jetzt neu die Informationen zu den Risiken im Alter und bei
internistischen Krankheiten in Kapitel 13 jeweils den Präparaten in den
Kapiteln 1–10 zugeordnet. Damit lassen sich die Informationen zu dem
einzelnen Präparat immer an der gleichen Stelle abrufen. In 7 Kap. 13
verbleiben die allgemeinen Hinweise und Übersichtstabellen zu diesen
Themen. Dazu passt auch, dass die Intoxikationen durch Psychophar-
maka unter der Rubrik »Nebenwirkungen und Intoxikationen« bei
jedem Präparat an der gleichen Stelle zu finden sind.
Die Schwangerschaftsrisiken sind neu sowohl für die einzelnen Präpa-
rate als auch für die Psychopharmakagruppen in 7 Kap. 14 zusammen-
gefasst.
Neben dem Sachverzeichnis gibt es jetzt neu ein Präparateverzeichnis.
Hier werden alle Handelsnamen, auch die aus Österreich und der
Schweiz, dem entsprechenden Wirkstoff zugeordnet.
Weitere Änderungen sind in der 7 Leseanw eisung aufgeführt.
Das Vorwort der Jubiläumsausgabe vor 10 Jahren galt einer Rückschau
auf 30 Jahre psychiatrische Pharmakotherapie (www.ottobenkert.de). In
den vergangenen 10 Jahren hat die Grundlagenforschung weitere ver-
lockende Hypothesen generiert, die aber den klinischen Alltag nicht
VIII Vorwort
verändert haben. Innovative Psychopharmaka, die die psychiatrische
Therapie wesentlich bereichert hätten, kamen nicht auf den Markt. Der
Zeitraum war primär geprägt von wichtigen Erkenntnissen zu uner-
wünschten Wirkungen und Wechselwirkungen von Psychopharmaka.
Diese nebenwirkungsorientierte Psychopharmakotherapie ist auch ein
wichtiger Grund für den sprunghaften Volumenanstieg dieser Auflage
des Kompendiums. Geprägt wurde die wissenschaftliche und öffentli-
che Diskussion in den letzten Jahren auch durch Metaanalysen, die
gängige Psychopharmakotherapien infrage stellten. Diese Publikatio-
nen wurden hier und in den KompendiumNews besprochen. Methodi-
sche Unklarheiten, wie etwa bei der Metaanalyse über die Wirksamkeit
von Antidepressiva, konnten dann aber oft erst in einem zweiten
Schritt erkannt werden, nachdem die Patienten bereits verunsichert
waren. »Psychopharmaka im Widerstreit« bleibt weiter ein öffentliches
Thema.
Die Psychiatrie steht im Schnittpunkt von Geistes- und Naturwissen-
schaften und zunehmend auch der Technikwissenschaften. Das ist ein
Gewinn für die Therapie in der Psychiatrie. Es ist zu hoffen, dass in
den nächsten Jahren neue praktische Therapieebenen zusätzlich auch
durch die digitale Revolution entwickelt werden. Die Herausforde-
rung für die psychiatrische Pharmakotherapie bleibt aber das wir-
kungsstärkere Arzneimittel mit deutlich geringeren Neben- und
Wechselwirkungen. Wenn dieser Schritt erreicht ist, verlieren fragli-
che Metaanalysen und methodische Diskussionen automatisch an
Bedeutung.
Für die Treue zu nunmehr 40 Jahren Psychiatrischer Pharmakotherapie
bedanken wir uns bei unseren Lesern sehr. Wir hoffen, dass wir mit den
Aktualisierungen, den Neuerungen und den regelmäßigen Kompen-
diumNews weiterhin den Standard bei der Verordnung von Psycho-
pharmaka vorgeben können. Eine weitere Gelegenheit zur Vertiefung
des Wissens in unserem Fachgebiet wird dem Leser durch das Hand-
buch der Psychopharmakotherapie (Gründer/Benkert, Hrsg., 2. Auflage,
2012) gegeben.
In das Kompendium ist das Wissen, die Erfahrung und die sorgfältige
Bewertung neuer wissenschaftlicher Befunde aller Koautoren einge-
gangen; ohne ihre Arbeit hätte auch diese Neuauflage nicht entstehen
können. Es gilt nicht nur ihnen mein großer Dank, sondern auch der
früheren Mitarbeit von E. Davids, C. Fehr, O. Möller, A. Szegedi, I.
Vernaleken und H. Wetzel. Für die Überarbeitung der neurologischen
Vorwort IX
Abschnitte »Restless-Legs-Syndrom« und »Tic-Störungen« danke ich
F. Weber, MPI für Psychiatrie, München. Schließlich hätte diese Auf-
lage ohne die wertvolle Lektoratsarbeit von Karin Dembowsky nicht
erscheinen können.
Auf dem Cover dieser Auflage ist die Arbeit »ohne Titel (Magnolie)«,
Acryl/Leinwand, 1999 von Dieter Krieg abgebildet.
Otto Benkert
Mainz, im Herbst 2014
X Leseanweisung
Leseanweisung
4 Die Kapiteleinteilung richtet sich primär nach den Psychophar-
maka der großen Substanzgruppen (7 Kap. 1–10). Am Ende des
Buches folgen weitere wichtige Kapitel der psychiatrischen Phar-
makotherapie (7 Kap. 11–16).
4 Die 7 Kap. 1–4 und 7 Kap. 6 (Antidepressiva, Medikamente zur
Behandlung bipolarer affektiver Störungen, Antipsychotika, An-
xiolytika, Antidementiva) sind einheitlich gegliedert: Nach Über-
sichtsdarstellungen im jeweils ersten, allgemeinen Teil werden im
zweiten Teil die einzelnen Präparate beschrieben. In 7 Kap. 5
(Medikamente zur Behandlung der Schlafstörungen) wird diese
Gliederung auch für Hypnotika eingehalten. 7 Kap. 7 (Medika-
mente zur Behandlung von Abhängigkeit und Entzugssyndro-
men) ist im allgemeinen Teil nach den einzelnen Suchtmitteln
g eordnet. In den 7 Kap. 8–10 und in 7 Kap. 5 (außer bei den
H ypnotika) geben die Diagnosen die Ordnungsstruktur vor.
4 Die Wirkstoffe sind im Text kursiv und die Handelsnamen in
Normalschrift gedruckt.
4 Die Beschreibung der Präparate folgt immer der gleichen
Systematik:
5 Die Auflistung der Handelspräparate unter Einschluss der
Generika erfolgt in den farbig unterlegten Textboxen. Die
Darreichungsformen werden in der Regel nur für das zugelas-
sene Präparat des Erstanbieters beschrieben. Generika-Ange-
bote mit zusätzlichen Dosierungen werden jeweils in einer
Fußnote genannt. Die einzelnen Darreichungsformen sind der
Fachinformation zu entnehmen.
5 Die Handelsnamen mit ihren Dosierungen und Darreichungs-
formen sowie ihrem Zulassungsstatus sind der neuesten Roten
bzw. Gelben Liste und den aktuellen Fachinformationen ent-
nommen. Es wurden alle bis zum Sommer 2014 neu einge-
führten Präparate berücksichtigt. Die Handelsnamen in
Ö sterreich und der Schweiz, soweit sie eigene Bezeichnungen
haben, sind in das Sachverzeichnis mit aufgenommen. Für die
Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.
5 Für die Hauptindikation ist der Zielbereich der Plasmakon-
zentration (mittlere Plasmakonzentrationen bei therapeuti-
schen Dosierungen im Steady State) bei den meisten Psycho-
pharmaka mit einem hochgestellten p gekennzeichnet, wenn