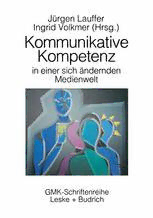Table Of ContentKommunikative Kompetenz
in einer sich verändernden Medienwelt
Schriftenreihe der Gesellschaft für Medien und
Kommunikationskultur in der Bundesrepublik e. V.
Band 9
Dieses Buch ist Dieter Baacke gewidmet,
der durch sein engagiertes Wirken die deutsche
Medienpädagogik maßgeblich geprägt hat.
Jürgen Lauffer/lngrid Volkmer (Hrsg.)
Kommunikati ve
Kompetenz in einer
sich verändernden
Medienwelt
Leske + Budrich, Opladen 1995
ISBN 978-3-663-01405-8 ISBN 978-3-663-01404-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-01404-1
© 1995 by Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zu
stimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Ver
vielfaltigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Über Dieter Baacke 9
Vorwort 13
Schule und Bildung
Bodo Brücher
Der Film als Mittel der Massenkommunikation in der
NS-Jugenderziehung 17
Andrea Frank
Gesprächig, doch nicht geschwätzig. Findet die Wissenschaft
einen Weg aus ihrer Selbstversponnenheit? 28
MaxFuchs
Kommunikative Kompetenz und Kulturelle Bildung 40
Norbert Meder
Didaktische Überlegungen zu einem veränderten Unterricht
durch den Einsatz neuer Technologien 48
Erich Schäfer
Kommunikationskultur als Medium der Transformation
durch Weiterbildung 64
Wolfg ang Schill
Wieso, weshalb, warum 'fernsehen' lernen? Skizzen
zum medienpädagogischen Handeln in der Grundschule 77
OUo Seydel
"Du Hurensohn!" Oder: wenn Blicke töten könnten 90
Gerhard Tulodziecki
Innovative Möglichkeiten einer handlungsorientierten
Medienpädagogik für die Schule 95
Neue Medienrealitäten
IngridHamm
Bildungszukunft heißt Medienorientierung 109
Kai-Uwe Hugger/Claudia Wegener
Infotainment: Chancen und Risiken eines TV- Trends 120
Heinz-Werner Poelchau
Psychobiologie und Medien 132
Franz-Josef Röll
Navigieren im Medienraum 147
Bernd Schorb
Medienkompetenz in Europa. Die vielfältigen
und unterschiedlichen Wege, dahin zu gelangen 166
Ingrid Volkmer
Von der Medienpädagogik zur Media-Literacy:
Kommunikative Kompetenz in einer internationalen Medienwelt 179
Dieter Wiedemann
Medienkompeten im Multimedia-Zeitalter 186
Mediale Kultur
Rainer Dollase
Der respektlose Umgang mit der Wirklichkeit -Eine aktuelle
Pathologie der Überbewertung von Sprache oder:
Das Carl-Einstein-Syndrom 199
Wilfried Ferchhojf/Sven Kommer
Trends zu wittern, ist auch ein Trend. Zeichen der Zeit:
Marginalien zur Trendforschung 211
Wolfg ang Heydrich
Nachträgliches zur Kompetenz 223
Rainer Jogschieß
Informationsfarbe Pink. 235
Anke Martiny
Die Bewertung kommunikativer Kompetenz in
geschlechtsspezifischer Sicht 243
Dorothee Meister
"Medien welten sind überall -oder was haben Massenmedien
und (Ent -)Differenzierungsprozesse mit jugendlichen
Migrantinnen und Migranten zu tun?" 254
Klaus-Peter Treumann
Betrachtungen und Befunde zur medialen Kinderkultur
aus einem Forschungsprojekt 270
Kommunikative Praxis
Jürgen Lauffer
Kommunikative Kompetenz als Verbandsziel: Der Mediennutzer
im Mittelpunkt. Zehn Jahre medienpädagogische Verbandsarbeit 287
Georg PolsterlWolfgang Wunden
Die APO fordert Sendezeit. Studienrevolte im Mediennetz 295
Horst Schäfer
Standards mit Variationen. Medienpädagogische Blockseminare
der Universität Bielefeld im Zeitraum 1985 - 1995 313
Über Dieter Baacke
Bei den "Nürnberger Gesprächen", die ich 1965 begründete - mit dem er
sten Schwerpunktthema "Haltungen und Fehlhaltungen in Deutschland" -
gehörte Dieter Baacke als Jahrgang 1934 zu der jüngeren Generation; von
den Älteren, die als Pädagogen, Kulturkritiker, Philosophen, Historiker
überwogen, freundlich akzeptiert; von den Jüngeren -vor allem 1968 (Trau
keinem über dreißig!) -leicht skeptisch beäugt: War er doch einer der Ver
ständnisvollen, "Integrierten", die bei Dialektik die Synthesis nicht miß
achteten. Damals hielt sein pädagogischer "Lehrmeister" Hartrnut von
Hentig in Nürnberg die bedeutsame Rede: "Die große Beschwichtigung".
U.a. stellte er fest: "Der Konflikt mit der Jugend hat so lange keine Aus
sicht, gelöst zu werden, wie die Wissenschaft nicht gesellschaftlich wird."
Könne man es nicht dahin bringen, daß den Studenten ihre eigene Politik
Spaß mache? "Das wäre keine Beschwichtigung, sondern das Gegenteil: es
nähme ihren Plänen und Taten den Zug der bleichen Verzweifelung, es
gäbe ihnen Mut, es noch einmal im Ernst mit dem Gegner aufzunehmen -
nicht nur mit Wasserwerfern. Auch die Gewalt, mit der so unbeherrscht
auf die Provokation geantwortet wird, ist ein Stück Beschwichtigung; sie
behauptet, das Problem liege dort auf der Straße und bei den Steinwürfen.
Von Anbeginn behaupten die Studenten, daß es dort nicht liegt, sondern
allenfalls sichtbar wird. Und damit haben sie fraglos recht."
In dieser "Stimmungslage" lernten wir uns kennen und schätzen; und
seitdem habe ich von Dieter Baacke viel gelernt: als einem, der mit großem
Einfühlungsvermögen und bei stets klar bezogener Position Wissenschaft
gesellschaftlich gemacht hat, der die Herausforderung der Modernität mit
Neugier annahm (vor allem in ihrer jugendkulturellen Ausprägung) und
falschen Beschwichtigungen mit "heiterem Zweifel" ("bleiche Verzweife
lung" meidend) entgegentrat.
Beim "Nürnberger Gespräch" 1969 ("Teilhabe. Kommunikation und
Partizipation in unserer Gesellschaft") referierte er über die "Sprache des
Gesprächs". "Zu Schwierigkeiten in der Kommunikation" hieß der Unterti
tel. Das hatte einen aktuellen Anlaß (ein Jahr zuvor hatten wir beim
"Nürnberger Gespräch" die Thematik "Opposition" aufgegriffen): "Die
Verständigungsschranken zwischen 'rechts' und 'links' und 'liberal' (ver
kürzende Formeln, die kaum treffen; nur das Faschistische ist in der Um
gangssprache statisch-eindeutig) sind erheblich genug, daß man fragen
kann, ob das 'Gespräch' - ein Wort, das wie 'Begegnung' einem pädagogi-
9
schen Extentialismus der frühen fünfziger Jahre angehört, als das 'exi
stierende Betroffensein' noch die einigende Verständigungsbasis aller
Gruppen zu sein schien - heute nicht eine Fiktion ist." Neue Entwürfe der
Kommunikation sollten von alten Erfahrungen profitieren, und dabei helfe
die Analyse von Kommunikationsstrukturen, Fehler zu vermeiden. Wenn
auch die große Rede derzeit nicht möglich sei, so doch die kleine Rede als
Gespräch unter wenigen, oder die projektbezogene Rede, die Begrenzung
und Eindeutigkeit an einer konkreten Aufgabe finde. "So verlockend und
unaufgebbar die große Geste des Rhetors ist als phantasiesimmulierende
Kraft, so nützlich ist die Untersuchung ihrer Effektivität vor allem in Hin
sicht auf ihre Verständlichkeit. Wir erproben, was wir reden, wenn wir
wissen, was wir bewirken können."
In Baackes Beitrag war schon angelegt, was er dann im Laufe seiner
wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeit aufgefächert, vertieft, weiter
entwickelt hat, nämlich eine Theorie und Praxis kommunikativer Kompe
tenz zu schaffen, die der Wissenschaft einen Weg aus ihrer Selbstverspon
nenheit zu weisen vermag. In ihrem Geburtstagsbeitrag "Gespräch, doch
nicht geschwätzig. Findet die Wissenschaft einen Weg aus ihrer Selbstver
sponnenheit?" nennt Andrea Frank im Anschluß an Odo Marquard das ei
gentliche Problem der wissenschaftlichen (Aus-)bildung "Kommunika
tionsinkompetenzkompensationsinkompetenz". In der Wissenschaft kom
me es eben nicht zu allererst darauf an, wahre Sätze zu produzieren,
sondern darauf, mit der Unterscheidung "wahr - unwahr" umgehen zu
können. "In der wissenschaftlichen (Aus-)Bildung kommt es dann ent
sprechend darauf an, Unterscheidungsfähigkeit zu erwerben."
Um nochmals auf das Nürnberger Gespräch zurückzukommen (was
naheliegend ist: seitdem besteht unsere Verbundenheit über Distanz - denn
sehr oft treffen wir uns nicht!): Ich habe Dieter Baackes "Unterschei
dungsfähigkeit" damals zum ersten Mal und und mit großem Gewinn
kennengelernt: Er schrieb in der "Neuen Sammlung" (Juli/August 1969)
die fundierteste Analyse der "Nürnberger Gespräche 1965 bis 1969", die
ihm, darüber hinausgreifend, zu einer "Didaktik der Kommunikation auf
öffentlichen Kongressen" geriet. Die Maxime, daß Verstand und rechter
Sinn mit wenig Kunst sich selbst vertrügen, gelte kaum für uns Deutsche.
Zwischen Szylla der Fachsprache oder doch zumindest angestrengter
Begrifflichkeit und der Charybdis planer Banalität finde sich nur mit Mühe
ein Weg. "Gemeinverständlich ist ebenfalls die BILD-Zeitung oder der Po
litagitator in seinen Wahlreden - beide um den Preis der gewollten oder
ungewollten Wahrheit. Der sogenannte Intellektuelle, der sich redlich um
Erkenntnis und Aufklärung bemüht, bekommt dieses Dilemma zu spüren:
wenn er sich seinesgleichen verständlich macht, muß er auf die Wirkung
auch außen - und das heißt auch: auf die politische Wirkung - meist ver-
10
zichten (erst über seine Publicity in den Massenmedien kann er indirekt
Zugang zur Bevölkerung finden). " Karl Markus Michel habe dies in sei
nen Essays über die "sprachlose Intelligenz" gemeint: Nicht, daß ihr Wör
ter und Sätze fehlten, sondern daß sie bei uns auf keinen common sense
der Allgemeinheit rekurrieren könne, führe dazu, daß sie unverständlich
und einflußlos bliebe.
Dieter Baacke hat durch viele Vorträge, Artikel und Bücher sich als ein
gleichermaßen verständlicher wie einflußreicher Navigator im Medien
raum (Franz losef Röll) erwiesen. Weil er selbst überzeugend common
sense vertritt, erreicht er auch -soweit dies in einer weitgehend geist-losen
Gesellschaft möglich ist - eine Beförderung des common purpose. Und er
hat mit seiner universitären Tätigkeit viele inspiriert, sich seinerseits um
kommunikative Kompetenz zu mühen; die Beiträge dieses Bandes -ihm zu
Ehren - beweisen es. Vor allem gilt es, Gewalt in und durch Sprache zu
verhindern; durch Worte Verkrustungen aufzubrechen, im Diskurs er
starrte Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, im Gespräch die Freude am
anderen zu entwickeln.
Nun hat er, der lunggebliebene, das Datum seines gewichtigen runden
Geburtstages erreicht; mit Befriedigung wird er feststellen können (dieser
Geburtstagsband hält es fest), daß er keineswegs zur "sprachlosen Intelli
genz" gehört, sondern seine pädagogischen und wissenschaftlichen Bemü
hungen erfolgreich gewesen sind. Der dialektische Prozeß zwischen Indi
vidiuum und Gesellschaft sei, so Erich Schäfer (in Übernahme einer Defi
nition von P.L. Bergerff. Luckmann), durch die drei Elemente der Exter
nalisierung, Objektivation und Internalisierung gekennzeichnet; das heißt:
"Gesellschaft ist menschliches Produkt, Gesellschaft ist objektive Wirk
lichkeit und der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt. Die wechselsei
tige Hereinnahme des Individuellen in die Gesellschaft und des Gesell
schaftlichen in das Individuum verweist auf die gegenseitige Bedingtheit
gesellschaftlicher und individueller Entwicklung." Die durch Sachbezo
genheit artikulierten Glückwünsche dieses Bandes gelten dem Individuum
Dieter Baacke - einem Zoon politikon; der Verfassungspatriotismus kann
sich freuen.
Hermann Glaser
11