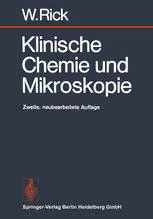Table Of ContentW.Rick
Klinische Chemie und
Mikroskopie
Eine Einführung
Zweite, neu bearbeitete Auflage
Mit 56 Abbildungen
davon 13 Farbtafeln
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
Professor Dr. Wirnt Rick, Klinisch-chemische Abteilung
der I. Medizinischen Universitätsklinik, 4000 Düsseldorf,
Moorenstraße 5
ISBN 978-3-540-06481-7 ISBN 978-3-662-00723-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-00723-5
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des
Nachdruckes"der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähn
lichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Bei Vervielfältigungen für gewerbliche Zwecke ist gemäß § 54 UrhG eine Vergütung an den Verlag zu
zahlen, deren Höhe mit dem Verlag zu vereinbaren ist.
Library of Congress Catalog Card Number 73-14473
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1972 and 1973
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York in 1973
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch
ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen-und Marken
schutz-Gesetzgebung als trei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürtten.
Herstellung der Farbtatein: Konrad Triltsch, Graphischer Betrieb, 87 Würzburg.
Otfsetdruck und Bindearbeiten: Julius Beltz, Hemsbach/Bergstr.
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Unerwartet schnell ist eine Neuauflage dieser Einführung in die Klinische Chemie
und Mikroskopie notwendig geworden. Auf Grund der positiven Aufnahme des Buches
sind Auswahl und Anordnung des Stoffes unverändert geblieben. Die in den einzelnen
Fachgebieten erzielten Fortschritte wurden - soweit sie Einfluß auf die Arbeit im
Laboratorium haben - bei der Überarbeitung und Ergänzung der entsprechenden Ab
schnitte berücksichtigt.
Da die Diskussionen über die Einführung der von DYBKAER und JpRGENSEN vor
geschlagenen Dimensionen zwischen den beteiligten Disziplinen noch nicht mit der
allgemeinen Annahme verbindlicher Empfehlungen abgeschlossen werden konnten,
sind die Dimensionen der quantitativen Analysenergebnisse nicht geändert worden.
Auch an dieser Stelle möchte ich allen, die an der Abfassung der zweiten Auflage
beteiligt waren, für ihre Mitarbeit danken. Zahlreichen Fachkollegen verdanke ich
Ratschläge und Hinweise. Bei der Neubearbeitung des Abschnittes Hämostaseologie
hat Herr Dr. H. Trobisch außerordentlich wertvolle Hilfe geleistet.
Düsseldorf, 10. 8. 1973 W. Rick
VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE
Der vorliegende Leitfaden der klinischen Chemie und Mikroskopie ist aus den Unter
lagen entstanden, die wir unseren Studenten seit Jahren als Grundlage zum Kurs der
klinischen Chemie zur Verfügung stellen. Ziel dieses Kurses ist es, den Teilneh
mern ein dauerhaftes Grundgerüst der Laboratoriumsmedizin zu vermitteln. Da die
Mehrzahl der Kollegen später in der Praxis Laboratoriumsuntersuchungen ausführt
bzw. ausführen läßt, ist auch eine angemessene praktische Ausbildung auf den ver
schiedenen Gebieten erforderlich. Nur der Arzt, der neben den theoretischen Grund
lagen auch die Methodik beherrscht, wird in der Lage sein, seine Mitarbeiterinnen
richtig anzuleiten.
Bei dem außerordentlichen Umfang des Fachgebietes stellt die unumgängliche Be
grenzung des Stoffs ein besonderes Problem dar. Jede Stoffauswahl wird zwar in ge
wissen Grenzen subjektiv sein; die seit 1964 gesammelten Erfahrungen haben jedoch
gezeigt, daß es zweckmäßig ist, die einzelnen Methodengruppen entsprechend ihrer
Bedeutung für die ärztliche Tätigkeit zu behandeln. Die wichtigsten Untersuchungen,
die sich meist auch zur Notfalldiagnostik eignen, sind daher in Form eingehender
Arbeitsanleitungen beschrieben. Es ist erforderlich, daß der Student mit den Analy
senprinzipien und der praktischen Ausführung vertraut wird und die Ergebnisse rich
tig zu bewerten lernt. Zu dieser Gruppe von Methoden zählen z. B. die hämatologi
schen Untersuchungen, insbesondere die Differenzierung von Blutausstrichen, sowie
die Ermittlung von Enzymaktivitäten. Bei einer weiteren Gruppe von Untersuchungen
reicht die zur Verfügung stehende Zeit nicht aus, um die Verfahrenstechnik sicher
zu erlernen. Es werden daher nur die Grundlagen der Analytik, nicht aber eingehen
de Vorschriften mitg~teilt, zumal die Methodik bisher nicht standardisiert ist. Der
Student muß jedoch in der Lage sein, die Qualität der Ausführung zu beurteilen und
die Ergebnisse zu interpretieren. Als Beispiel sei die elektrophoretische Trennung
der Serumproteine genannt.
Wenn der Kursteilnehmer an einigen, aber wesentlichen Beispielen gelernt hat,
exakt zu arbeiten, die Ergebnisse kritisch zu interpretieren und Fehlerquellen zu
berücksichtigen, wird er in der Lage sein, auf diesem Grundgerüst weiter aufzu
bauen und auch neue methodische Vorschriften selbständig zu überprüfen, anstatt
sie kritiklos hinzunehmen.
Für Aufbau und Einteilung des Stoffs waren didaktische Überlegungen ausschlag
gebend. Soweit es das Verständnis der diagnostischen Maßnahmen erleichtert, sind
die pathophysiologischen Zusammenhänge erwähnt. Bei der Auswahl der Analysen
prinzipien wurden nur tatsächlich bewährte Verfahren beschrieben. In den Abschnit
ten Hämatologie, Hämostaseologie, Säure-Basen-Haushalt, Liquor u. a. sind Hin
weise zur Diagnostik gegeben, da die pathologischen Befunde sich im Zusammen
hang mit definierten Symptomen bzw. Krankheitsbildern leichter einprägen lassen.
- VITI -
In der klinischen Chemie wurden vor allem allgemeine Gesichtspunkte zur Analytik,
zur Meßtechnik und zur Auswertung der Meßergebnisse erörtert und Störungen sowie
Fehlerquellen berücksichtigt; wegen der Vielfalt der diagnostischen Aussagemöglich
keiten würden Anleitungen zur Interpretation den Rahmen der Darstellung sprengen.
Als Interpretationshilfe dienen bei den klinisch-chemischen Verfahren Angaben zu
den Normbereichen. Dabei sind teils selbsterstellte, teils aus der Literatur über
nommene Bereiche angegeben. Die vielfach geäußerte Forderung, jedes Laborato
rium solle seine eigenen Normbereiche erarbeiten, ist - vor allem wegen der
Schwierigkeit, Probanden der verschiedenen Altersklassen in ausreichender Zahl
zu untersuchen - illusorisch. Da es noch erheblicher Anstrengungen bedarf, bis
Normbereiche verbindlich angegeben werden können, müssen manche der Angaben
als vorläufig betrachtet werden. Die bisher üblichen Dimensionen der quantitativen
Analysenergebnisse wurden zunächst beibehalten, da auch die Autoren der übrigen
deutschsprachigen Lehrbücher bisher den Vorschlägen von DYBKAER und J~RGEN
SEN nicht gefolgt sind. Hier dürfte eine Absprache zwischen den zuständigen wissen
schaftlichen Fachgesellschaften erforderlich sein.
Es ist verständlich, daß die Ergebnisse von Laboratoriumsuntersuchungen nur dann
sinnvoll zur Diagnostik und zur Verlaufskontrolle herangezogen werden können, wenn
eine klare Fragestellung vorliegt, wenn die Bedingungen bei der Probenahme, der
Arbeitsgang und die Störungen der Methodik berücksichtigt werden, wenn die Zuver
lässigkeit und die Aussagemöglichkeiten der gemessenen Kenngrößen bekannt sind
und wenn die Ergebnisse richtig beurteilt werden. Bei der Interpretation sind zwei
entgegengesetzte, nicht angemessene Betrachtungsweisen zu vermeiden: Einerseits
die nicht seltene Zahlengläubigkeit, andererseits die Verdrängung eines nicht zum
klinischen Bild passenden Befundes. Nur durch eigene praktische Arbeit, durch stän
digen Vergleich der Laboratoriumsergebnisse mit dem klinischen Bild und durch
langjährige Erfahrung ist es möglich, die Grundsätze einer richtigen, aber auch kri
tischen Bewertung zu erlernen. Das vorliegende Buch soll die Voraussetzungen hier
für verbessern helfen.
Herrn Prof. Dr. H. Begemann, München, bin ich für die Erlaubnis, Abbildungen
aus seinem Atlas der klinischen Hämatologie und Cytologie zu übernehmen, zu be
sonderem Dank verpflichtet. Herrn Prof. Dr. L. R6ka, Gießen, danke ich vielmals
für die Durchsicht des Abschnitts Hämostaseologie, Herrn Prof. Dr. Hj. Becker,
Frankfurt (Main), für wertvolle Hinweise zum Abschnitt Hämatologie, Herrn Dr. H.
Netheler, Hamburg, für die Überlassung von Abbildungen zur Photometrie, Herrn
Dr. Ü. Kling, überkochen, für wichtige Ratschläge zur klinischen Chemie, Herrn
W. Wilms und Herrn J. Scheunemann, Krefeld, für die Durchsicht des Abschnitts
über den Säure-Basen-Haushalt. Herrn R. Greiner, Düsseldorf, verdanke ich die
technische Ausführung der schematischen Darstellungen. Frl. M. Hockeborn, Düs
seldorf, war an der Ausarbeitung entscheidend beteiligt und fertigte die druckreife
Reinschrift des Manuskripts an; Herr Dr. W. -Po Fritsch, Frau Dr. G. Grün, Herr
Dr. Th. Sc holten, Frau A. Egen, Herr cand. med. H. -G. Weiste und Herr cand.
med. J. Müller, Düsseldorf, unterstützten die Arbeit tatkräftig. Von der Planung
an bestand eine außerordentlich erfreuliche Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr.
W. Geinitz und den Mitarbeitern des Springer-Verlags, insbesondere Frau Th.
Deigmöller. Ihnen allen danke ich für ihre intensiven Bemühungen.
Düsseldorf, 29. 7. 1972 W. Rick
INHALT SÜB ERSIC HT
Seite
Voraussetzungen zur Erzielung zuverlässiger Untersuchungsergebnisse
Vorbereitung des Patienten . . . . . . . . . . . . . .. 1
Gewinnung und Kennzeichnung des Untersuchungsmaterials . 2
Aufbewahrung und Transport der Proben 5
Analytik im Laboratorium 6
Übermittlung der Ergebnisse . . . . . 8
HÄMATOLOGIE
Corpusculäre Bestandteile des Blutes. . . . . . . . 11
Entwicklung der corpusculären Bestandteile des Blutes 12
Granulocyten 13
Erythrocyten . . . . . . . 15
Lymphocyten ... . . . . 15
Celluläre Immunreaktionen 17
Humorale Immunreaktionen . 18
Monocyten ......... 18
Thrombocyten . . . . . . . . 18
Hämatologische Untersuchungsmethoden
Gewinnung von Blut für hämatologische Untersuchungen 19
Leukocyten
Leukocytenzählung . . . . . . . . 21
Leukocytenmorphologie . . . . . . 27
Anfertigung von Blutausstrichen . 27
Färbung von Blutausstrichen . . 29
Differenzieren von Blutausstrichen 30
Reife Leukocyten in panoptisch gefärbten Blutausstrichen 32
Normbereiche der Leukocyten im peripheren Blut. . . . 37
Unreife Vorstufen der Granulocyten in panoptisch gefärbten
Blutausstrichen . . . . . . . . . . . . 38
Spezialunter suchungen
Cytochemische Reaktionen in Leukocyten . 42
Per oxydase ...... . . . . 42
Unspezifische Esterase . . . . . 43
Alkalische Leukocytenphosphatase 43
Glykogen (PAS-Reaktion) . 44
L. E. -Zell-Phänomen . . . . . 45
Erythrocyten
Hämoglobinbestimmung im Vollblut 47
- x -
Seite
Erythrocytenzählung . . . . . . . 50
Hämatokrit . . . . . . . . . . . 55
Hämoglobingehalt der Erythrocyten 57
HbE (MCH) . . . . . . . . . . 57
Volumen bzw. Durchmesser der Erythrocyten . 59
MCV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Mittlere Hämoglobinkonzentration in den Erythrocyten (MCHC) 61
Erythrocytenmorphologie . . . . . . . . . . . . . . . .. 62
Erythrocytenvorstufen in panoptisch gefärbten Blutausstrichen 66
Spezialfärb ungen
HEINZ ' sehe Innenkörper . 69
Siderocyten . . . . . . . 69
Reticulocyten . . . . . . 69
Die wichtigsten Veränderungen des Blutbildes
Reaktive Veränderungen des weißen Blutbildes. . . . . . . . .. 71
Veränderungen der Gesamtzahl der Leukocyten pro {Li Blut. .. 71
Veränderungen der Relation der verschiedenen Leukocytenarten . 71
Linksverschiebung . . . 73
Toxische Granulation . . . 73
Infektiöse Mononucleose 74
Monocytoide Lymphocyten . 74
Leukämien (Leukosen) 74
Einteilung der Leukosen 77
Akute Myelose . . . . . 77
Akute Lymphadenose . . 77
Chronische Lymphadenose 78
Chronische Myelose 78
Anämien . . . . . . . . . . 83
Perniziöse Anämie . . . . 83
Hinweise zur Differentialdiagnose von Anämien 84
Literatur hinweise 86
HÄMOSTASEOLOGIE
Hämostasemechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91
Kurze Übersicht über den Ablauf der an der Hämostase beteilig-
ten Reaktionen ............. 92
Celluläre Komponenten im Gerinnungsablauf
Thrombocyten ............ 93
Plasmatische Komponenten im Gerinnungsablauf
Gerinnungsfördernde Mechanismen 94
Gerinnungshemmende Mechanismen 97
Störungen der Hämostase . . . . . . . . . . 99
Hämostaseologische Untersuchungsmethoden
Verfahren zur Erfassung von Angiopathien
Subaquale Blutungszeit nach MARX . . . . . . . . . .. 100
RUMPEL-LEEDE-Test und Saugglockentest . . . . . .. 100
Verfahren zur Erfassung thrombocytär bedingter hämorrhagischer
Diathesen
Thrombocytenzahl ..... . . . . 101
Beurteilung der Thrombocytenfunktion 105
- XI-
Seite
Verfahren zur Erfassung von Koagulopathien
Untersuchungsmethoden zur Erfassung und Lokalisation von
Störungen im Gerinnungsablauf . . .·.·,;~i1@!ii'i;.~t; • • • • • • 106
Voraussetzungen zur Erzielung zuverlässiger gerinnungs-
physiologischer Untersuchungsergebnisse 107
Globalteste
Gerinnungszeit im Venenblut nach LEE und WmTE . 110
Recalcifizierungszeit im Vollblut nach HOWELL . . 110
Plasma-Recalcifizierungszeit nach Aktivierung mit
Kieselgur . . . . . . . . . . . . 110
Heparin-Recalcifizierungszeit . . . . . . 111
Partielle Thromboplastinzeit (PTT). . . . 111
Thrombelastogramm (TEG) nach HARTERT 112
Phasenteste
Thrombinzeit ............. 115
QUICK-Test (Thromboplastinzeitbestimmung) 115
Partielle Thromboplastinzeit (PTT) . 118
Prothrombinverbrauchstest (PTV) . . . . . 118
Faktor enteste
Bestimmung der Fibrinogenkonzentration im Plasma 119
Chemische Methoden . . . . . 119
Methode nach CLAUS . . . . . . . . . . . . . 119
Hitzefibrinfällung nach SCHULZ . . . . . . . . 120
Beurteilung der verschiedenen Methoden zur Bestim-
mung der Fibrinogenkonzentration im Plasma 120
Quantitative Bestimmung gerinnungsfördernder Faktoren 121
Identifizierung eines Faktorenmangels durch Modifikation
der Partiellen Thromboplastinzeit . . . . . . . . 122
Hemmkörper gegen Gerinnungsfaktoren ........ 123
Untersuchungsmethoden zur Erfassung der fibrinolytischen
Aktivität
Beobachtung der Spontanlyse . . . . . 124
Euglobulin- (Gerinnsel-) Lyse-Zeit . . 124
Thrombelastogramm (TEG) . . . . . 124
Fibrinogenkonzentration im Plasma 125
Methoden zum Nachweis von Fibrin- bzw. Fibrinogenspalt-
produkten .... 126
Thrombinzeit . . . . . . . . 126
Schlangengiftzeit . . . . . . 126
Staphylokokken-Klumpungstest 127
Immunologische Methoden . . 127
Vergleich der verschiedenen Methoden zur Erfassung eines
Fibrinogenmangels und zum Nachweis von Fibrin- bzw.
Fibrinogenspaltprodukten . . . . . . 128
Einsatz hämostaseologischer Untersuchungsmethoden 129
Manifeste hämorrhagische Diathesen 130
Latente hämorrhagische Diathesen . . 130
Antikoagulantientherapie ...... 130
Kontrolle der Therapie mit Heparin 130
Kontrolle der Therapie mit Vitamin K-Antagonisten 131
Verbrauchsreaktion und Verbrauchskoagulopathie 132
Hyperfibrinolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
- XII -
Seite
Notfalldiagnostik bei Verdacht auf Verbrauchskoagulo
pathie und Hyperfibrinolyse
Clot observation test . . . . . . . . . . . . . . 133
Verfahren nach VAN DE LOO . . . . . . . . . . 134
Hämostaseologische Teste zur Diagnostik einer Verbrauchs-
reaktion oder Hyperfibrinolyse . . . . . . . . 135
Fibrinolytische und antifibrinolytische Therapie 135
Zur Frage der Thrombosediagnostik 136
Literaturhinweise 137
KLINISCHE CHEMIE
Richtlinien für die Arbeit im klinisch-chemischen Laboratorium
Chemikalien . . . . . . . . . . . . . . . 141
Standardsubstanzen und Standardlösungen 141
Wasser, Säuren, Laugen, Lösungsmittel u. a. 142
Herstellung von Lösungen 142
Aufbewahrung von Lösungen 143
Haltbarkeit von Lösungen 143
Waagen und Wägungen . . . 144
pH-Meter und ihre Bedienung 144
Glasgeräte . . . . . . . . 145
Kunststoffartikel . . . . . 146
Volumenmeßgeräte . . . . 146
Kalibrierung von Volumenmeßgeräten 148
Vorbereitung des Untersuchungsmaterials 149
Ausführung klinisch-chemischer Bestimmungen. 150
Klinisch-chemische Analytik
Trennverfahren . . . . . . . 153
Quantitative Analysenverfahren 154
Absorptionsphotometrie (Photometrie)
Grundlagen der Absorptionsphotometrie 155
Prinzip der photometrischen Messung 157
LAMBERT-BEER-BOUGUER' sches Gesetz 158
Photometer . . . . . . . 158
Spektralphotometer 159
Spektrallinienphotometer 160
Filterphotometer 161
Colorimeter ... . . 161
Hinweise zur Ausführung photometrischer Messungen 162
Auswertung der Meßergebnisse
Über den spezifischen mikromolaren Extinktionskoefflzienten . 166
Über mitgeführte Standardlösungen . . . . . . . . . . .. 167
Photometrische Bestimmungsverfahren
Photometrische Methoden zur Bestimmung von Metabolitkonzentrationen
Grundlagen der Methodik
Direkte Messung absorbierender Substanzen 169
Messung nach chemischer Umsetzung . 169
Messung nach enzymatischer Umsetzung 170
Berechnung von Metabolitkonzentrationen 172
Diagnostisch wichtige Metabolite