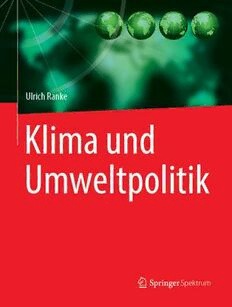Table Of ContentUlrich Ranke
Klima und
Umweltpolitik
Klima und Umweltpolitik
Ulrich Ranke
Klima und
Umweltpolitik
Ulrich Ranke
Fakultät für Geowissenschaften und Geographie
Universität Göttingen
Göttingen, Deutschland
ISBN 978-3-662-56777-7 ISBN 978-3-662-56778-4 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56778-4
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliogra-
fische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Spektrum
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich
vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne
besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-
Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber
übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen
neutral.
Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer
Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany
V
Vorwort
Der Klimawandel ist bereits eingetreten. Er ist nur für kurze Zeit offen stehen. Der Klimawandel
längst eine Tatsache und nicht mehr allein Gegen- ist damit zu einer der größten Herausforderun-
stand wissenschaftlicher Erörterungen einer aus- gen des 21. Jahrhunderts geworden. Und es steht
gewählten Gruppe von Klimaforschern. In den zu befürchten, dass – selbst wenn es gelingt, die
Industriegesellschaften breiten sich Befürchtungen THG-Emissionen drastisch zu reduzieren – die
aus, dass durch den Klimawandel die gewohn- Anpassung an den Klimawandel die Staatenge-
ten gesellschaftlichen Modelle nicht mehr weiter meinschaft vor bisher nicht da gewesene Heraus-
aufrechterhalten werden können. Er ist auch kein forderungen stellen wird. Mit jedem Jahr, das wir
Problem mehr, das sich nur woanders zeigt. Im ungenutzt verstreichen lassen, wird der Kampf
Gegenteil: Er findet jetzt und bei uns statt. gegen den Klimawandel schwieriger und teurer.
Ein Einfaches „weiter so“ ist keine Alternative. Ein
Treibhausgasemissionen erhöhen den CO - Gehalt besonderes Augenmerk liegt dabei auf den soge-
2
in der Atmosphäre, der wiederum dazu führt, nannten „Kippelementen“ des Klimasystems. „Kip-
dass sich die Erdoberfläche stetig erwärmt. Seit pelemente“ stellen Regime und Prozesse dar, die
Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Temperatur an besonders empfindlich auf Klimaveränderungen
der Erdoberfläche im Mittel um 0,8 °C angestie- reagieren. Wenn durch den Klimawandel ein sol-
gen; seit Mitte der 1970er Jahre sogar um etwa ches Element gestört wird, könnte das Klima in
0,2 °C pro Dekade. Und dieser Trend setzt sich einen grundlegend anderen physikalischen Zustand
seitdem ungebremst fort, mit dem Resultat, dass „umkippen“, das heißt, es könnte zu i rreversiblen
mehr als zwei Drittel der Erwärmung der Atmo- Schäden am Klimasystem kommen. Ein solches
sphäre des vergangenen Jahrhunderts seit 1975 „Umkippen“ wird von namhaften Klimaforschern
stattgefunden haben. Auswirkungen dieser Tem- bei einer Fortdauer des Anstiegs von 2–3 °C
peraturerhöhung sind der weltweit feststellbare befürchtet. Sie fordern daher eine „Zwei-Grad-Leit-
Anstieg des Meeresspiegels, die Ausbreitung der planke“ für die Deckelung der THG-Emissionen,
Wüsten und Starkregenereignisse selbst in gemä- um den mittleren globalen Temperaturanstieg auf
ßigten Breiten: Anzeichen, die als Folgen des unter 2 °C gegenüber vorindustriellem Niveau zu
„ Klimawandels“ bezeichnet werden. begrenzen.
Das Klima bestimmt, unter welchen Bedingun- Es wird immer deutlicher, dass der Kampf gegen
gen die Menschheit auf der Erde lebt. Dabei hat den Klimawandel, wie bei allen anderen gren-
die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte durch- züberschreitenden Konflikten, nur durch eine
aus auch von einem sich verändernden Klima Internationalisierung zu erreichen sein wird, in
profitieren können (Ende der Eiszeit in Nord- der alle Länder eingebunden sein müssen. Hier-
europa). Für den Menschen nachteilige Auswir- bei kommt es auf die Industrieländer an, mit
kungen zeigen sich seit dem 19. Jahrhundert mit „gutem“ Beispiel voranzugehen. Ihre Innovations-
der einsetzenden Industrialisierung. Dennoch kraft und Finanzstärke ist aufgerufen, den Beweis
konnten auch erste Erfolge im Kampf gegen die zu führen, dass sich Wohlstand und Klimaschutz
Klimaerwärmung vermeldet werden. Lagen die vereinbaren lassen. Gefunden werden muss ein
CO -Emissionen im Jahr 1970 noch bei 7,9 t pro Lösungsmodell, das einerseits den Schutz des
2
Kopf und Jahr, so hatte sich das Niveau auf 6,4 t Klimas und andererseits eine Anpassung an den
p.c./a im Jahr 2012 reduziert, und das, obwohl in Klimawandel ermöglicht. Nur so wird es möglich
diesem Zeitraum die Weltbevölkerung sich fast werden, sowohl die Ursachen des Klimawandels
verdoppelt und die Industrialisierung, vor allem zu bekämpfen als auch sich besser auf die irrever-
in den Schwellenländern um ein Mehrfaches, siblen Folgen einzustellen. Erfolgreiche Ansätze
zugenommen hat. bestehen, wie die Entkoppelung von Wachstum
und Energieeinsatz, wie sie seit den 1970er Jahren
Die Zunahme der Treibhausgase in der Atmosphäre in den Industrieländern praktiziert wurden. Diese
verändert das Klima mit heute schon gravierenden gilt es auch weltweit umzusetzen. In den Ent-
Folgen. Und die Klimaforscher können nachwei- wicklungsländern müssen vor allem regenerative
sen, dass die Folgen noch dramatischer ausfallen Energieressourcen genutzt, eine weitere Abhol-
werden, wenn wir nicht entschieden handeln, denn zung der Wälder verhindert, die natürlichen
das Zeitfenster, um weiterreichende Schäden für Ressourcen nachhaltiger genutzt und soziale Pro-
Menschen und Ökosysteme zu verhindern, wird gramme aufgelegt werden, die es den Menschen
VI Vorwort
ermöglicht, in ihren traditionellen Lebensformen argumentieren, dass nur sie durch ihren techno-
selbstbestimmt und sicher leben zu können. logischen Fortschritt und ihre Finanzstärke in der
Lage sein werden, Lösungsmodelle für die anste-
Dabei ist anzumerken, dass viele Staaten ange- henden Probleme anzubieten und finanzielle Bei-
sichts ihrer sehr unterschiedlichen Beiträge zu träge zu leisten. Befürchtungen bestehen aufseiten
der weltweiten Klimaerwärmung auch eine unter- der Industrieländer natürlich auch, die den erreich-
schiedliche Verantwortung zur Reduzierung der ten Wohlstand nicht aufgeben wollen.
Emissionen der Treibhausgasemissionen (THGs)
übernehmen müssen. Insbesondere die Tatsache, Wohlstand und Klimaschutz müssen keine
dass die Industrieländer ihre wirtschaftliche und Gegensätze sein. Klimaschutz, so hat Nikolas
soziale Entwicklung zu einem großen Teil der Stern eindrucksvoll nachweisen können, „rech-
Nutzung fossiler Brennstoffe verdanken, weist net sich“. Auch weist er darauf hin, dass der dazu
ihnen – so die einhellige Auffassung der Entwick- notwendige Umbau der Gesellschaften zu einer
lungsländer – die zentrale Verantwortung beim kohlenstoffärmeren Wirtschaft einen kontinu-
Einhalt des Klimawandels zu. Insbesondere die ierlichen Umbau in allen Ländern erfordert, der
Kleinen Inselstaaten haben auf allen Klimakon- eigentlich schon heute beginnen müsste und,
ferenzen immer wieder mit Nachdruck darauf dass dieser neben hohen Investitionsanstrengun-
hingewiesen, dass sie die ersten Opfer des Mee- gen eben auch zu ökonomischen realisierbaren
resspiegelanstiegs sein werden – ja bereits sind – Gewinnen führen wird. Stern weist nach, dass es
und das, obwohl sie nicht einmal 0,1 % der volkswirtschaftlich „billiger“ wird, den Ausstoß
THG-Emissionen zu verantworten haben. Auch an Treibhausgasen zu reduzieren, als die Kos-
die großen „Verschmutzer“ USA, Russland und ten des Klimawandels zu tragen. Dies sei eine
Japan haben zuletzt noch einmal in Paris ihre der Aufgaben der heutigen und der zukünftigen
Bereitschaft zur Reduzierung der THGs, im Generationen, zu denen es keine Alternative gäbe.
Sinne der von den Vereinten Nationen in der Rio-
Deklaration niedergelegten „common but differen- Die internationale Staatengemeinschaft hatte sich
tiated responsibility“, bekräftigt. Schwellenländer im Jahr 2015 in Paris in einem Abkommen ver-
wie China, Indien und Brasilien haben verbind- pflichtet, den globalen Ausstoß an Treibhausgasen
liche Zusagen gemacht, ihre THG-E missionen so weit zu verringern, dass der Temperaturanstieg
deutlich zu verringern. In Paris wurde ver- unter 2 °C gehalten werden kann: ein Wert, der
einbart, den Ausstoß an THG weltweit auf 1 t für das Klima als kritischer Schwellenwert ange-
CO pro Kopf pro Jahr zu begrenzen, um so ein sehen wird. Ein solches völkerrechtlich bindendes
2
Niveau wie vor 150 Jahren aufrechtzuerhalten. Abkommen wäre 30 Jahre zuvor – als die Serie
Es wird gar nicht angestrebt, die CO -Gehalte in an Klimakonferenzen Fahrt aufnahm – von vie-
2
der Atmosphäre zu reduzieren, sondern bis zum len Beobachtern als Illusion abgetan worden. Der
Jahr 2050 erst einmal einen weiteren Anstieg zu Erfolg von Paris macht hingegen deutlich, welche
verhindern. Eine Reduzierung i. e. S. könnte sich politischen Wirkungen von der Internalisierung
danach anschließen. des Kampfes gegen den Klimawandel ausgehen
können. Denn keine der Vertragsparteien konnte
In der Diskussion taucht immer wieder der Begriff und wollte es sich erlauben, als „Klimabrem-
„Klimaschutz“ auf, wobei allerdings noch kein ser“ dazustehen; trotz aller zum Teil erheblichen
Einvernehmen darüber besteht, welches „Klima Differenzen in der Sache – unterschiedlichen
geschützt“ werden soll. Soll es ein Zurück geben, Anteilen am THG-Ausstoß, Unterschiede der
zu dem Klima der vorindustriellen Zeit, soll das wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit oder des Ent-
Klima des Jahres 1900 wiederhergestellt werden, wicklungsbedarfs. Auch wenn alle Seiten ihre
oder das des Jahres 2050 anvisiert werden. Das Verantwortung zum Schutz des Klimas beteuern,
Problem besteht darin, dass jede Partei ihre Sicht- so ist klar, dass mit Paris der eigentliche Kampf
weise auf die politische Agenda setzt: Ein Aus- gegen den Klimawandel erst begonnen hat.
handlungsprozess, der schon mit der Umwelt-/
Klimakonferenz 1992 in Stockholm begonnen Das wichtigste Regime in diesem Kampf ist
wurde. Seit damals forderten die Entwicklungslän- die Klimarahmenkonvention (UNFCCC), die
der das „Recht auf eine nachholende Entwicklung“ seit ihrer Gründung im Jahr 1992 als Folge der
ein. Von den Industrieländern wird der berechtigte Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung
Wunsch der Menschen in den Entwicklungslän- (UNCED) bis zum Jahr 2015 insgesamt 21 Mal
dern, einen höheren Lebensstandard zu erlan- getagt hat. Die Konvention stellt damit in der
gen, grundsätzlich a nerkannt. Die Industrieländer Geschichte der Vereinten Nationen eines der
VII
Vorwort
wirkungsvollsten Foren für den Austausch von eines Gipfels“, das den Vertragsstaaten klar machte,
Ideen, Forderungen und Entscheidungen. Sie dass nur ein Kompromiss in der Sache das Ende
wirkt der in den 1990er Jahren einsetzenden Zer- des Kyoto-Protokolls verhindern konnte. Mit dem
splitterung und Intransparenz der Umwelt- und „Bonner Beschluss“ waren die Voraussetzungen
Klimadiskussion entgegen. für die Ratifikation und Umsetzung des Kyoto-
Protokolls zu schaffen. Gleichzeitig gebührt der
Wenn man die Abfolge der Klimakonferenzen Bonner Klimakonferenz der Verdienst, dass sie
betrachtet, so ist als klares Signal die Bereitschaft den zuletzt stark in die Kritik geratenen internatio-
der Staatengemeinschaft zu erkennen, den Kli- nalen Klimaverhandlungsprozess wiederbelebt hat.
maschutz schrittweise weiter auszugestalten.
Naturgemäß treffen bei solchen fundamentalen Unbestritten positiver Höhepunkt in der Geschichte
Aushandlungsprozessen immer unterschiedliche der Klimarahmenkonvention war die Konferenz
Positionen aufeinander. Die Konferenzen waren im japanischen Kyoto im Dezember 1997. Dort
daher gekennzeichnet durch große Fortschritte, konnte auf der 3. Vertragsstaatenkonferenz ein Pro-
aber auch durch ebenso viele Rückschläge. In den tokoll unterzeichnet werden, das unter dem Namen
Medien gab es daher meist negative Kommen- „ Kyoto-Protokoll“ in die Geschichte eingegangen
tierungen, die sicher auch mit den in der Regel ist. 160 Staaten hatten in Japan erstmals den Schutz
übersteigerten Erwartungen zu tun hatten. Diese der Ozonschicht und eine Reduzierung der anthro-
Erwartungen wurden im Vorfeld zumeist von pogenen Treibhausgasemissionen als völkerrecht-
den Umwelt-Interessengruppen extra hoch ange- lich verbindliches Ziel festgehalten. Des Weiteren
legt, um Druck auf die Verhandlungsparteien konnte man sich darauf verständigen, dass diese
auszuüben; nicht immer mit dem gewünschten Verpflichtung nach dem Prinzip der „gemeinsamen,
Resultat. Folglich wurden später in den Medien aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten aller
die Konferenzen oftmals mit der Überschrift „Kli- Vertragsstaaten auszugestalten sei“.
makonferenz gescheitert“ abqualifiziert. Ein Pro-
blem stellten auch die Abschlusserklärungen der Die Umwelt- und Klimadiskussion war schon
zum Teil nur sehr kurzzeitig an den K onferenzen seit den 1970er-Jahren gekennzeichnet durch
teilnehmenden Politiker dar, die die Probleme eine Vielzahl an Initiativen, die sowohl natio-
eher beschönigten, als klare Positionen zu bezie- nal als auch international in zahllosen Konfe-
hen. Einer der negativen „Höhenpunkte“ war die renzen, Veranstaltungen und Seminaren ihren
15. Vertragsstaatenkonferenz 2009 in Kopenhagen. Ausdruck fanden. Die große Fülle der Probleme
Die Konferenz war geprägt von erheblichen Diffe- und Themen, die seitdem aufgegriffen wur-
renzen, bei denen taktische Manöver oftmals sogar den, war sichtbares Zeichen für die Hoffnung in
mit klaren Drohungen verknüpft wurden. Das den Gesellschaften, den Planeten Erde auch in
Scheitern von Kopenhagen führte dazu, dass sich Zukunft in einem lebenswerten Zustand zu erhal-
die Vertragsparteien im nächsten Jahr in Cancún ten. Um diese Bestrebungen zusammenzuführen,
aufeinander zubewegten und es gelang, das Thema haben die Vereinten Nationen dann 1992 mit der
des Nachfolgeabkommen für das 2012 auslaufende UNCED-Konferenz eine Serie an Konferenzen
Kyoto-Protokoll noch einmal auf die Agenda setz- eingeleitet, in deren Folge es zur Gründung des
ten. Ein solches Scheitern hatte die Konvention International Panel on Climate Change (IPCC) als
schon einmal im Jahr 1999 erleben müssen. Auf Instrument zur Ausarbeitung wissenschaftlicher
der 6. Vertragsstaatenkonferenz in Den Haag soll- Grundlagen gekommen war. Dessen Erkennt-
ten eigentlich weitere Details des Kyoto-Protokolls nisse konnten dann unter der Führung der Ver-
geklärt werden. So vor allem, in welchem Umfang einten Nationen in internationale Umwelt- und
Wälder auf die Reduktionsverpflichtungen von Klimapolitikansätze übertragen werden. Hun-
Kyoto angerechnet werden. Die Konferenz schei- derte von Konferenzen wurden seitdem abgehal-
terte vor allem an der massiven Blockadehaltung ten, die allesamt die politische Agenda nachhaltig
der sogenannten umbrella group (USA, Australien, geprägt haben. Mit der Klimarahmenkonvention,
Kanada, Japan, Russland). Schon während der den Konventionen zur Desertifikation, zur bio-
Vorbereitungskonferenzen wurde klar, dass sich logischen Vielfalt und zum Schutz der Wüsten
der Streit vor allem an dieser Frage festmachen und verschiedenen Protokollen ist die Staaten-
würde. Erst ein Jahr später auf der „Nachfolgekon- gemeinschaft die völkerrechtlich verbindliche
ferenz“ im Sommer 2001 in Bonn konnten die in Verpflichtung eingegangen, ihr soziales und wirt-
Den Haag noch strittigen Fragen einvernehm- schaftliches Handeln dem Schutz der Erde unter-
lich geklärt werden. Wieder war es das „Scheitern zuordnen.
VIII Vorwort
Dieses Buch möchte diesen Bestrebungen Aner- richtet sich vor allen an den mit den Konferenzen
kennung zollen, indem es ihre Ziele und den und ihren Vorbereitungen verbundenem tech-
Weg zu den Abkommen nachzeichnet. Natur- nischen und logistischen Aufwand. Über 20.000
gemäß sind die mehr als hundert Konferen- Konferenzteilnehmer kamen zum Beispiel in Bali
zen, die jeweils eine Vielzahl an Vorkonferenzen zusammen, um letztlich nur noch auf die Minis-
erforderten, im Einzelnen nicht zu dokumen- terentscheidungen zu warten, die dafür nur für
tieren. Es musste daher eine Auswahl getroffen 2–3 Tage angereist waren. Kritisiert wird auch,
werden, die sich auf die Konferenzen der Kli- dass es tausender Wissenschaftler bedarf, um alle
marahmenkonvention, die Wüstenkonvention, zwei Jahre für das IPCC einen Sachstandsbericht
die Konvention zur biologischen Vielfalt, die von mehr als 1000 Seiten zu erstellen. Vor allem
UN- Habitat-Konferenzen sowie die Serie der wird beklagt, dass sich die auf den Konferenzen
Konferenzen zur nachhaltigen Entwicklung kon- vorgenommenen Entscheidungen in der Regel
zentriert. Die Konferenztabelle in 7 Kap. 4 gibt in Absichtserklärungen erschöpfen und ohne
dazu einen Überblick. Natürlich ist eine sol- verifizierbare Wirkungen bleiben. Auch sei der
che Auswahl durchaus subjektiv. Der Autor ist Kenntnisstand zum Klimawandel inzwischen so
aber davon überzeugt, dass er mit dieser Auswahl umfassend, dass er schon heute umfassende poli-
dem Leser einen komprimierten Überblick über tische Umsetzungen rechtfertige. Im Prinzip war
die internationalen Bestrebungen zum Kampf dies auch eine der Begründungen der Kommis-
gegen Klimawandel und zur nachhaltigen Ent- sion für Nachhaltige Entwicklung im Jahr 2012,
wicklung geben kann. Anzumerken ist dabei, dass sich ersatzlos aufzulösen. Zudem halten man-
es für jede dieser Konferenzen im Vorfeld eine che Kritiker den Wissenschaftlern vor, durch das
Serie an Vorkonferenzen gegeben hat, die aber im Aufstellen von Bedrohungsszenarien eine erhöhte
Einzelnen nicht vorgestellt werden. Anzumerken Aufmerksamkeit zu erlangen, die sich zum
ist ferner, dass es im Nachhinein kaum zusam- Beispiel auch in der Höhe der Forschungsmittel
menfassende, die Ergebnisse bewertende Aufar- ablesen lasse. Gelder, die besser für Umsetzungen
beitungen gibt. Das mag auch dem engen Zeittakt in den Entwicklungsländern eingesetzt werden
der Konferenzen (jedes Jahr bzw. alle 2 Jahre) sollten.
geschuldet sein und, dass es sich bei den Teilneh-
mern oftmals um dieselben Akteure gehandelt Solche Kritiken sind sicher nicht unberech-
hat. In der Tat sind alle Konferenzen in Tausen- tigt. Aber, wie eingangs erwähnt, hätte ohne den
den von Seiten durch UNFCCC und die anderen „Konferenztourismus“ und ohne das Engagement
Konventionen ausführlich dokumentiert worden; der Wissenschaftler und Umweltschützer der Kli-
eine Informationsquelle, die aber nicht geeignet maschutz nicht den Stellenwert erhalten, den er
ist (schnell) einen Überblick über die Konferenz- heute in der internationalen Politik hat. Durch
verläufe und -ergebnisse zu erhalten. Des Wei- die vielen Konferenzen wurden in der Tat Szena-
teren haben fast alle Umweltorganisationen vor, rien aufgebaut, denen sich die Politik nicht mehr
während und nach den Konferenzen Stellung- verweigern konnte. Auch haben in der Folge viele
nahmen abgegeben, die von großer Sachkennt- führende Industrieunternehmen ihre Bereitschaft
nis geprägt waren, die aber berechtigterweise die erklärt, ihre Unternehmensstrategien am Umwelt-
Sichtweise der jeweiligen Organisation vertreten. und Klimaschutz auszurichten. Die Wissenschaft
weist zu Recht darauf hin, dass immer noch keine
Das vorliegende Buch versucht, die ausgewähl- umfassenden Kenntnisse über Ursache-Wirkung-
ten Konferenzen unter einem „neutralen“ Sicht- Zusammenhänge im Klimageschehen im Einzel-
winkel zu beschreiben. Die vielen Tausenden an nen vorliegen. Ferner sollte anerkannt werden,
Dokumenten mussten daher einer verkürzen- dass wissenschaftliche Untersuchungen mitunter
den Zusammenfassung unterzogen werden, mit zu „nicht ganz richtigen“ Aussagen führen. Die
dem Ziel, dem interessierten Leser die wesentli- Aufgabe der Wissenschaft ist es, solche „Fehler“
chen Aspekte vorzustellen. Da es dabei trotz allen aufzudecken und diese dann einer kritischen Prü-
Bemühens um Objektivität zu subjektiven Sicht- fung zu unterziehen, wie es der IPCC vor einiger
weisen gekommen sein kann, wird schon im Vor- Zeit vorgenommen hat. Auf jeden Fall sind sie
feld um Verständnis nachgesucht. nicht geeignet, die Klimaforschung als Ganzes
infrage zu stellen. Das Buch plädiert dafür, einer-
In den letzten Jahren wurde wiederholt Kritik seits den Kenntnisstand zum Klimageschehen
an dem exzessiven „Konferenztourismus“ zum konsequent zu erweitern, andererseits die Politik
Umwelt- und Klimaschutz geäußert. Eine Sicht- in Pflicht nehmen, ihre Verantwortung für den
weise, die sicher nicht unbegründet ist. Die Kritik Schutz des Klimas wahrzunehmen, sowohl in den
IX
Vorwort
Industrieländern als auch in den Entwicklungs- Konferenzen der Vereinten Nationen zu
ländern. Klima und Entwicklung. Die Daten stammen
in erster Linie von den offiziellen Informa-
Das Buch möchte den Leser mit dem Stand der tionen der Vereinten Nationen oder von
Diskussion zum Thema „Klimaschutz“ vertraut anderen frei zugänglichen Quellen, wobei das
machen. Es stellt dazu im Buch aber immer das Originalzitat mitliefert.
5 7 Kap. 1 das Themenfeld „Klimawirkungen“ Die Dokumentation zeichnet sich dadurch
vor. Es beschreibt, welche Auswirkungen aus, dass sie frei von eigenen Interessen aus
des Klimawandels heute schon auf der Welt einer „Feder“ stammt; also die Tatbestände in
abzulesen und wie die Gesellschaften davon einer einheitlichen Sprache beschreibt. Dabei
betroffen sind. bemüht sie sich um Objektivität und nimmt
5 7 Kap. 2 stellt die wissenschaftlichen „Grund- auch kontroverse Inhalte bewusst mit auf.
lagen des Klimageschehens“ vor. Ein solch
breites Thema kann im Rahmen dieses Es muss an dieser Stelle betont werden, dass für
Buches nur zusammenfassend behandelt die Zielsetzung des Buches in allen genannten
werden. Es möchte dazu auch keinen eigenen Themenfeldern und Sachdarstellungen eine Aus-
Diskussionsbeitrag leisten, sondern nur die wahl getroffen werden musste, die naturgemäß
Grundlagen für das Verständnis der in den die Sichtweise des Autors wiedergibt. Der Autor
nachfolgenden Kapiteln gegebenen Informati- hat dies in Kauf genommen, um so das schiere
onen zu den politischen Aushandlungsprozes- Ausmaß an Informationen für den Leser verkraft-
sen legen. bar aufzubereiten. Alle Themenfelder sind durch
5 7 Kap. 3 stellt politische, institutionelle und eine Fülle an Originalzitaten belegt und geben
technische Instrumente vor, die derzeit in der so dem Leser die Möglichkeiten, seine Kennt-
Klimaschutzpolitik zur Diskussion zur stehen. nisse gezielt zu vertiefen. Das Buch soll andere
5 7 Kap. 4 ist eine Dokumentation ausgewählter Fachdarstellungen zu dem Thema „Klimaschutz“
Konferenzen zur Klimarahmenkonvention, nicht ersetzen, sondern versteht sich als allgemein
der Konventionen für Biodiversität und zum gehaltene Ergänzung.
Wüstenschutz, zur nachhaltigen Entwicklung,
dem Montrealer Protokoll, den UN- Habitat- Ulrich Ranke
Konferenzen und den zahlreichen Herbst 2018
XI
Inhaltsverzeichnis
1 Klima: Phänomene – Ursachen – Auswirkungen ............................................ 1
1.1 Sozioökonomische Auswirkungen ............................................................... 8
1.1.1 Europa .......................................................................................... 8
1.1.2 USA ............................................................................................. 19
1.1.3 Kleine Inselstaaten .............................................................................. 22
Literatur ........................................................................................ 26
2 Elemente des Klimageschehens .............................................................. 29
2.1 Wetter und Klima ............................................................................... 30
2.2 Treibhausgase .................................................................................. 31
2.2.1 Kohlendioxid .................................................................................... 33
2.2.2 Methan ......................................................................................... 34
2.2.3 Distickstoffoxid .................................................................................. 35
2.2.4 Fluorkohlenwasserstoffe ......................................................................... 36
2.2.5 Ozon ........................................................................................... 37
2.2.6 Wasserdampf ................................................................................... 37
2.2.7 Aerosole ........................................................................................ 38
2.2.8 Saharastaub ..................................................................................... 40
2.3 Der Treibhauseffekt ............................................................................. 40
2.3.1 Der natürliche Treibhauseffekt ................................................................... 40
2.3.2 Der anthropogene Treibhauseffekt ............................................................... 42
2.4 Erderwärmung .................................................................................. 44
2.4.1 Oberflächentemperatur .......................................................................... 44
2.4.2 Kohlenstoff: Senken – Quellen .................................................................... 46
2.4.3 Globale Kohlenstoffbilanz ........................................................................ 56
2.4.4 Klimasensitivität ................................................................................. 57
2.4.5 Kipppunkte im Klimasystem ...................................................................... 58
2.5 Klimaentwicklung in der jüngsten Erdgeschichte ................................................ 62
2.5.1 Geologische Entwicklung ........................................................................ 62
2.5.2 Entwicklung des Klimas in Europa ................................................................ 63
2.6 Klimamodelle – Klimaszenarien ................................................................. 65
2.6.1 Globale Klimamodelle ........................................................................... 68
2.6.2 Regionale Klimamodelle ......................................................................... 70
2.6.3 Klimaszenarien .................................................................................. 75
Literatur ........................................................................................ 81
3 Instrumente, Methoden und Konventionen ................................................. 85
3.1 Allgemeine Vorbemerkung ...................................................................... 86
3.1.1 Konzept der Nachhaltigkeit ...................................................................... 87
3.1.2 Klima- und Armutsmigration ..................................................................... 88
3.1.3 Ressourcen und Ressourcenschutz ............................................................... 90
3.1.4 Green Economy ................................................................................. 94
3.2 Nationale ordnungspolitische Instrumente ...................................................... 96
3.2.1 Vorsorgender Umweltschutz ..................................................................... 96
3.2.2 Nachsorgender Umweltschutz ................................................................... 101
3.3 Ökonomische Anreizsysteme .................................................................... 102
3.3.1 Umweltabgabe .................................................................................. 102
3.3.2 Ökologischer Fußabdruck ........................................................................ 103
3.4 Internationale Organisationen .................................................................. 106
3.4.1 Supranationale Organisationen .................................................................. 106
3.4.2 Internationale Finanzinstitutionen ................................................................ 109
3.4.3 Regionale Entwicklungsbanken .................................................................. 116