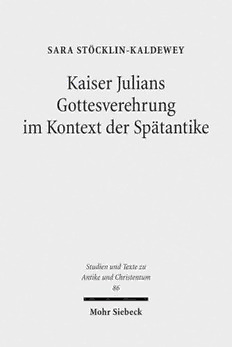Table Of ContentStudien und Texte zu Antike und Christentum
Studies and Texts in Antiquity and Christianity
Herausgeber/Editors
Christoph Markschies(Berlin)
Martin Wallraff(Basel)
Christian Wildberg(Princeton)
Beirat/Advisory Board
Peter Brown(Princeton) · Susanna Elm(Berkeley)
Johannes Hahn(Münster) · Emanuela Prinzivalli(Rom)
Jörg Rüpke(Erfurt)
86
Sara Stöcklin-Kaldewey
Kaiser Julians Gottesverehrung
im Kontext der Spätantike
Mohr Siebeck
Sara Stöcklin-Kaldewey; geboren 1981; 2002–08 Studium der Philosophie und Theologie
an der Universität Basel; 2009–13 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kirchen-
geschichte an der Universität Basel; 2013 Promotion; derzeit Mitarbeiterin Kommunikation
bei der Heilsarmee Schweiz in Bern.
e-ISBN PDF 978-3-16-153247-4
ISBN 978-3-16-153246-7
ISSN 1436-3003 (Studien und Texte zu Antike und Christentum)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de
abrufbar.
© 2014 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags un-
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover-
filmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Buch wurde von Laupp & Göbel in Nehren auf alterungbeständiges Werkdruck papier
gedruckt und von der Buchbinderei Nädele in Nehren gebunden.
Vorwort
Meine 2013 an der Universität Basel eingereichte Dissertation entstand im
Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Projekts
„Julians Gott. Der ‚Apostat‘ Julian und seine Gottesverehrung zwischen
Christentum und Heidentum“ unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Martin
Wallraff. Sie wurde von ebenjenem sowie Herrn Prof. Dr. Stefan Rebenich
(Universität Bern) begutachtet, am 21. Oktober 2013 erfolgreich verteidigt
und wird nun, in Form der vorliegenden Monographie, einem breiteren
wissenschaftlichen Publikum zur Diskussion vorgelegt.
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei denjenigen bedanken, die
mit ihrer Unterstützung zum Gelingen meines Dissertationsprojekts und
zur Veröffentlichung der Studie beigetragen haben.
Der erste und größte Dank sei meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr.
Martin Wallraff (Universität Basel) ausgesprochen. Es gelang ihm schon
während meines Studiums an der Universität Basel, mich für die Spätanti-
ke und die Patristik zu begeistern. Obschon das Thema von ihm angeregt
wurde und einem seiner persönlichen Interessen entsprach, ließ er mir bei
der Erarbeitung und Entwicklung allen Freiraum und respektierte meine
wissenschaftliche Arbeit, ohne es je an Unterstützung und konstruktiver
Kritik fehlen zu lassen. Seine Betreuung, Förderung und sein unermüd-
licher Einsatz in allen akademischen, aber auch administrativen Belangen
waren für mich von unschätzbarem Wert. Die Aufnahme der vorliegenden
Studie in die Reihe „Studien und Texte zu Antike und Christentum“
(STAC) ist seiner Anregung und Fürsprache zu verdanken.
Herrn Prof. Dr. Stefan Rebenich gilt mein Dank für die Übernahme des
Zweigutachtens, seine hilfreichen Anmerkungen und stets wohlwollend
kritischen Fragen in der Anfangsphase der Dissertation.
Darüber hinaus bin ich Florian Wöller zu Dank verpflichtet, mit dem
ich mehrere Jahre lang das Büro teilte. Er war mir nicht nur Motivator und
hilfsbereiter Ansprechpartner im akademischen Alltag, sondern trug we-
sentlich zu der guten Arbeitsatmosphäre bei, die mir und ihm ermöglichte,
unsere Dissertationen erfolgreich (und gleichzeitig) zum Abschluss zu
bringen. Zudem erhielt ich gehaltvolles Feedback von ihm zu meinem
Einleitungskapitel.
VI Vorwort
Da Unterstützung, Zuspruch und Geduld in den verschiedenen Phasen
einer Dissertation nicht nur aus dem akademischen, sondern auch aus dem
privaten Umfeld gefordert ist, sei an dieser Stelle auch meinen Freunden
und meiner Familie gedankt. Insbesondere meine Eltern haben stets ihr
Interesse und ihre Wertschätzung für meine Arbeit zum Ausdruck ge-
bracht. Am meisten aber bin ich Lukas Stöcklin zu Dank verpflichtet, mei-
nem wunderbaren Ehemann, der mich vom ersten Gedanken an eine Dis-
sertation bis hin zum Examen bestärkt, ermutigt, gefördert und gefordert
hat. Er war mir als Germanist und Judaist auch in fachlicher Hinsicht ein
wertvolles Gegenüber und hat grosse Teile des Manuskripts korrekturgele-
sen.
Schließlich danke ich den Herausgebern der Reihe STAC, nebst meinem
Doktorvater Herrn Prof. Dr. Christoph Markschies (Berlin) und Herrn Prof.
Dr. Christian Wildberg (Princeton), sehr für die Aufnahme meiner Disser-
tation in die Reihe STAC. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei
Herrn Dr. Henning Ziebritzki, Frau Nadine Schwemmreiter und Frau
Kendra Sopper vom Verlag Mohr Siebeck (Tübingen) für ihre wertvolle
Unterstützung bei der Drucklegung der Arbeit.
Basel, 1. März 2014 Sara Stöcklin
Inhalt
Inhalt
Vorwort ................................................................................................... V
1. Einleitung .......................................................................................... 1
1.1. Kaiser Julian und seine Gottesverehrung ........................................... 1
1.2. Forschungsgeschichte ........................................................................ 2
1.3. Fragestellung ..................................................................................... 4
1.4. Methodische Probleme ....................................................................... 6
1.4.1. Begriffe und Übersetzungen ..................................................... 6
1.4.2. Thematischer Aufbau ................................................................ 9
1.4.3. Für wen spricht Julian? ........................................................... 10
1.4.4. Literarisches Material ............................................................. 13
1.5. Julians Werke ................................................................................... 15
1.6. Julians geistiges Umfeld ................................................................... 21
1.6.1. Hellenismus ............................................................................ 23
1.6.2. Pagane Kultfrömmigkeit ......................................................... 27
Konventionelle Götterkulte ..................................................... 29
Mysterienkulte ........................................................................ 30
Charakteristika der Spätantike ................................................ 34
1.6.3. Neuplatonische Philosophie .................................................... 36
Der Neuplatonismus des 4. Jahrhunderts ................................. 38
Julians Lehrer und Gefährten .................................................. 41
1.6.4. Christentum ............................................................................ 42
Theologische Auseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts ........ 45
2. Göttliche Zuwendung – menschliche Abhängigkeit ................ 49
2.1. Einleitung ........................................................................................ 49
VIII Inhalt
2.1.1. Die Zuwendung Gottes: Bedürfnis und Notwendigkeit ........... 49
2.1.2. Gnade im frühen Christentum ................................................. 50
2.1.3. Göttliche Zuwendung in der Philosophie und paganen
Religionskultur ....................................................................... 53
2.1.4. Göttliche Zuwendung bei Jamblich ......................................... 56
2.2. Göttliche Zuwendung bei Julian ....................................................... 61
2.2.1. Artikulation der göttlichen Zuwendung ................................... 61
2.2.2. Notwendigkeit der göttlichen Zuwendung ............................... 63
2.2.3. Begründung der göttlichen Zuwendung................................... 67
2.2.4. Individualität der göttlichen Zuwendung ................................. 68
2.3. Wohlwollende Götter? ...................................................................... 70
2.3.1. Die Subjekthaftigkeit der Götter ............................................. 70
2.3.2. Die Rolle der Göttermutter ..................................................... 72
2.3.3. Die Rolle des Helios ............................................................... 75
2.4. Der Inhalt der Zuwendung ............................................................... 78
2.5. Das Bewirken der Zuwendung .......................................................... 80
2.5.1. Kann der Mensch göttliche Zuwendung erwirken? .................. 80
2.5.2. Beinhaltet die göttliche Zuwendung ein bewusstes
Handeln Gottes? ..................................................................... 84
2.5.3. Die Pläne der Götter ............................................................... 87
2.6. Verortung ......................................................................................... 92
2.6.1. Die Abhängigkeit des Menschen von der göttlichen
Zuwendung ............................................................................. 92
2.6.2. Die Zuständigkeit individueller Götter .................................... 95
Die Stellung von Helios .......................................................... 96
2.6.3. Dem Menschen das Mögliche, den Göttern
das Unmögliche .................................................................... 100
Die Wirkweise der noetischen Götter .................................... 100
Die Wirkweise der noerischen Götter ................................... 101
Das Verhältnis von göttlichem und menschlichem Handeln .. 103
3. Göttliche Offenbarung – menschliche Erkenntnis ................. 106
3.1. Einleitung ...................................................................................... 106
3.1.1. Die Selbstmitteilung Gottes als Ausdruck seines Wesens ...... 106
Inhalt IX
3.1.2. Offenbarung als religionsphänomenologische
Beschreibung ........................................................................ 106
3.1.3. Bedeutung des Offenbarungsgedankens für
das Christentum .................................................................... 108
3.1.4. Offenbarungsglaube in der Philosophie und paganen
Religionskultur ..................................................................... 112
3.2. Offenbarung bei Julian ................................................................... 120
3.3. Erkenntnis als Bestimmung und Ziel des Menschen ........................ 123
3.4. Wie wird Erkenntnis erreicht? ........................................................ 127
3.4.1. Erkenntnis durch die κοινὴ ἔννοια ........................................ 127
3.4.2. Notwendigkeit göttlicher Hilfe ............................................. 128
3.5. Wie offenbart sich Gott? ................................................................ 132
3.5.1. Die vorbereitende Funktion hellenistischer Kultur
und παιδεία ........................................................................... 132
3.5.2. Die μῦθοι τελεστικοί als Offenbarungsträger ........................ 139
3.5.3. Göttliche λόγια der Chaldäer ................................................ 146
3.5.4. Weissagung durch Orakel ..................................................... 151
3.6. Offenbarung und Vernunft .............................................................. 157
3.7. Verortung ....................................................................................... 162
3.7.1. Julians Grundannahmen ........................................................ 162
3.7.2. Die Formen göttlicher Offenbarung ...................................... 169
Παιδεία ................................................................................. 171
Mythen ................................................................................. 174
Orakel .................................................................................. 177
3.7.3. Eine vernünftige Offenbarung? ............................................. 181
4. Göttliche Erlösung – menschliche Hoffnung .......................... 184
4.1. Einleitung ...................................................................................... 184
4.1.1. Erlösung als Folge göttlicher Zuwendung und Erkenntnis ..... 184
4.1.2. Heil und Erlösung im Christentum ........................................ 186
Sündhaftigkeit als menschliche Not ...................................... 186
Das Heil in und durch Christus ............................................. 190
4.1.3. Heil und Erlösung in der paganen Religionskultur ................ 192
Heil als individuelle Beachtung und Begleitung .................... 194