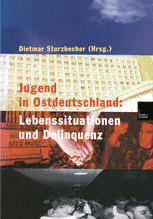Table Of ContentJugend in Ostdeutschland:
Lebenssituationen und Delinquenz
Dietmar Sturzbecher (Hrsg.)
Jugend in Ostdeutschland:
Lebenssituationen und Delinquenz
Leske + Budrich, Opladen 2001
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei Der Deutschen Bibliothek erhältlich
ISBN 978-3-8100-2987-4 ISBN 978-3-322-94985-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-94985-1
© 2001 Leske + Budrich, Opladen
Diese Studie wurde mit Mitteln des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
gefördert.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschlitz!. Jede Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das
gilt insbesondere für VervieWiltigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Jugend zehn Jahre nach der "Wende" In Brandenburg:
Ein Vorwort
Wie sich die Zeiten ändern! Schlug man in meiner Jugendzeit in Ostdeutschland die
Zeitung auf, fand man vielfaltige Anzeichen für eine prächtige Landesjugend. Die
Jugend siegte bei Olympiaden aller Art, erfand planmäßig auf der "Messe der Mei
ster von Morgen" für die Menschheit Wichtiges, kämpfte in Tagebauen und auf
Kartoffeläckern gegen den Winter und Versorgungsengpässe (die es eigentlich nicht
geben durfte) und trat uns zuweilen sogar in Heldengestalt entgegen, denken wir an
den Bau der sibirischen Erdöltrasse. Und heute? Junge Gewalttäter, Extremisten,
Drogenabhängige und Verkehrsrowdies dominieren die Titelseiten der Tagespresse.
Mißtrauisch umfahren die Erwachsenen Ansammlungen herumlungernder 15jähriger
vor der Kaufhalle und atmen auf, wenn der Bauwagen am Dorfrand endlich als neuer
Jugendclub und Treffpunkt akzeptiert wird.
Ist dieses Bild der heutigen Jugend realistisch? Sicher nicht; wenn wir statt in die
Tageszeitungen in die Befunde der Jugendforschung blicken, zeigt sich, daß unser
Bild von der Jugend weitgehend durch die Berichterstattung über die negativ auffäl
ligen Jugendlichen bestimmt wird. Das IFK in Vehlefanz hat 1991, 1993, 1996 und
1999 jeweils über 2.500 brandenburgische Jugendliche nach ihrer Lebenssituation
und ihren Einstellungen gegenüber Gewalt, Ausländern und Rechtsextremismus ge
fragt; die Ergebnisse widersprechen meist den Klischees von der Jugend als Problem.
Zunächst: Die Jugend heute ist wahrscheinlich nicht weniger prosozial oder familien
freundlich eingestellt als vor 10 Jahren! Beispielsweise hat das Lebensziel "Für ande
re dasein, auch wenn man auf etwas verzichten muß" seit 1993 stetig an Bedeutung
gewonnen; eine Familie zu gründen hat nicht an Wertschätzung verloren; politisches
Engagement ist Jugendlichen sogar wieder wichtiger geworden. Ist dies nicht ein
deutliches Signal an Kommunalpolitiker und Parteien, angesichts von Politikfrust
und politischem Extremismus Jugendlichen mehr Möglichkeiten zu politischer Bil
dung und Beteiligung zu bieten? Gegen das Bild einer verantwortungslosen, beque
men Jugend spricht auch, daß es seit 1993 unverändert 96 Prozent der Jugendlichen
für bedeutsam halten, "eine Arbeit zu haben, die erfüllt, in der ich aufgehen kann".
Arbeit und Erwerbstätigkeit schaffen also Identität und soziale Integration. Weniger
akademisch hat es ein arbeitsloser Jugendlicher 1991 ausgedrückt, der wegen krimi
neller Delikte auffällig geworden war: "Früher biste zur Arbeit gegangen, hast'n biß
ehen Geld gekriegt, selbst wenn manche nur mit nen Besen im Betrieb rumgerannt
sind. Aber irgendwo haste dazugehört, hattest irgendwann det Gefühl, du hast Feier
abend und det Recht, ein Bier zu trinken. Det machst de jetzt vormittags um neune,
säufst den Tach weg, und denn drehste durch. Zu Hause intressiert dich ooch nischt
mehr, jetzt, wo de nu Zeit hast". Ausbildungs- und Arbeitsplätze für delinquenzge
fährdete Jugendliche werden nicht dazu führen, daß Gewalt, Kriminalität und
Rechtsextremismus verschwinden; aber die Jugendforschung wie auch die Lebenser
fahrung halten ausgezeichnete Beispiele bereit, wie labile und als "Schulversager"
abgestempelte Jugendliche durch Lehre und Arbeit zu geachteten Mitbürgern wer
den.
5
Auch ein Blick auf die Schule bietet wenig Anlaß zur Panik. Wenn man davon ab
sieht, daß nach der "Wende" der Anteil der schulisch hoch motivierten Jugendlichen
deutlich gesunken ist, gibt es hinsichtlich der Einstellungen zur Schule oder beim
Schuls chwänzen kaum Veränderungen und mit Sicherheit keine Verschlimmerung
der Situation. Das bedeutet nicht, daß an den Schulen bereits alles getan ist! Jugend
liche erfahren am Beispiel ihrer Eltern immer häufiger, daß eine berufliche Qualifi
kation nicht vor Arbeitslosigkeit und finanziellen Einbußen schützt; deshalb werden
die schulischen Inhalte immer kritischer hinterfragt. Jugendliche wollen Dinge ler
nen, die erkennbar die Erfolgschancen im Leben erhöhen. Viele Lerninhalte empfin
den sie als nutzlos; oft zu recht. Hier ist Reformbedarf, genauso wie bei der
Durchsetzung von mehr schulischer Demokratie. Schülerinnen und Schülern Ver
antwortung für die Gestaltung des Schulalltags und auch des Unterrichts zu übertra
gen, fördert die Persönlichkeitsentwicklung und ist der wichtigste Präventionsbeitrag
gegen Gewalt und Extremismus.
Wie ist das gemeint? Im Kampf gegen Gewalt und andere Formen asozialen Verhal
tens können Appelle und Aktionen zwar Denkanstöße geben; nachhaltige Fortschritte
bringen sie nicht. Nur die geduldige Aufarbeitung von Konflikten in der Schule (und
natürlich auch zu Hause) mit den Kindern und Jugendlichen kann Werte und Ein
sichten in die Rechte anderer vermitteln! Dabei zählen, wie wir es von uns selbst
wissen, weniger die Argumente von Eltern oder Lehrern, sondern vor allem die Ar
gumente Gleichaltriger. Hier finden wir auch einen Grund, weshalb in den letzten
drei Jahren in Brandenburg die Gewaltbereitschaft Jugendlicher und die Anzahl von
Gewaltaktionen an Schulen zurückgegangen sind und nicht über dem Niveau von
1993 liegen: Immer mehr Jugendliche schauen bei Gewaltaktionen anderer nicht
mehr weg und beziehen offen Stellung dagegen; wir kommen im Kapitel 8 darauf zu
rück.
Während die Eindämmung von Jugendgewalt anscheinend erfolgreich gelungen ist,
lassen Erfolge im Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit und politischen Extremismus
noch auf sich warten. Gewalt in der Schule oder im Wohnumfeld ist unmittelbar als
Bedrohung erfahrbar; wer Angst hat, braucht nicht überzeugt zu werden, etwas gegen
Gewalt zu unternehmen. Die Gefahren von Rassismus und politischem Extremismus
erschließen sich nicht jedem so unmittelbar. Um sie zu erkennen, bedarf es politisch
historischer Aufklärung und eines offenen, streitbaren Diskurses, wohl auch einer
differenzierten DDR-Aufarbeitung. In dieser Hinsicht scheint Brandenburg ein Ent
wicklungsland zu sein. Die zuweilen fehlende Diskussionsbereitschaft und -erfahr
ung der "Autoritäten" zu Hause und in der Schule, der Eltern und der Lehrer, spüren
auch die Jugendlichen. Beispielsweise sprechen brandenburgische Jugendliche mit
ihren Eltern kaum über jüdische Kultur und Geschichte, im Gegensatz etwa zu nord
rhein-westfälischen Jugendlichen. Und so werden die in den letzten drei Jahren ge
stiegene Ausländerfeindlichkeit in Brandenburg wie auch der nicht gesunkene
Rechtsextremismus von der Sprachlosigkeit vieler Eltern mitverursacht.
Wie steht es mit der Orientierung und Unterstützung durch die Eltern? In Branden
burg meinen deutlich mehr Jugendliche als in Nordrhein-Westfalen: "Unsere Eltern
sind nicht da, wenn man sie braucht; wir müssen mit unseren Problemen selbst klar-
6
kommen!" Die Verfügbarkeit der Eltern hat 1993 mit der Zunahme wirtschaftlicher
und beruflicher Belastungen deutlich abgenommen und ist seitdem trotz der wirt
schaftlichen Stabilisierung der meisten Familien nicht wieder gewachsen. Dem un
veränderten Anteil von Eltern, die ihre Kinder prügeln und durch unangemessen
strenge Kontrolle einengen, steht ein wachsender Anteil von Eltern gegenüber, die
ihre Kinder gar nicht mehr kontrollieren. Es drängt sich der Verdacht auf, wir haben
es ebenso mit problematischen Eltern wie mit problematischen Jugendlichen zu tun.
Die Jugendforschung bietet also viele unerwartete (und zuweilen auch erfreuliche)
Befunde. Doch es gibt Anlaß zur Besorgnis: Erstens finden wir gerade in der Gruppe
der 12- bis 14jährigen eine zunehmende Gewaltbereitschaft und starke Tendenzen
zum Rechtsextremismus. Zweitens gibt es "Polit-Hooligans", die hoch gewalttätig
sowie in der Regel bewaffnet und männlich sind, meist rechtsextreme Ansichten
vertreten und bei ihren Eltern weder Unterstützung noch Kontrolle finden. Mit viel
Spaß, aber ohne Angst, Mitgefühl und Nachdenken über mögliche Folgen ihrer Ge
walt drangsalieren sie in Cliquen ihre Opfer. Gegen diese Täter kann nur erfolgreich
eingeschritten werden, wenn man Entwicklungsförderung mit polizeilicher Repressi
on und Strafe verbindet. Drittens sind rechtsextreme Jugendliche immer stärker be
reit, sich in politischen Organisationen zu engagieren. Und schließlich ist der
Zukunftsoptimismus der Landesjugend in den letzten drei Jahren deutlich zurückge
gangen. Ein Optimum an Selbstüberschätzung und das Gefühl, des eigenen Glückes
Schmied zu sein, bilden aber wichtige Voraussetzungen für den Lebenserfolg.
Der vorliegende landesrepräsentative Forschungsbericht soll Schlaglichter auf aus
gewählte Themen und Lebensbereiche werfen, die Jugendliche in Brandenburg be
treffen. Der breite forschungsmethodische Ansatz verhindert an mancher Stelle eine
detailliertere Beschreibung und ein tieferes Eindringen in einzelne Ursachenstruktu
ren abweichenden oder kriminellen Verhaltens. Trotzdem, so hoffen wir, lassen sich
viele Ansatzpunkte für weiterführende Diskussionen und vor allem zielgruppenori
entierte, innovative Präventionsangebote finden. Es gilt all denen zu danken, die zum
Gelingen des Projekts "Jugend in Brandenburg 1999" beitrugen und dieses Buch er
möglichten. Dazu gehören die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Leitungsteams der
einbezogenen Schulen. Sie alle haben uns, trotz vieler belastender Routinen des
Schulalltags, jede Unterstützung gewährt und die Datenerhebung erleichtert. Den
Autoren sei für die einzelnen Beiträge, Bianca Großmann und Anke Maschke für die
Datenerhebung, Reinhard Schrul für die Datenaufbereitung und Ellen Bittersmann
für die redaktionellen Arbeiten herzlich gedankt. Besonderer Dank gebührt auch
Prof. Dr. Wolfg ang Edelstein (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin)
und Prof. Dr. Hajo Funke (FU Berlin) für ihre konstruktiven kritischen Hinweise.
Schließlich trug Detlef Landua durch seine kompetente fachliche Mitarbeit an allen
Beiträgen und die Erledigung der Lektoratsarbeiten einen bedeutsamen Teil zu die
sem Buch bei.
Dietmar Sturzbecher
August, 2000
7
Inhalt
Dietmar Sturzbtf!cher und Detle!L andua
1 Ostdeutsche Jugendliche im Spiegel sozial wissen-
schaftlicher Forschung... ..................... ................... ....... ...... .............. 11
1.1 Einführung............................................................................................... 11
1.2 Jugend in den neuen Bundesländern - ein Forschungsüberblick ............ 13
1.3 Die Studie "Jugend in Brandenburg" .................................. ...... .............. 18
1.4 Methodischer Rahmen........... ......... ......................................................... 23
1.5 Erläuterungen zum methodischen Instrumentarium................................ 27
1.6 Zusammenfassung aktueller Befunde und Inhaltsübersicht.. .................. 28
Dietmar Sturzbecher und Susanne Wurm
2 Jugend in Ostdeutschland: Wertorientierungen, Zukunfts
erwartungen, Familienbeziehungen und Freizeitcliquen .......... 33
2.1 Sozialer Wandel, Familie und Persönlichkeitsentwicklung -eine
Einführung............................................................................................... 33
2.2 Problemstellung....................................................................................... 44
2.3 Methodische Bemerkungen ..................................................................... 46
2.4 Wertorientierungen, Kontrollüberzeugungen und
Zukunftserwartungen. ........ ............. ........... ............................... ............... 46
2.5 Soziale Netze ........................................................................................... 62
2.6 Fazit ......................................................................................................... 81
Dietmar Sturzbecher, Delle!L andua und Matthias Heyne
3 Politische Einstellungen und Rechtsextremismus
unter ostdeutschen Jugendlichen .................................................... 85
3.1 Problemstellung....................................................................................... 85
3.2 Methodische Bemerkungen ..................................................................... 87
3.3 Untersuchungsergebnisse ........................................................................ 88
3.4 Fazit ......................................................................................................... 118
Ronald Freytag
4 Antisemitismus .................................................................................. 120
4.1 Wurzeln der Judenfeindschaft - eine Einfiihrung .................................. 120
4.2 Problemstellung....................................................................................... 128
4.3 Methodische Bemerkungen ..................................................................... 129
4.4 Untersuchungsergebnisse ........................................................................ 131
4.5 Fazit......................................................................................................... 149
9
Detle!L andua, Dietmar Sturzbecher und RudolfWelskop!
5 Ausländerfeindlichkeit unter ostdeutschen
Jugendlichen ........................................................................................ 151
5.1 Problemstellung....................................................................................... 151
5.2 Theoretische Überlegungen ..................................................................... 156
5.3 Methodische Bemerkungen ..................................................................... 161
5.4 Untersuchungsergebnisse ........................................................................ 163
5.5 Fazit ......................................................................................................... 184
Rudolf Welskop! und Anke Maschke
6 Freizeitangebote aus der Sicht von Jugendlichen
in Brandenburg .................................................................................... 186
6.1 Problemstellung ................................................................. .......... ........... 186
6.2 Methodische Bemerkungen..................................................................... 187
6.3 Untersuchungsergebnisse ..... .... .............................................................. 188
6.4 Fazit ......................................................................................................... 209
Manfred Leiske, Dietmar Sturzbecher und Jan-Gerrit Keil
7 Soziale Schulqualität aus der Sicht von
Jugendlichen in Brandenburg .......................................................... 210
7.1 Problemstellung....................................................................................... 210
7.2 Theoretische Bemerkungen..................................................................... 211
7.3 Methodische Bemerkungen ..................................................................... 216
7.4 Untersuchungsergebnisse .......... ...... ......................... .............. ................. 218
7.5 Fazit ......................................................................................................... 246
Dietmar Sturzbecher, Detle!L andua und Hossein Shahla
8 Jugendgewalt unter ostdeutschen Jugendlichen ......................... 249
8.1 Problemstellung....................................................................................... 249
8.2 Theoretische Bemerkungen ..................................................................... 251
8.3 Methodische Bemerkungen ..................................................................... 261
8.4 Untersuchungsergebnisse ....................................................................... 266
8.5 Fazit ......................................................................................................... 298
Literatur................................................................................................. 301
Anhang .................................................................................................. 322
10
1 Ostdeutsche Jugendliche im Spiegel sozialwissen
schaftlicher Forschung
Dietmar Sturzbecher & Detle!L andua
1.1 Einführung
Wenn von "der heutigen Jugend" die Rede ist, erwartet man Negativschlagzeilen.
Das Vorurteil, daß die Nachfolgegeneration zunehmend unzuverlässig, arbeitsscheu,
kulturlos oder auch gewalttätig sei, läßt sich bei Autoren der Antike oder Shake
speare genauso nachlesen wie in den aktuellen Tageszeitungen. Woher stammen der
artige Überzeugungen, wodurch werden sie am Leben erhalten? Viele Gründe lassen
sich anführen: In den Medien sichern "schlechte Nachrichten" gute Umsatzzahlen;
Sozialarbeiter müssen leider die Finanzierung ihrer unzweifelhaft dringend notwen
digen Tätigkeit immer wieder durch besorgniserregende "Fakten" legitimieren ...
Trotzdem geraten die meisten Vertreter jugendkritischer Meinungen regelmäßig in
Beweisnot, wenn man sie nach dem zeitlichen Bezugspunkt oder Vergleichsdaten
aus dem angeblich goldenen Zeitalter mit der vorbildlichen Jugendgeneration fragt.
Dem Diskurs über "die heutige Jugend" fehlt also meist die faktische Grundlage.
Dies gilt nicht nur für die Jugendkritiker, sondern auch für die unverbesserlichen
Optimisten mit der Überzeugung, die Jugend "war schon immer so" und man müsse
bei den "schwarzen Schafen" nur ein wenig warten, bis die wachsende Lebenserfah
rung die Zeit der Jugendsünden beendet. Sicher, die entwicklungspsychologische
Resilienz-Forschung bietet eine Fülle von Ergebnissen, nach denen Jugendliche sich
trotz widrigster Entwicklungsbedingungen und krimineller Episoden im Jugendalter
zu verantwortungsbewußten und erfolgreichen Mitbürgern entwickelt haben (Festin
ger, 1983). Diese Forschungsergebnisse markieren aber auch notwendige Vorausset
zungen und protektive Mechanismen im gesellschaftlichen Entwicklungskontext, die
zu derartigen Wandlungen führen (Garmezy, 1991; Rutter, 1989); wir kommen dar
auf zurück. Beides, das notwendige Aufräumen mit Klischees über die Jugend wie
auch das notwendige Schaffen von unterstützenden Entwicklungskontexten für Risi
kogruppen sind gute Gründe für eine angewandte Jugendforschung, die Jugendliche
nach ihrer Lebenssituation und ihren Befindlichkeiten fragt.
Wir haben die Jugendlichen in Brandenburg nach ihrer Lebenssituation sowie nach
ihrem Erleben von Jugendgewalt, politischem Extremismus und Ausländerfeindlich
keit befragt und dabei Ergebnisse gefunden, die kaum zu den eingangs genannten
Negativschlagzeilen passen. Das provoziert Widerspruch, und deshalb wollen wir
auch zunächst diskutieren, was solche Befragungsdaten leisten können und wo ihre
Grenzen liegen. Betrachten wir dazu als Beispiel einen tabellarischen Überblick über
die selbst berichteten Delikthäufigkeiten 12- bis 19jähriger brandenburgischer Ju
gendlicher im Bereich "Jugenddelinquenz". Dabei fällt auf, daß meist eine große
Mehrheit von Jugendlichen die aufgeführten Delikte im Laufe des letzten Jahres gar
nicht begangen hat.
11
Tab. 1: Jugenddelikte in Brandenburg -1999 (Angaben in %)
Ich habe/bin in den letzten Nein, !ar nicht Ein-oder zweimal Dreimal + öfter
12 Monaten ... Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl
... die Schule geschwänzt. 66,8 64,3 21,2 25,9 12,0 9,8
... ohne Führerschein gefahren. 57,3 74,9 17,6 15,3 25,1 9,7
... unter Alkohol gefahren. 79,6 95,4 13,9 3,6 6,5 0,9
... jemanden verprügelt. 77,6 90,5 18,1 8,3 4,3 1,2
... etwas geklaut. 69,7 75,7 22,5 18,2 7,8 6,1
... Drogen probiert . 74,4 76,3 13,1 13,2 12,5 10,6
... an Gewaltaktionen gegen
andere Gruppen teilgenommen . 82,2 94,0 12,4 4,5 5,3 1,6
... Ärger mit der Polizei gehabt. 71 1 890 23,0 9,5 59 1,5
Allerdings existiert eine bemerkenswert große Gruppe von Jugendlichen, die gele
gentlich oder öfter die Schule schwänzt. Das Führen von Kraftfahrzeugen ohne den
Besitz eines Führerscheins räumt ein Drittel der Jugendlichen ein; die Nutzung eines
Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinwirkung im letzten Jahr gibt etwa jeder zehnte Be
fragte zu. Jeweils rund ein" Viertel der Jugendlichen hat im letzten Jahr etwas "ge
klaut" oder Drogen "ausprobiert". Rund 20 Prozent der Jugendlichen, vor allem Jun
gen, wurden "erwischt" und haben Ärger mit der Polizei bekommen; allerdings hat
ein nicht unerheblicher Anteil zwar strafbare Handlungen begangen, aber dennoch
keinen Ärger mit der Polizei gehabt, was aus amtlicher Sicht in den Bereich der
"Dunkelziffer" gehört.
Hier genau liegen die Erkenntnismöglichkeiten sogenannter "Dunkelfeldstudien", zu
denen auch unsere Studie gehört. Zwar bieten Dunkelfeldstudien keinen Aufschluß
über die psychologischen Hintergründe von Delikten einzelner Jugendlicher, daftir
aber einen umfassenden Überblick über Einstellungs- und Verhaltensmuster ganzer
Bevölkerungsgruppen. Im Gegensatz zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfas
sen Dunkelfeldstudien nicht nur die "angezeigten" Tatverdächtigen, sondern alle Ju
gendlichen, die ein begangenes Delikt berichten bzw. "zugeben". Wenn man die
Erhebungsbedingungen so gestaltet, daß die Repräsentativität der Stichprobe und die
Anonymität gewährleistet sind (man also mit Delikten weder prahlen noch dafiir zur
Verantwortung gezogen werden kann), ermöglichen Dunkelfeldstudien eine bessere
Einschätzung des Gesamtausmaßes von Jugenddelinquenz, der Risikogruppen und
der Präventionsmöglichkeiten als die PKS oder qualitative Studien. Dies sei an ei
nem Beispiel illustriert. Betrachten wir die Altersgruppe der 14- bis 17jährigen, so
zeigt die PKS bei Diebstahlsdelikten (incl. Raub) einen Anteil von Tatverdächtigen
von sechs Prozent; ein sehr kleiner Anteil. Daraus zu schlußfolgern, daß die Abnei
gung Jugendlicher gegen Diebstahlsdelikte groß und Präventionsmaßnahmen über
flüssig seien, ist jedoch falsch; rund 30 Prozent der Altersgruppe haben im letzten
Jahr entsprechend unserer Dunkelfeldstudie etwas "geklaut". Ähnlich verhält es sich
mit Drogendelikten als weitere Art von typischen Kontrolldelikten: Der Anteil der
Tatverdächtigen (incl. Cannabis-Verstöße) beträgt nur 1,7 Prozent, aber 25,6 Prozent
der Jugendlichen sagen, sie hätten im letzten Jahr "Drogen probiert".
12