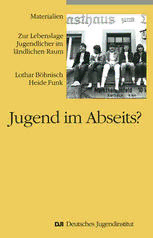Table Of ContentLothar Böhnisch / Heide Funk
Jugend im Abseits?
Lothar Böhnisch / Heide Funk
Jugend im Abseits?
Zur Lebenslage Jugendlicher
im ländlichen Raum
DJI Materialien
Das Deutsche Jugendinstitut eV. CDJI) ist ein zentrales sozialwissen
schaftliches Forschungsinstitut auf Bundesebene mit den Abteilungen
Jugendhilfe, Jugend und Arbeit, Jugend und Politik, Mädchen- und
Frauenforschung, Familie/Familienpolitik, Vorschulerziehung,
Medien und neue Informationstechnologien, Sozial berichterstattung
sowie Dokumentation. Es führt sowohl eigene Forschungsvorhaben
als auch Auftragsforschungsprojekte durch. Die Finanzierung erfolgt
überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit und im Rahmen von Projektfärderung aus
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft.
Weitere Zuwendungen erhält das OJI von den Bundesländern und
Institutionen der Wissenschaftsfärderung.
Alleinauslieferung: Juventa Verlag, Weinheim und München
© 1989 OJI Verlag Deutsches Jugendinstitut e.V., München
Umschlagentwurf: Klaus Meyer, Susanne Erasmi, München
Titelfoto: Süddeutscher Verlag - Bilderdienst, München
Redaktionelle Bearbeitung: Irene Hofmann-Lun
ISBN 978-3-322-97874-5 ISBN 978-3-322-97873-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-97873-8
Inhalt
Zur Einführung 9
Eine Jugend, die gelernt hat zufrieden zu sein
Zur Geschichte der Landjugendforschung 15
Überblick 15
Die jugendkundliche Forschung der Weimarer Zeit 19
Die jugendkundliche "Tatsachenforschung"
der 50er Jahre 31
Landjugendforschung im Sog der repräsentativen
Jugendstudien 40
Landjugend und Berufsorientierung 44
Landjugendforschung und Modernisierung 46
Die neue Gabelung: Integration oder
Lebensbewältigung 48
Die sozialpolitisch motivierte
Forschungsperspektive -Lebenslage Landjugend 54
Geschlechterverhältnis und geschlechtsspezifische
Differenzierung 64
Sozialökonomische Grundlagen der Stellung
der Frau im ländlichen Bereich 66
Hierarchisierung und sexuelle Gewalt 72
Frauen, Land, Natur 74
Sozialökonomische Grundlagen der dörflichen
Männerhierarchie 76
Dorfwelt als Männerwelt 78
Geschlechtsspezifische Dimensionen
der Lebensbewältigung 80
Der Forschungsprozeß als regionaler
Kommunikationsprozeß 87
Grundprinzipien regionaler Jugendforschung 87
Der ethnographische Zugang und die Einbindung des
regionalen Sozialwissens in den Forschungszusammenhang 91
Der Forschungsprozeß als gemeinsamer
Erkenntnisprozeß 95
Zum Aufbau der ersten Projektphase 100
Zwischen Dorf und Stadt -die ländliche Region 103
Zur begrifflichen Bestimmung des "ländlichen Raums" 103
Die Modernisierung und Regionalisierung des
ländlichen Bildungswesens 109
Zur Eigenart moderner ländlicher Sozialräume 112
Region und Regionalität 117
Lebenslage und interregionale Differenzierung 121
Räumliche Beschäftigungs-und Reproduktionsstruktur 122
Regionale Jugendkultur 126
Das "Regionalklima" 132
Infrastruktur jugendgemäßer Einrichtungen 134
Die soziale Freisetzung der Landjugend 136
Jugendkulturelle Freisetzung und dörfliche
Integrationsperspektive 136
Bedeutungsverlust der Jahrgangsgruppen 142
Soziale Freisetzung von Mädchen und jungen Frauen 145
Die soziale Freisetzung der Jungen -Cliquen,
Treffs, Buden 152
Die bäuerliche jugend 158
jungen und landwirtschaftliche Berufsperspektive 163
Mädchen und landwirtschaftliche Lebensperspektive 167
Regionalorientierung und regionale Mobilität 172
Zur Phänomenologie der sozialräumlichen Erschließung
der Region durch die jugendlichen 174
Geschlechtsspezifische Unterschiede in
Regionalerfahrung und Mobilität 178
Bleibeorientierung: Bleiben-Wollen - Bleiben-Müssen? 182
Stadtorientierung als dorfabgewandte
"Nix-los-Orientierung" 183
Sich-Wohlfühlen in der Heimatregion 188
Abneigung gegen die Stadt? 190
Gruppenspezifische Differenzierungen in der
Bleibeorientierung 195
Der Naturbezug 200
"Erwachsen-Werden im ländlichen Raum-
Dörfliche Integrationsmuster" 203
Die Dorföffentlichkeit 208
Die Vereine in der Dorföffentlichkeit 210
Die dörfliche jugend und die Vereine 214
Der Landjugendverband als Ort dörflicher Integration 218
Die Landjugendgruppe als Intergenerationengruppe 223
Mädchen und jungen in der Landjugendgruppe 225
Familiales Generationenverhältnis und Dorfmilieu 227
Die Vermischung der Intergenerationen-Beziehungen
in Familie und Dorf 227
Die" Anbindung" an die Eltern 229
Selbständigkeit gegenüber den Eltern 232
Der Übergang in die dörfliche Normalität 235
Berufsfindung als regionale Option 239
Berufsfindung als Aspekt der Lebenslage 239
Mädchen und Berufsfindung 241
Berufsfindung bei Jungen 249
Soziale Segregation: Jugendliche in ländlichen Neubaugebieten 254
Ein neuer Typ sozialer Segregation im ländlichen Raum 254
Familien in ländlichen Neubaugebieten 258
Jungen und Mädchen in ländlichen Neubaugebieten 261
Die "neue" Übergangenheit 266
Der fehlende Selbstbezug 266
"Eigenständige Regionalentwicklung" 268
Die Ambivalenz der "neuen Erreichbarkeit" 271
Verzeichnis der Fallstudien 274
Literatur 275
Zur Einführung
Zwischen Dorf und Stadt hat sich die "Region" als Bezugsgröße der
modernen Vergesellschaftung des ländlichen Raums geschoben. Die
Lebenslage der Landjugend heute ist von dieser neuen Regionalität
besonders erfaßt und geprägt.
Dies ist gleichsam die "Resultante" unserer vielfältigen explorativ
gewonnenen Erfahrungen über das Jungsein und das Erwachsenwerden
auf dem Lande. In diesem Kontext ist heute auch eine regionale So
zialpolitik für Jugendliche und junge Erwachsene im ländlichen Raum
einzufordern: soziale Chancen sind zunehmend über regionale Ressour
cen, Zugänge, Netzwerke und Kommunikationsstrukturen vermittelt.
Die traditionale Alternative "Dorf oder Stadt", welche im Grunde die
Entwicklung einer ländlichen Sozialpolitik für Jugendliche verhinderte,
ist nicht mehr haltbar. Das darin enthaltene sozialpolitische Stereotyp
lautete - und gilt oft heute noch - etwa so: wer früher auf dem
Lande blieb, um den brauchte man sich nicht mehr zu kümmern, der
war versorgt; wer wegging, der suchte offensichtlich seine Ansprüche
außer halb des Landes zu realisieren - eine eigenständige ländliche
Sozialpolitik konnte nicht zum Zuge kommen.
Die in dem Buch um diese Kernaussagen gefächerten Ergebnisse
stammen aus dem ersten - explorativen - Teil einer empirischen Re
gionalstudie "Lebensverhältnisse und Lebensperspektiven Jugendlicher
und junger Erwachsener im ländlichen Raum", die vom Deutschen
Jugendinstitut München in Kooperation mit der Universität Tübingen
in ländlichen Regionen Württembergs durchgeführt wird.
Die Studie hat den Anspruch, theoretisch und methodisch "sozial
politische" Bezüge herzustellen. Man wird deshalb die in üblichen
Jugendstudien erhobenen Einstellungs- und Verhaltenskomplexe
Freizeitverhalten, Einstellung zu zentralen gesellschaftlichen Werten,
zu Politik und Konsum - bei uns so nicht finden. Natürlich haben
wir es auch hier, wie in der empirischen Sozialforschung überhaupt,
mit Einstellungen und beobachtbarem Verhalten zu tun. Für eme
9
sozialpolitisch verpflichtete Jugendforschung, wie Wlr sie hier ent
wickelt haben, relativieren sich aber Einstellungen und Verhaltens
weisen in sozialpolitisch "aufgeladenen", mehrdimensional erhobenen
Kontexten: Bleibeorientierung, regionale Option, Integration, Segrega
tion, Übergangenheit. Diese Kontexte - die wir an späterer Stelle
ausführlich darstellen werden - signalisieren, wie Einstellungen und
Verhaltensweisen sozialpolitisch zugänglich und bewertbar werden.
Denn - so werden wir an späterer Stelle immer wieder nachweisen
viele der Einstellungen und Verhaltensweisen Jugendlicher auf dem
Lande lassen keine direkten Rückschlüsse auf die realen sozialen
Chancen der Jugendlichen zu. Es bedarf daher einer Erschließung der
Alltagsstrukturen des Jugendlebens auf dem Lande, wie sie sich im
Spannungsfeld der "zwei Welten" - der modernen, über Bildung, Aus
bildung, Medien und Konsum vermittelten urbanen Welt und der sehr
stark traditional geprägten ländlichen Alltagswelt - formieren. Dieses
Spannungsverhältnis der "zwei Welten" spiegelt sich im modernen
Jugendalter im ländlichen Raum besonders wieder, ohne daß es sich,
wie im städtischen Bereich, subkultureIl abgrenzbar ausdrücken kann.
Es vermittelt sich häufig in verdeckten und verschichteten Konstel
lationen, die in einem von der Forschung organisierten Kommunika
tionsprozeß freigelegt, verdichtet und zum Bild der "regionalen So
zialgruppe Jugend" zusammengeführt werden können. So erhalten wir
gleichsam ein "sozialpolitisches Soziogramm" der modernen Landju
gendszene, in dem sich Kosten und Potentiale der Lebensbewältigung
Jugendlicher im ländlichen Raum zueinander in Beziehung setzen las
sen.
Damit unterscheidet sich dieses Forschungsprojekt in seiner Vorge
hensweise deutlich gegenüber herkömmlichen Ansätzen der Landju
gendforschung. Bei uns steht die Frage nach den Besonderheiten der
regionalen Lebensbewältigung und Lebensperspektive vor dem Aspekt
der Anpassungsfähigkeit der Landjugend an den urban-industriellen
Modernisierungsprozeß, wie ihn herkömmliche Landjugendstudien the
matisieren. Wir wollen demgegenüber die "Lebenslage" und die typi
schen Probleme der Lebensbewältigung Jugendlicher im ländlich-regio
nalen Lebensraum aufklären. Gleichzeitig versuchen wir - in unserer
10
sozialpolitischen Perspektive - zu überprüfen, ob und wie die entspre
chenden jugend- und sozialpolitischen Institutionen und Öffentlich
keiten in der ländlichen Region hinsichtlich solcher regional vermit
telter Lebensprobleme Jugendlicher aufnahme-, verarbeitungs- und
unterstützungsfähig sind. Mit den Begriffen "ländlich" oder "auf dem
Lande" bezeichnen wir in diesem Zusammenhang Regionen, die nicht
im Sograum der industriellen Ballungsgebiete liegen ("ballungsgebiets
abgewandte Regionen").
In der ersten Projektphase, deren Ergebnisse hier dargestellt wer
den und der eine Längsschnittuntersuchung folgen soll, ging es vor
allem darum, den heutigen Status und die Integration der Sozialgruppe
Jugend im dörflichen und regionalen Lebensraum aufzuklären. Gleich
zeitig kam es uns darauf an, die Art der sozialen Differenzierung
"der Jugend" im ländlichen Raum zu ermitteln und weiter zu fragen,
in welchem Zusammenhang Entwicklungen regionaler Kultur und Le
bensbewältigung Jugendlicher heute stehen. Generell hatten wir uns
also in der ersten Projektphase zum Ziel gesetzt, die regionalen Rah
menbedingungen der Lebensbewältigung Jugendlicher und junger Er
wachsener auf dem Lande aufzuklären. Da wir in dieser ersten Pro
jektphase vor allem explorativ und mit qualitativen Verfahren gear
beitet haben, sind unsere Aussagen in der Regel "Trendannahmen"
aus denen noch keine Verteilungen und quantitativen Ausdifferenzie
rungen ermittelt werden können. Dies soll der nächsten Projektphase
vorbehalten sein.
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Population der 16- bis
25jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, soweit sie der
"nachschulischen Jugendphase" zuzurechnen sind. Wir richten dabei
unser Hauptaugenmerk auf die Mädchen und Jungen, die nach dem
16. Lebensjahr die Regelschulen verlassen haben. Es ist der Teil der
ländlichen Jugendpopulation, der sich schon früh mit der Frage des
Bleibens oder Gehens in der Region auseinandersetzen muß, der auf
die Region angewiesen ist. Das heißt nicht, daß wir Gymnasiasten
nicht in unseren Erhebungen haben, sie bleiben aber eine Kontrast
gruppe zur durchschnittlichen Jugendpopulation der Regelschulabgän
ger auf dem Lande.
11