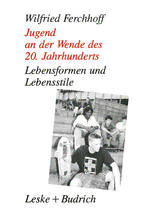Table Of ContentWilfried Ferchhoff,
Jugend an der Wende des 20. Jahrhunderts
Wilfried Ferchhoff
Jugend an der Wende
des 20. Ja hrhunderts
Lebensformen und Lebensstile
+
Leske Budrich, Opladen 1993
© 1993 by Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschlie61ich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung au-
6erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustirnmung des Verlags unzu
liissig und strafbar. Das gilt insbesondere fur VervieWiltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfil
mungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-322-95947-8 ISBN 978-3-322-95946-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-95946-1
In der redaktionellen Bearbeitung und insbesondere in der techniscben Ausge
staltung des Bandes unterstiitzte micb Sven Kommer. Ibm sei flir seine enga
gierte Mitarbeit gedankt.
Bielefeld. im August 1993 Wilfried Ferchhoff
5
Inhaltsverzeichnis
Einleitung . . . . . . . . . . . .. 11
1. Vom Wandervogel zu den postaltemativen Jugendkultu-
ren. Kontinuitat im Wandel biirgerlicher Jugendkulturen . . . . . . 21
2. Veranderte Strukturen sozialer Ungleichheit. Gesell-
schaftliche Individualisierung. Segen oder Fluch? . . . . 43
3. Zur Differenzierung des Jugendbegriffs . . . . . . . . . 53
4. Entwicklungs- und Lebensbew[itigungsaufgaben von Ju
gendlichen neu definiert -ein anderes Verstandnis von
Identitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5. Pauschale Jugendbilder und epoch ale Generationsgestal-
ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6. Jugendgenerationen in der Bundesrepublik -revisited . . 73
7. Jugendkuiturelle Pluralisierungen und Polarisierungen . 83
8. Idealisierung und Individualisierung von Jugend am Bei-
spiel Mode und Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
9. Aufwachsen heute: veranderte Sozialisationsbedingungen
in Familie. Schule. Beruf. Freizeit und Gleichaltrigen-
gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... 107
9.1 Jugend ist Schul- und Bildungsjugend ..... . 109
9.2 Von der lebensabgewandten sachorientierten zur
emotional aufgeladenen schUierorientierten Schule 112
9.3 Jugend ist arbeitsferne Jugend .... . 116
9.4 Jugend ist Gegenwartsjugend .......... . 119
9.5 Jugend ist Leitbild- und Expertenjugend ..... . 120
9.6 Jugend ist im ambivalenten Sinne individualisierte
Jugend ...................... . 122
9.7 Jugend ist Kaufkraft- und Konsumjugend .... . 123
9.8 Jugend ist alltagskulturell vermitlelte Jugendkultur-
jugend . .................... . 124
9.9 Jugend ist umsorgte Mutterjugend ...... . 125
9.10 Jugend ist alltagspragmatischfamiliale Versor
gungsjugend . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 126
9.11 Jugend ist eine in Partnerschaften undfamilialen
Zusammenhiingen emotional aufgeladene und psy
chosoziale Nutzenjunktionen gewinnende Jugend 127
9.12 Jugend ist Gleichaltrigenjugend ......... . 128
7
9.13 Jugend ist weibliche und mdnnliche, aber auch an-
drogyne Jugend .................. . 129
9.14 Jugend ist sexuelle Jugend ............ . 130
9.15 J ugend ist liberalisierte, aber auch permissive (Er-
ziehungs)Jugend . . . . . . . . . . ...... . 131
9.16 Jugend ist partnerschaftliche und auf Autonomie
zielende (Erziehungs)Jugend .......... . 132
9.17 Jugend ist markt- und vergnugungsvermittelte Kon-
troJijugend . . . . . , . . . . . 133
9.18 Jugend ist Multi-Media-Jugend . .... . 133
9.19 Jugend ist Patchworkjugend ...... . 137
9.20 Jugend ist nicht nur "sprachlose" Jugend 139
9.21 Jugend ist ego- und ethnozentrische Jugend 140
9.22 Jugend ist eine jugendpolitisch vergessene Jugend . 140
9.23 Jugend ist eine politikabstinente bzw. -verdrossene
Jugend ...................... . 141
10. Jugendkulturelle Lebensmilieus in den 90er Jahren ......... 143
10.1 ReligiOs-spirituelle Szenen 145
10.2 Kritisch-engagierte Szenen 151
10.3 Action-orientierte Szenen . 154
10.4 Manieristisch-postalternative Szenen . 157
10.5 Institutionell-integrierte Szenen . 164
10.6 Milieu- und Szenenvermischungen . . 166
11. Padagogische Herausforderungen. Antworten und Konse-
quenzen in Schule und Jugendarbeit . . . . . . . . .. . .... 169
11.1 Der Abschied von antiquierten Jugendbildern in
Schule und Jugendarbeit . . . . . . . . . . . .. . .... 178
11.2 Die Lebensverhdltnisse und -bedingungen von Pdd
agolnnen in Schule und Jugendarbeit sind andere
als ihrer Adressaten. Eine unhinter-fragte Gleich-
stellung steht mindestens unter Ideologieverdacht . 180
11.3 Zur U nstimmigkeit des pddagogischen Outfits und
Habitus' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.4 Zur Ambivalenz und zum Pluralismus von Jugend-
bildern in der Jugendarbeit . ......... , .. 180
8
11.5 Der Weg von denformellen MitgJiedschaften zu
den informellen Beziehungen. Die Abkehr von insti
tutionalisierten padagogischen Arrangements trijJt
auch die lugendarbeit ...... . . . . . . . .. .... 181
11.6 Das vergleichsweise biedere padagogische Ambien-
Ie der lugendarbeit gegenuber den stilistisch aus-
drucksstarken kommerzialisierten Freizeitindustrie . 182
11.7 Die Chancen einer neuen padagogischen Professio-
nalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
11.8 Kooperation zwischen lugendarbeit und Schule.
Moglichkeilen und Grenzen ................ 186
Literatur .................................. 189
9
Einleitung
In diesem Buch geht es darum, das Aufwachsen von Jugendlichen und den
Strukturwandel der Jugendphase auf der Basis der veranderten Lebensbedin
gungen am Ende dieses Jahrhunderts soziologisch zu rekonstruieren.
Zu den veranderten Lebensbedingungen, die zunachst nur stichwortartig be
nannt, spliter dann im einzelnen sozialstrukturell und alltagsphanomenologisch
analysiert und ausgefachert werden sollen, gehoren vor allem folgende Ent
wicklungsprozesse: Entrliumlichung, Beschleunigung, Technisierung und
Automatisierung des Alltags, wachsende Partikularisierung von Lebensberei
chen, neue Zeit- und Lebensrhythmen durch Mobilitlitsanforderungen, Ver
kurzung der Arbeitszeiten, Zunahme der Freizeit, aber auch Zeitnot, Hektik
und StreB, wachsende Verkehrs-und Kommunikationsdichte, Entsinnlichung,
Expansion und Differenzierung der Waren- und Konsummlirkte, Mediatisie
rung, Verwissenschaftlichung und Kommerzialisierung von Alltagserfahrun
gen, Entinstitutionalisierung von Lebenslaufubergangen, Enttraditionalisie
rung und Entkonventionalisierung von Werten, Normen und Lebensmilieus,
Aufweichung traditioneller sozio-kultureller Kollektive, Fragilitlit der sozialen
Beziehungen, pluralisierte und individualisierte Lebensformen u.v.m.
Der Individualisierung und dam it auch der Pluralisierung und Differenzie
rung von Lebensbedingungen, Lebenslagen, Lebensformen und Lebensstilen
wird am ehesten ein anschauliches Forschungsdesign gerecht, das zu Beginn
des Forschungsprozesses mit moglichst unvoreingenommenen sogenannten
"sensitizing concepts" in das Untersuchungsfeld eintaucht, urn zunachst ohne
fixiertes Konzept, aber "hellwach" und "mehrdimensional" auf induktivem
Wege eine dem Gegenstand angemessene Theorie- und Hypothesenbildung
binnenperspektivisch verstehend erschlieBt. Eine solche alltagsweltorientierte,
mit (auto-)biographischen, soziographischen, ethnographischen und herme
neutischen Methoden ausgestattete qualitative Vorgehensweise interessiert
sich auf der einen Seite fur die subjektiven AuBerungen, Selbstdeutungen,
Interpretationen und Selbstzeugnisse der Heranwachsenden. Auf der anderen
Seite geht es darum, die subjektiv erlebten Alltage von Jugendlichen als
Selbstgestaltungsprozesse -auch Kinder und Jugendliche sind ganz im inter
aktionistischen Sinne auf der Grundlage von institutionalisierten Vorgaben
Konstrukteure ihrer eigenen Biographien -im Zusammenhang historischer und
sozialer Bedingungskonstellationen zu betrachten. Es geht also urn die Beruck
sichtigung der verschiedenen Lebensverhliltnisse und urn die subjektiv diffe
renten Verarbeitungsformen mit den gesellschaftlich und institutionell vor
strukturierten Erwartungshaltungen und Anforderungen, die wiederum abhan-
11
gig sind von den jeweils lebensgeschichtlich und sozial erworbenen Ressour
cen (Luger 1991, S. 68).
Es gilt somit, unter sozialisationstheoretischen Gesichtspunkten auf ver
schiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Perspektiven die vielen Ver
heiBungen und Gliicksversprechen sowie die individuellen Wahlmoglichkei
ten und Chancen unserer (post)modemen, individualisierten Gesellschaft
gleiehzeitig mit den Kehrseiten und Risiken des Scheiterns im Hinblick auf
das Aufwachsen von Jugendlichen in Familie, Schule, Beruf, Freizeit und
Gleiehaltrigengruppe in den Blick zu nehmen. Obgleieh es an einer soziologi
schen "Prlizisierung" des "unschrufen" und "vieldeutigen" Individualisierungs
begriffs sowie an einer "empirischen Evidenz" des Individualisierungsansatzes
mangeln soli, so daB erhebliche Vorbehalte, Einwande und auch Widerlegun
gen der Kritiker im Zusammenhang des zuweilen modischen Gebrauchs eines
solchen catch-all-term formuliert worden sind (so zuletzt Burkart 1993, S. 159
ff.), mochte ich dennoch mit den Protagonisten der Individualisierungsdiskus
sion der letzten 10 Jahre an den zentralen Einsichten der Individualisierungs
theorie, die mehr als Erkliirungsrhetorik beanspruchen, festhalten. Die Grund
these lautet: Die individualisierte Gesellschaft produziert Zuwachse und An
spriiche (Autonomie, Selbstentfaltung, Sinnerfiillung, Gerechtigkeit) und
erschwert gleiehzeitig ihre Verwirklichung. Individualisierung meint sowohl
die Aufweiehung, ja sogar die Auflosung als auch die "Ablosung industriege
sellschaftlieher Lebensformen durch andere, in denen die einzelnen ihre Bio
graphie selbst herstellen, inszenieren, zusarnmenschustern miissen, und zwar
ohne die einige basale Fraglosigkeit siehernden, stabilen sozial-moralischen
Milieus, die es durch die gesamte Industriemoderne hindurch immer gegeben
hat und als 'Auslaufmodelle' immer noch gibt" (BeckIBeck-Gernsheim 1993,
S. 179). Hinzu kommt, daB mit der Individualisierung der Gesellschaft nieht
eine "Auflosung, sondern immer eine Verschiirfung sozialer Ungleiehheit"
einhergeht (Beck 1993). Es entsteht jenseits der Fiille von individuellen
Wahlmoglichkeiten in dieser, immer mehr yom Utilitarismus gepriigten und
in Turbulenzen der Mangelverteilung geratenen enttraditionalisierten und ent
ritualisierten Gesellschaft ein quasi struktureller Zwang sich selbst zu verwirk
lichen - das "Leben in eigene Regie" zu nehmen. Jeder muB sieh nieht nur
individuell behaupten und durchsetzen, sondern auch noch in einer Art "vor
bildlosen" Eigenverantwortung und subjektiven GewiBheit seine individuelle
Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit stets selbstinszenierend unter Be
weis stellen. Wir sind, urn mit Satre zu sprechen, zur Individualisierung
"verdammt". Es handelt sieh urn einen "paradoxen Zwang" zur Selbstgestal
tung und Selbstinszenierung der eigenen Bastelbiographie, auch "ihrer Einbin
dungen und Netzwerke" (BeckIBeck-Gernsheim 1993, S. 179) sowie ihrer
12
"moralischen, sozialen und politischen Bindungen -allerdings: unter (struktu
rellen) sozialstaatlichen Vorgaben wie Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeits
und Sozialrecht" etc. (Beck 1993). Nicht nur Freiheitsgewinn, sondem eine
spannungsreiche, konfliktreiche Mischung" - "Riskante Freiheiten" (Beck/
Beck- Gemsheim 19 93a)-scheint der biographische Grund-oder Strukturtypus
der so verstandenen individualisierten Gesellschaft zu sein. Die Risiken des
Scheitems sind zweifellos groB, daB ein derartig anspruchsvolles Lebenskon
zept zumindest nicht von allen erfiiUt werden kann; statt dessen konnen nicht
nur Irritationen, sondem auch Belastungen aller Art und Gefiihle von Unsi
cherheit, Ohnmacht, Oberforderung, Hilflosigkeit und Entfremdung iiberhand
nehmen.
Der Differenzierung, Pluralisierung und Individualisierung von -in ihren
schichtspezifischen und subkulturellen Zugehorigkeiten und Grenzziehungen
unbestimmbarer werdenden - jugendJichen Lebenslagen, jugendkulturellen
Milieuzusammensetzungen und Leben ssti len werden nunmehr besondere Auf
merksarnkeit geschenkt. Inzwischen scheinen dariiber hinaus im AnschluB an
eine differenzierte Betrachtung des mittlerweile zerfaserten JugendbegrijJs
sowohl der Verzicht auf verallgemeinerbare Generations- und Jugendbilder
sich anzudeuten als auch die traditionellen "Entwicklungsaufgaben" von Ju
gendlichen in Frage gestellt zu werden.
Wer also in den 90er Jahren ein BUd der J ugend zu schildem versucht, der
kommt in einer sozialwissenschaftlich orientierten und interdisziplinar ange
legten Forschungsperspektive nicht urnhin, neben den empirisch nachgewie
senen Verlinderungen der Heranwachsenden irn korperlich-gesundheitlichen,
seelisch-geistigen und sozialen Bereich und neben dem verlinderten Aufwach
sen und den gewandelten Lebenssituationen von Jugendlichen der Vielfalt der
kulturschOpferischen jugendlichen Lebensformen und Lebensstile (Medien,
Konsum, Mode und Sportivitiit spielen hierbei eine ganz zentrale Rolle), aber
auch der vielen Problernkonstellationen (offene und verdeckte Gewaltbereit
schaft, auch KriminaliUit, Familien-, Schul-, Leistungs-, KonsumstreB etc.,
Gesundheitsrisiken und -gefahrdungen, Tabak-, Alkohol-, Medikamenten-,
anderer Drogenkonsum u.v.m.) von jugendkulturellen Lebensmilieus Rech
nung zu tragen.
Aber nicht nur die J ugendphase wird neu definiert, wei! sie ihre traditionelle
Gestalt und Selbstversllindlichkeit als festumrissener und geregelter Ober
gangsstatus in die Erwachsenengesellschaft eingebiiBt hat, sondem auch der
(padagogische) Umgang mit JugendJichen in Familie, Schule und auBerschu
lischen Feldem scheint mit der Aufweichung der vomehmlich padagogischen
Kategorie des psychosozialen Schonraums eine andere Qualitiit zu gewinnen.
13