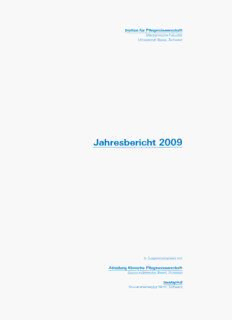Table Of ContentInstitut für Pflegewissenschaft
Medizinische Fakultät
Universität Basel, Schweiz
Jahresbericht 2009
In Zusammenarbeit mit
Abteilung Klinische Pflegewissenschaft
Universitätsspital Basel, Schweiz
Inselspital
Universitätsspital Bern, Schweiz
Herausgeberin
Institut für Pflegewissenschaft
Universität Basel
Bernoullistrasse 28
CH-4056 Basel
T +41(0)61 267 30 40
F +41(0)61 267 09 55
[email protected]
nursing.unibas.ch
Gesamtredaktion
Sabina De Geest, PhD, RN, FAAN, FRCN
Koordination & Gestaltung
Klara Remund
Konzept
Michael Huber
Druck
Schwabe AG, Muttenz
Dieses Werk, einschliesslich alle seiner Texte sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ausserhalb
der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Instituts für Pflegewissenschaft und der be-
teiligten Institutionen unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2010 Institut für Pflegewissenschaft, Medizinische Fakultät, Universität Basel
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort 6
1. Lehre 8
1.1 Weiterentwicklung des Studienganges Pflegewissenschaft 9
1.2 Studierende 9
1.3 PhD 13
2. Forschung 22
2.1 Allgemeine Übersicht 22
2.2 Projekte 24
3. Publikationen und Präsentationen 42
3.1 Publikationen 42
3.2 Präsentationen 51
3.3 Weitere Veröffentlichungen / Medienprodukte 63
4. Entwicklung des klinischen Feldes 64
4.1 Projekte 64
4.2 Dienstleistungen für die klinische Pflegepraxis 75
5. Fort- und Weiterbildungen 76
5.1 Vortragsreihen 76
5.2 Seminare und Kurse 78
6. Vernetzung 82
6.1 Kooperationen 82
6.2 Editoriale Aktivitäten 84
6.3 Kommissionsarbeiten 85
6.4 Andere Aktivitäten 86
7. Medienspiegel 88
8. Finanzen 90
8.1 Finanzierung INS 90
8.2 Finanzierung KPW 90
8.3 Finanzierung Akademie-Praxis-Partnerschaft INS – Insel 90
8.4 Gönner / Sponsoren 90
9. MitarbeiterInnen 91
9.1 Ehrungen & Preise 91
9.2 INS 91
9.3 KPW 93
9.4 Akademie-Praxis-Partnerschaft INS – Insel 93
UNIVERSITÄT BASEL | INSTITUT FÜR PFLEGEWISSENSCHAFT | JAHRESBERICHT 2009 5
VORWORT
Vorwort
Das Jahr 2009 hat für das Institut für Pflegewissenschaft (INS)1 einige innovative, Ver-
änderungen gebracht, die es bei der Entwicklung hin zu einem führenden Kompetenz-
zentrum in der pflegewissenschaftlichen Ausbildung, Forschung und Entwicklung der
klinischen Praxis einen weiteren Schritt nach vorne bringen werden.
Im Bereich der Lehre kann das INS auf eine richtungweisende Entscheidung der den
Studiengang «Master of Science in Nursing» beurteilenden Akkreditierungs kommission
(dem Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hoch-
schulen OAQ) hinweisen. Im Rahmen des bereits 2008 eingeleiteten Akkreditierungs-
verfahrens wurde das Master-Studienprogramm des INS anhand von internationalen
Vorschriften und definierten Standards auf die Erfüllung von qualitativen Minimalan-
forderungen hin überprüft. Der Entscheid der Schweizerischen Universitätskonferenz
(SUK) fiel auf Antrag des OAQ exzellent aus: Der Studiengang «Master of Science in
Nursing» wurde ohne Auflagen für sieben Jahre akkreditiert. Diese Anerkennung des
qualitativ hochstehenden Lehrangebots des INS ist eine grosse Bestätigung der bishe-
rigen erfolgreichen Arbeit des Instituts und ein weiterer Motivator beim ständigen Stre-
ben nach Verbesserung.
Weiterhin wurde im Jahr 2009 intensiv an der Revision des Master-Curriculums ge -
arbeitet, um die Lehrinhalte auch in Zukunft optimal an den neuen Herausforderungen
in der Gesundheitsversorgung des 21sten Jahrhunderts auszurichten. Zudem konnte
die sechste Promotion in Pflege wissenschaft am INS gefeiert werden.
Die Forschung kann im Jahr 2009 – auch dank bereits bestehender hervorragender
interdisziplinärer Vernetzung und internationaler Ausrichtung des INS – wieder eine
Vielzahl interessanter laufender Projekte vorweisen. Die Bandbreite unter den 21
laufenden Forschungsprojekten ist gross und reicht von aus Eigenmitteln finanzierten
Projekten bis zu einer von der Europäischen Union finanzierten grossangelegten
internationalen und multizentrischen Querschnittsstudie zur Entwicklung von
genaueren und zuverlässigeren Pflegepersonalplanungsmodellen für die nächsten 10
bis 20 Jahre. Das Institut für Pflegewissenschaft ist dabei Mitglied des elf europäische
und drei internationale Partnerländer umfassenden Konsortiums.
Die Forschungsschwerpunkte der Projekte lagen nach wie vor auf den Themen
«Patienten sicherheit und Pflegequalität», «Selbstmanagement von chronisch kranken
Menschen» sowie «Neue Versorgungsmodelle». Forschungsziel bleibt die Verbesserung
von Ergebnissen bei Patienten und Patientinnen mit chronischer Krankheit und deren
Angehörigen. Die Ergebnisse der aktiven Forschungstätigkeiten im INS spiegeln sich
in der umfangreichen Publikations- und Präsentationstätigkeit.
Eine wichtige, wegweisende Entscheidung gab es auch im Hinblick auf eine Intensi-
vierung der «Akademie-Praxis-Partnerschaft» zwischen dem INS und der Abteilung
Klinische Pflegewissenschaft (KPW) des Universitätsspitals Basel. Die bestehende
Zusammenarbeit zwischen dem INS und der KPW der letzten Jahre hat gezeigt, wie
fruchtbar eine Partnerschaft zwischen der Akademie und der Praxis für beide Seiten
sein kann. In dem Bestreben beider Partner, sich ständig weiterzuentwickeln und den
selbst gesetzten Ansprüchen an innovativem Denken und Handeln gerecht zu werden,
wurde weiter an der gemeinsamen strategischen Ausrichtung gearbeitet.
1 INS steht als Akronym für «Institute of Nursing Science» und ist die offizielle Abkürzung des Instituts
für Pflegewissenschaft
6 JAHRESBERICHT 2009 | INSTITUT FÜR PFLEGEWISSENSCHAFT | UNIVERSITÄT BASEL
VORWORT
Eine gemeinsame Vision und das Zusammenwirken beider Kräfte versprechen direk-
tere und positivere Resultate auf der operationalen Ebene für alle Beteiligten und eine
gestärkte Pflegewissenschaft in Basel.
Auch die Akademie-Praxis-Partnerschaft mit dem Inselspital Universitätsspital Bern
ist im Jahr 2009 gemäss dem gemeinsam beschlossenen Aktionsplan weiter erfolgreich
fortgesetzt worden und hat bereits zu einigen fruchtbaren Synergien geführt. Auch
hier gilt es für das kommende Jahr, die gemeinsamen Projekte weiterzuführen und
den Austausch von Wissen und Können auszubauen. Die Akademie-Praxis-Partner-
schaften sind hervorragende Instrumente zum Aufbau und zur Pflege von pflege-
wissenschaftlichen Netzwerken. Die Beteiligung aller Mitarbeiter, dem Kapital des
Instituts, an dieser Netzwerk-Arbeit ist auch nächstes Jahr ein wichtiges Ziel des INS.
Für die Zukunft wird es darum gehen, Akademie-Praxis-Partnerschaften mit ihrem
Innovationspotential schweizweit auszubauen und darüber hinaus das Institut als
führendes Exzellenz-Zentrum im Bereich Pflegewissenschaft nicht nur in der Schweiz
sondern in ganz Europa bekanntzumachen. So kann die an den zukünftigen Gesund-
heitsbedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtete Arbeit im Bereich der Lehre, der
Forschung und der Entwicklung der klinischen Praxis auf höchstem Niveau gesichert
werden.
Zum Abschluss sei noch ein Ausblick:
Wir freuen uns, im Jahr 2010 das 10jährige Jubiläum des Instituts
für Pflegewissenschaft feiern zu dürfen und laden schon jetzt alle
Interessierten ein, an unseren Jubiläums-Veranstaltungen teilzu-
nehmen!
UNIVERSITÄT BASEL | INSTITUT FÜR PFLEGEWISSENSCHAFT | JAHRESBERICHT 2009 7
INSEL KPW INS 1 LEHRE
1. Lehre
Im Lehrbereich war das Jahr 2009 im Wesentlichen durch das Akkreditierungs-
verfahren für den Masterstudiengang sowie verschiedene Aktivitäten im Rahmen der
Curriculum-Revision geprägt, während der Studienbetrieb im Berichtsjahr insgesamt
geordnet und ruhig verlief.
Der Auslöser für das Akkreditierungsverfahren und die Curriculum- Revision waren
zum einen die Entwicklungen in der akademischen Pflegeausbildung wie z.B. die
Etablierung von Bachelorstudiengängen Pflege im Fachhochschulbereich. Zum ande-
ren ging es darum, die demografischen und epidemiologischen Veränderungen und
ihre Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu berücksichti-
gen. Letztere vor allem unter dem Gesichtspunkt der dafür notwendigen (zuküntigen)
beruflichen Kompetenzen der professionellen Pflege sowie weiterer Fachleute. Diese
Entwicklungen erforderten eine differenzierte Überprüfung der Ausrichtung, Inhalte
und Qualität des Masterstudiengangs im Rahmen eines Akkreditierungsverfahrens
und der Curriculum-Revision.
Im Dezember 2008 hat das INS beim OAQ (Organ für Akkreditierung und Qualitäts-
sicherung der Schweizerischen Hochschulen) das Akkreditierungsverfahren eingeleitet.
Dieses Verfahren lief dreistufig ab: Zuerst nahm von Januar bis März 2009 eine INS
interne Arbeitsgruppe nach definierten Vorgaben eine strukturierte Selbstbeurteilung
vor und schloss diese mit einem detaillierten Bericht zuhanden des OAQ am 24. April
ab. Als Zweites fand im INS am 25. und 26. Mai eine externe Begutachtung durch eine
Gruppe von internationalen Experten und Vertretern des OAQ statt. Dabei führten sie
mit Führungs- und Lehrkräften, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Studierenden,
Alumnen und Vertretern der Universität und klinischen Praxis Einzel- und Gruppen-
interviews durch. Dannach dokumentierte die Expertengruppe ihre Eindrücke und
stellte dem Masterstudiengang ein deutlich positives Zeugnis im ihrem Schlussbericht
aus. Auf Grund des OAQ-Akkreditierungsberichts verfügte die Schweizerische Univer-
sitätskonferenz (SUK) schlussendlich am 3. Dezember 2009: «Der Master of Science
in Nursing Studiengang der Universität Basel wird ohne Auflagen für sieben Jahre
akkreditiert.» Dieses Ergebnis, das unseren Studiengang als qualitativ hochstehend
bewertet, würdigt den Enthusiasmus und die grossen Anstrengungen aller Beteiligten
in den letzten Jahren. Es ermutigt uns zudem, in der Lehre weiterhin umsichtig und
zielgerichtet – unter Einbezug unserer Forschungsprogramme und Aktivitäten zur
Entwicklung der klinischen Praxis – zu arbeiten.
Infolge der seit 2002 an Fachhochschulen eingerichteten Bachelorstudiengänge mel-
deten sich im Berichtsjahr neun Absolventinnen (2008: 5) mit einem Fachhochschul-
abschluss in Pflege für den INS-Masterstudiengang Pflege an. Das grosse Interesse
dieser Fachleute und ihre Motivation, ein universitäres Masterstudium anzugehen –
trotz der Auflagen, einzelne Semesterkurse nachzuholen –, bestärkt uns im Anliegen,
Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen einen Studienweg anzubieten, der
ihnen eine weiterführende akademische Laufbahn ermöglicht.
Die Studienberatung des INS wurde auch dieses Jahr via Email, Telefon und persön-
licher Sprechstunden mit rund 368 internen und externen Personenkontakten stark
frequentiert. Dabei fällt auf, dass die Mehrzahl der Interessierten sich bereits sehr gut
informierte z.B. durch die INS-Website. Auch stellten wir fest, dass der Beratungsbe-
darf für direkt ins Masterstudium einsteigende Personen durch die erforderlichen
Äquivalenzprüfungen bisheriger Studienleistungen deutlich höher liegt als in vorigen
Jahren.
8 JAHRESBERICHT 2009 | INSTITUT FÜR PFLEGEWISSENSCHAFT | UNIVERSITÄT BASEL
LEHRE 1 INSEL KPW INS
1.1 Weiterentwicklung des Studienganges Pflegewissenschaft
Angeregt durch die bereits genannten Entwicklungen und Erfordernisse für die
akademische Ausbildung von Pflegefachleuten beschlossen wir im Herbst 2008, das
Curriculum einer vertieften Analyse zu unterziehen. Die Analyse fokussierte einerseits
auf die Inhalte und andererseits auf methodisch-didaktische Aspekte der einzelnen
Semesterkurse. Damit konnten wir überprüfen, ob und in wieweit den Studierenden
die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, um beispielsweise mit
chronischen Krankheiten lebende Menschen zu beraten oder in ihren Selbstpflege-
fähigkeiten zu unterstützen. Als Analysekriterien dienten uns hierzu die von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) postulierten beruflichen Kernkompetenzen, über
welche die Gesundheitsfachkräfte verfügen müssen, um auf die Versorgungsbedürf-
nisse der Bevölkerung des 21. Jahrhunderts angemessen antworten zu können.
Diese fünf, aus internationaler Perspektive definierten Kernkompetenzen umfassen:
1) eine patientenzentrierte Versorgung anzubieten, 2) die Fähigkeit, z.B. mit Fachleuten
und Patienten Partnerschaften zu bilden, 3) Qualitätsverbesserung zu gewährleisten,
4) Informations- und Kommunikationstechnologien zu nutzen, sowie 5) eine Perspek-
tive der öffentlichen Gesundheit einzunehmen.
Aus der Analyse wurde deutlich, dass die Bereiche «patientenzentrierte Pflege»,
« Partnerschaften bilden» und «Informationstechnologien im Gesundheitsbereich nutzen»
im Masterstudium noch ausbaufähig sind. Dem wird bei der zukünftigen Kurs-
gestaltung durch entsprechende Vertiefung oder Erweiterung der Themenbereiche
Rechnung getragen.
Nebst dem Handlungsbedarf, der sich aus den Befunden der inhaltlichen Analyse ergab,
setzten wir uns auch mit internationalen Trends in der Hochschulbildung auseinander,
die sich im Kontext mit Bologna abzeichnen. Hier ist beispielsweise ein wichtiger Per-
spektivenwechsel erkennbar. Von der Perspektive des «Lehrers», der die Studieninhalte
nach Lehrzielen vermittelt, hin zur Perspektive des Studierenden, der als Folge des
«Studierens» befähigt wird. Vereinfachend gesagt, geht es nicht mehr länger um die
Frage «Was alles hast du studiert, um deinen Titel zu erlangen?», sondern vielmehr um
«Was kannst du nun, nachdem du deinen Titel erworben hast?»
In der Curriculum-Revision haben wir diesen Aspekt berücksichtigt und damit begon-
nen, unsere einzelnen Lehrangebote zu überprüfen. Dieser Prozess, bei dem wir die
einzelnen Semesterkurse auf ihre allgemeinen und spezifischen Lehr- und Lernziele
und die Evaluation der studentischen Leistungen beleuchten, wird im Sommer 2010
abgeschlossen sein. Dann werden z.B. die Lernziele unserer Semesterkurse im Sinne
des o.g. Perspektivenwechsels als sogenannte «learning outcomes» formuliert sein, die
deutlicher als heute zeigen, zu was Studierende nach erfolgreichem Kursabschluss
befähigt sind.
1.2 Studierende
Im Herbstsemester waren insgesamt 87 Studierende immatrikuliert (Tab. 1), davon
begannen 29 Personen (20 Bachelor, 9 Master) neu mit dem Studium. Die Wohnorte
der Studierenden im Studienjahr 2008 / 2009 verteilten sich wie folgt: Kanton Zürich
(25%), Kanton Bern (21%), beider Basel (16%), Aargau und Solothurn (14%), Zentral-
schweiz (5%), Ostschweiz (3%), Westschweiz (5%) und Deutschland (11%). Die Studie-
renden sind nach eigenen Angaben im Mittel zu 53% berufstätig.
UNIVERSITÄT BASEL | INSTITUT FÜR PFLEGEWISSENSCHAFT | JAHRESBERICHT 2009 9
Mit Brief und Siegel:
Die Akkreditierung des Studiengangs «Master of Science in Nursing»
René Schwendimann, PhD, RN
Das INS hat mit dem erfolgreich durchgeführten Akkreditierungsverfahren seines Studien-
gangs «Master of Science in Nursing» einen weiteren Schritt zur nachhaltigen Qualitätssiche-
rung im Lehrbereich getan. Die Akkreditierung stellt ein formales und transparentes Verfahren
dar, das anhand von definierten Standards überprüft, ob ein Studienprogramm qualitative
Minimalanforderungen erfüllt. Das schweizerische, von der OAQ durchgeführte Akkreditierungs-
verfahren beruht auf den besten internationalen Praktiken. Es umfasst eine interne Selbstbe-
urteilung des Studiengangs und eine externe Begutachtung durch eine Gruppe unabhängiger
Experten / Expertinnen. Während dieser beiden Etappen werden festgelegte Bereiche, auf die
sich Qualitätsstandards beziehen, einer Prüfung unterzogen. Die Phase der Selbstbeurteilung
spielt eine grundlegende Rolle für den Qualitätsverbesserungsprozess und wird in der Folge
kurz vorgestellt.
Die Selbstbeurteilung
Die Selbstbeurteilung ist die Grundlage für das Akkreditierungsverfahren. Dazu wurde eine
Steuerungsgruppe (Mitglieder s.u.) eingesetzt. Deren Mitglieder vertraten verschiedene für den
Studiengang relevante Bereiche und wirkten bei der Erstellung des Selbstbeurteilungsberichts
mit. Die Selbstbeurteilung enthält sechs Prüfbereiche mit insgesamt 16 Qualitätsstandards zum
Studiengang (s. Seite 11), denen Fragen und Referenzpunkte (Erwartungen) zugeordnet waren.
Hierzu nahm das INS im einzelnen Stellung, die in einem Bericht dokumentiert wurde. In diesem
Selbstbeurteilungsbericht wurde der Studiengang umfassend anhand der Qualitätsstandards
beschrieben und analysiert. Zudem wurden zu jedem Prüfbereich die Stärken, Schwächen und
Perspektiven des Studiengangs abschliessend zusammengefasst. Der Selbstbeurteilungsbericht
bildete die Informationsgrundlage, anhand derer die internationale Expertengruppe während
ihrer Vor-Ort-Visite die Verwirklichung der Standards prüfte und beurteilte.
Der Akkreditierungsbericht ist auf der Website des OAQ abrufbar (www.oaq.ch)
Steuerungsgruppe Selbstbeurteilung
Leiter Steuerungsgruppe
Dr. René Schwendimann, Leiter Bereich Lehre, INS
Vertretung Institutsleitung
Prof. Dr. Sabina De Geest, Leiterin des INS
Vertretung Administration
lic. iur. Greet van Malderen, Leiterin Administration des INS
Vertretung Akademisches Personal
Prof. Dr. Rebecca Spirig, Leiterin KPW
Vertretung Studierende
Hanna Burkhalter, MSN
Vertretung Medizinische Fakultät
Prof. Dr. J. Hedwig Kaiser, Studiendekanin, Medizinische Fakultät
Vertretung Externe
Prof. Em. Dr. André P. Perruchoud
1100 JJAAHHRREESSBBEERRIICCHHTT 22000099 || IINNSSTTIITTUUTT FFÜÜRR PPFFLLEEGGEEWWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT || UUNNIIVVEERRSSIITTÄÄTT BBAASSEELL
Prüfbereiche und Qualitätsstandards zum Akkreditierungsverfahren
1. Prüfbereich: Durchführung und Ausbildungsziele
Standard 1.1: Das Studienangebot wird regelmässig durchgeführt
Standard 1.2: Der Studiengang verfolgt Ausbildungsziele, welche dem Leitbild und der
strategischen Planung der Institution entsprechen.
2. Prüfbereich: Interne Organisation und Qualitätssicherungsmassnahmen
Standard 2.1: Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind
festgelegt und allen beteiligten Personen kommuniziert
Standard 2.2: Die aktive Teilnahme des wissenschaftlichen Personals und der Studierenden
an Entscheidungsprozessen, welche Lehre und Studium betreffen, ist gesichert.
Standard 2.3: Für die Studiengänge bestehen Qualitätssicherungsmassnahmen. Die Institution
verwendet die Resultate zur periodischen Überarbeitung des Studiengangangebotes
3. Prüfbereich: Curriculum und Ausbildungsmethoden
Standard 3.1: Der Studiengang verfügt über einen strukturierten Studienplan, welcher der
koordinierten Umsetzung der Erklärung von Bologna an den universitären Hochschulen der
Schweiz entspricht
Standard 3.2: Das Studienangebot deckt die wichtigsten Aspekte des Fachgebiets ab. Es
ermöglicht den Erwerb wissenschaftlicher Arbeitsmethoden und gewährleistet die Integration
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die angewandten Ausbildungs- und Beurteilungsmethoden
orientieren sich an den festgelegten Ausbildungszielen.
Standard 3.3: Die Bedingungen für den Erwerb von Leistungsnachweisen und von akademi-
schen Abschlüssen sind geregelt und veröffentlicht.
4. Prüfbereich: Lehrkörper
Standard 4.1: Der Unterricht wird durch didaktisch kompetente und wissenschaftlich
qualifizierte Lehrende erteilt.
Standard 4.2: Die Gewichtung von Lehr- und Forschungstätigkeiten der Lehrenden ist
definiert .
Standard 4.3 Die Mobilität der Lehrenden ist möglich.
5. Prüfbereich: Studierende
Standard 5.1: Die Bedingungen zur Aufnahme in das Studium bzw. in den Studiengang sind
öffentlich kommuniziert.
Standard 5.2: Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist verwirklicht.
Standard 5.3: Die studentische Mobilität ist möglich und wird durch interuniversitäre sowie
fächerübergreifende Anerkennung von Studienleistungen gefördert.
Standard 5.4: Für eine angemessene Studienbetreuung ist gesorgt.
6. Prüfbereich: Sachliche und räumliche Ausstattung
Standard 6.1: Dem Studiengang stehen genügend Ressourcen zur Verfügung, um seine Ziele
umzusetzen. Die Ressourcen sind langfristig verfügbar.
Das OAQ-Akkreditierungs siegel
UNIVERSITÄT BASEL | INSTITUT FÜR PFLEGEWISSENSCHAFT | JAHRESBERICHT 2009 11
INSEL KPW INS 1 LEHRE
Tab. I – Studierenden 2009
Total Vollzeitstudium Frauenanteil Mittleres Alter
BSN 29 38 % 76 % 38 (26-49) Jahre
MSN 52 35 % 90 % 39 (27-53) Jahre
PhD 6 – 40 (29-41) Jahre
Total 87 –
An der Graduierungsfeier vom 19.11.2009 konnten 18 Personen ihr Bachelordiplom
und 14 Personen ihr Masterdiplom in Empfang nehmen. Die Namen der erfolgreichen
Masterabsolventinnen und -absolventen sowie die Titel ihrer Masterarbeiten sind
nachfolgend beschrieben. Die Zusammenfassungen ihrer Masterarbeiten können auf
der Website des INS eingesehen werden.
Der Preis der Stiftung Pflegewissenschaft Schweiz für die beste pflegewissenschaftliche
Masterarbeit 2009 an der Universität Basel ging an Valérie Gardaz für ihre Arbeit:
«Nurses' experiences of caring for dying patients after treatment withdrawal in a Swiss
ICU: a phenomenological study»
Elisabeth Althaus
Kenntnisse von Spitex-Angeboten und Bedürfnisse älterer Menschen an die Spitex
Hanna Burkhalter
Validity of two sleep quality items for the Swiss Transplant Cohort Study in renal transplant
recipients
Susanne D'Astolfo
Ein Evaluationsprojekt zur Einschätzung des häuslichen Versorgungsbedarfs hoch betagter
Menschen im Anschluss an eine Hospitalisation. Akutspital und Spitex im Vergleich
Paul Flühmann
Informationsangebot über Infektionskrankheiten für Insassen einer Strafanstalt
Valérie Gardaz
Nurses' experiences of caring for dying patients after treatment withdrawal in a Swiss ICU:
a phenomenological study
Brigitte Gloor
Wirkung einer Schulung Pflegender zur Diagnose Herzinsuffizienz: Eine experimentelle Studie
Eva Horvath
Ja, wir Alte haben gewöhnlich mit den Füssen zu tun – Präventive Fusspflege bei Menschen
mit Diabetes
Monika Kirsch
Self-reported symptoms and concerns in long-term survivors after Haemopoietic Stem Cell
Transplantation
Margrit Müller
Wir machen das Beste daraus – eine qualitative Studie zu den Erfahrungen von Eltern
erwachsener Menschen mit Epilepsie
12 JAHRESBERICHT 2009 | INSTITUT FÜR PFLEGEWISSENSCHAFT | UNIVERSITÄT BASEL
Description:in der Unfallbewältigung, auf der orthopädischen Chirurgie am Inselspital Universitätsspital. Bern: Eine qualitative ANP+ICN+Website+final+3-1-2009.pdf. International Council of Anja Tschannen: Prävalenzerfassung von Malnutrition auf chirurgischen Stationen und der. Gynäkologie des USB: