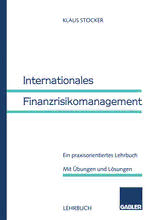Table Of ContentStocker· Internationales Finanzrisikomanagement
KLAUS STOCKER
Internationales
Finanzrisikomanagement
Ein praxisorientiertes Lehrbuch
Mit Übungen und Lösungen
LEHRBUCH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahrne
Stocker, Klaus:
Internationales Finanzrisikomanagement : ein praxisorientiertes
Lehrbuch; mit Übungen und Lösungen / Klaus Stocker.
-Wiesbaden: Gabler, 1997
ISBN 978-3-409-12608-3 ISBN 978-3-322-99348-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-99348-9
Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen der Berte1smann Fachinformation.
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Tb. Gabler GmbH, Wiesbaden 1997
Lektorat: Jutta Hauser-Fahr
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und stratbar. Das gilt insbe
sondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produktion und
Auslieferung unserer Bücher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses Buch ist auf säurefreiem und
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne
der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürften.
VORWORT
Die Globalisierung der internationalen Finanz- und Devisenmärkte ist
schneller und radikaler vonstatten gegangen als auf den Gütermärkten. Der
Zusammenbruch der Barings Bank wie auch die bisher erlebten Probleme
großer deutscher Unternehmen auf den internationalen Finanzmärkten wer
den nicht die letzten Signale dafür sein, daß hier ein unnachsichtiges Tempo
herrscht. Das Interesse der Allgemeinheit an diesen Problemen zeigt, daß die
Menschen die Abhängigkeit und auch die Gefahren spüren, die daraus aufd ie
Binnenwirtschaji ausstrahlen. Deshalb wird heute auch die Frage, ob der
Euro kommt, nicht mehr nur in exklusiven Zirkeln diskutiert, und der tägliche
US $-Kurs findet sich interessanterweise noch vor dem Wetterbericht auf der
ersten Seite fast jeder Tageszeitung.
Verlängerte Werkbänke, weltweite Beschaffung ("Global sourcing'') und in
ternationale Verflechtung zwingen das Management in den Unternehmen, sich
mit internationalen Finanzfragen intensiver als bisher zu befassen: Wie wird
ein Wechselkursrisiko abgesichert, wie kann für einen interessanten Auftrag
aus Rußland oder Indien ein Finanzierungsmodell konstruiert werden, wie
kann ein Unternehmen durch einen "Cap" oder einen "Collar" von niedrigen
Zinsen im Ausland profitieren? Die Beantwortung dieser Fragen ist kein
Luxus, weil Rationalisierungspotentiale im Produktions bereich ausgeschöpft
sind und weil komparative Vorteile fast nur noch im Dienstleistungsbereich
und damit auch bei der Finanzierung erreicht werden können. Das Stichwort
heißt ''jinancial engineering" und hier haben vor allem die deutschen
Unternehmen einen gewaltigen Nachholbedarf Eine intelligente Absicherung
von Währungsrisiken oder ein ''global shopping" bei Forfaitierungs-,
Leasing- oder Kreditangeboten ermöglichen Kostenersparnisse, die im
Preiswettbewerb entscheidend sein können.
Leider muß neben der Sicherung von Kostenvorteilen aber auch auf das Ver
meiden von Verlusten durch Auslandsrisiken geachtet werden. Kostenvorteile
sollte ein Exporteur nicht bei der Spekulation um japanische Aktien-Futures
erzielen, sondern durch angepaßte Vertragsgestaltung und Absicherung ver
bleibender Risiken in "seinem" Bereich. Die internationale Spekulation ist ein
Nullsummenspiel oder, wie es ein ungenannter Devisenhändler einmal trö-
VI
stend formuliert hat: ''Ihr Geld ist nicht verschwunden, es ist nur woanders".
Deshalb ist es ein ganz wesentliches Anliegen dieses Buches, den Unterschied
zwischen Spekulation einerseits und dem bewußten Eingehen eines kalkulier
ten Risikos andererseits begreiflich zu machen: Wichtigste Anfangslektion des
Risikomangagements ist es dabei, den (fast) jedem internationalen Banker
klaren Unterschied zwischen einer "offenen" und einer "geschlossenen"
Risikoposition verstehen zu lernen.
Das Buch ist über einen längeren Zeitraum im fallstudienbezogenen Lehrbe
trieb wie auch im Kontakt mit exportierenden Unternehmen und Banken
"gewachsen" und es versucht, die Probleme weniger aus der Sicht der Banken
zu sehen, sondern aus Sicht des auslandsorientierten Unternehmens. Es ist in
der täglichen Diskussion mit Studierenden und Praktikern eine banale
Erkenntnis zutage getreten: Viele der scheinbar einfachen internationalen
Zusammenhänge, die jeder gerne als Schlagwort im Munde führt, werden von
den wenigsten wirklich begriffen. Ex-Bundeskanzler Schmidt wirft sogar den
Vorständen deutscher Banken vor, daß sie viele Konstruktionen gar nicht
verstünden, die ihre hochbezahlten Händler jeden Tag in ihrem Auftrag aus
führen.
Neben der Schaffung einer bewußten Einstellung zum Risiko ist es ein
Hauptanliegen des Buches daher, das internationale Instrumentarium Schritt
für Schritt zu erarbeiten und mit Übungsfragen und Fällen am Ende eines
jeden Kapitels dem Leser eine Überprüfung seines Verständnisses zu ermögli
chen. Lösungshinweise finden sich im Anhang; nicht nur für Vorstände, son
dern für alle, die sich aktuelles Wissen wirklich aneignen wollen.
Aus der englischsprachigen Literatur kommt die sicherlich sinnvolle Übung,
auch komplizierte Überlegungen an einem möglichst konkreten Beispiel deut
lich zu machen. Deshalb wird auch im Text selbst großer Wert auf praxis
nahe, wenn auch sinnvoll vereinfachte Beispiele gelegt. Dabei wurde gleich
zeitig der Anspruch auf eine theoretische Untermauerung nicht aufgegeben,
immer wieder ist versucht worden, die wichtigen Auswirkungen internationa
ler volkswirtschaftlicher Phänomene auf konkrete betriebswirtschaftliche
Fragen deutlich zu machen.
Klaus Stocker
INHALT
Kapitel I: Bedeutung der Finanzierung im Auslandsgeschäft .............................. 1
1.1 Finanzierung als Überbrückung von Zeiträumen ..................................... 1
1.2 Die internationale Dimension der Finanzierung ...................................... .4
1.3 Finanzmanagement versus Risikovermeidung ......................................... 7
1.4 Die Bereiche der Internationalen Finanzierung ........................................ 8
1.5 Vier wichtige Gründe fur die Sonderrolle der Finanzierung im
Auslandsgeschäft .................................................................................... 12
1.5.1 Lieferzeit ................................................................................... 12
1.5.2 Unbekannte Partner ................................................................... 13
1.5.3 Unterschiedliche Währungen und schwankende Wechselkurse .. 14
1.5.4 Finanzierung als Marketinginstrument ....................................... 16
1.6 Organisation des Internationalen Finanzbereichs ..................................... 18
Kontrollfragen zu Kapitel I: ......................... '" .................................... 20
Kapitel 11: Die Risiken im Auslandsgeschäft ........................................................ 21
2.1 Die Begriffe Risiko, Chance und Wahrscheinlichkeit.. ............................ 21
2.2 Tragweite und Finanzrisiko ..................................................................... 24
2.3 Statistische und subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit.. .......................... 27
2.4 Risikokategorien im Auslandsgeschäft .................................................... 29
2.4.1 Das Geschäftsrisiko ("wirtschaftliches Risiko") ......................... 29
2.4.2 Das politische oder Länderrisiko ................................................ 32
2.4.2.1 Transfer- und Konvertierungsrisiko .............................. 33
a. Varianten der Zahlungsunfähigkeit ............................ 33
b. Ursachen von Devisenschwächen .............................. 35
2.4.2.2 Das Dispositions-und Enteignungsrisiko ..................... 38
2.4.3 Das Wechselkursrisiko ............................................................. .42
2.4.4 Das Zinsrisiko ........................................................................... 45
2.5 Die Alternativen: Risikovermeidung, Risikostreuung, ............................ .46
2.5.1 Risikovermeidung ...................................................................... 46
VIII
2.5.2 Risikostreuung ........................................................................... 49
2.5.3 Risikoabwälzung ....................................................................... 53
Kontrollfragen zu Kapitel 11 ......................................................................... 57
Kapitel III: Die Beschaffung von Information zur Risikoabschätzung ............... 59
3.1 Kenntnis des Geschäftsrisikos ................................................................. 60
3.2 Die Kenntnis des Länderrisikos ............................................................... 65
3.2.1 Subjektive Modelle der Länderevaluierung ("Experten-
Rating") ..................................................................................... 67
3.2.2 Quantitative Bewertungsmodelle ............................................... 71
3.2.2.1 Zahlungsbilanzdaten .................................................... 71
3.2.2.2 Verschuldungskennzahlen ............................................ 75
a.) Devisenreserven ....................................................... 75
b.) Auslandsschulden und Schuldendienstquote ............. 76
c.) Schuldenquote (debt export ratio) ............................. 77
d.) Entschuldungsdauer ................................................. 78
3.2.2.3 Außenhandelsstrukturdaten .......................................... 81
a.) Außenabhängigkeit ................................................... 81
b.) Importstruktur .......................................................... 81
c.) Importsubstitutionsfähigkeit ..................................... 82
3.2.2.4 Allgemeine Wirtschafts-und Strukturdaten .................. 82
3.2.2.5 Internationale "Vertrauensbewertungsindices" ............. 84
3 .2.3 Grenzen der Aussagefähigkeit von Länderbewertungen ............. 84
3.2.4 Das Beispiel Brasilien ............................................................... 86
3.2.5 Oberflächliche Betrachtung oder Ursachenforschung? ............... 90
3.2.6 Der Sinn der Länderevaluierung für konkrete
Entscheidungsabläufe im Unternehmen ..................................... 93
3.3 Die Kenntnis des Wechselkursrisikos ...................................................... 96
3.3.1 Die Kaufkraftparitätentheorie .................................................... 97
3.3 .1.1 Der Wechselkurs als Ausdruck der Preise .................... 97
3.3.1.2 Der reale effektive Wechselkurs ................................... 102
3.3.1.3 Inflationsimport bei flexiblen Wechselkursen ............... 106
3.3.2 Zinsparität und Portfoliogleichgewicht ...................................... 107
3.3 .2.1 Das kurzfristige Gleichgewicht .................................... 107
3.3.2.2 Das langfristige Gleichgewicht.. ................................... l11
IX
3.3.3 Chart-Analyse ............................................................................ 115
Kontrollfragen und Übungen zu Kapitel III ................................................... 123
Kapitel IV: Kommerzielle Instrumente der Risikobegrenzung ............................ 125
4.1 Absicherung des Zahlungsverkehrs ......................................................... 126
4.l.1 Vorauszahlung und Bankgarantie ............................................... 126
4.1.2 Dokumenteninkasso ................................................................... 127
4.l.3 (Dokumenten-)Akkreditiv .......................................................... 128
4.1.4 Risikominderungsfunktionen der dokumentären
Zahlungsforrnen ........................................................................ 130
4.2 Exportkreditversicherung ........................................................................ 132
4.2.1 Das Angebot .............................................................................. 132
4.2.2 Exportkreditversicherungen anderer Länder.. ............................. 134
4.2.3 Die Herrnes-Länderkategorien ................................................... 136
4.2.4 Der Liefervertrag ....................................................................... 137
4.2.5 Standarddeckungsforrnen und Entgelte ...................................... 138
4.2.5.1 Fabrikationsrisikodeckung ............................................ 138
4.2.5.2 Ausfuhrrisikodeckung .................................................. 139
4.2.5.3 Finanzkreditdeckung .................................................... 142
4.2.5.4 Wechselkursdeckung .................................................... 144
4.2.5.5 Sonderforrnen ............................................................... 146
4.2.6 Pauschale Deckungsforrnen ....................................................... 147
4.2.7 Entscheidungsablauf .................................................................. 147
4.3 Forfaitierung ........................................................................................... 148
4.3.1 Finanzierungs-und Risikoübernahmefunktion .......................... ; 148
4.3.2 Die Berechnung der Kosten einer Forfaitierung ......................... 150
4.3.2.1 Der Diskont. ................................................................. 150
4.3.2.2 Dynamische Berechnungsmethoden ............................. 151
4.3.2.3 Vergleich einer Forfaitierung mit einem
Euromarktkredit ........................................................... 154
4.3.2.4 Yie1d, Diskont und interner Zinsfuß ............................. 159
4.3.3 Vorteile der Forfaitierung .......................................................... 162
x
4.4. Die Beteiligung von Sonderkreditinstituten ............................................ 163
4.4.1 Die Exportkredite der AKA ....................................................... 164
4.4.2 Kreditanstalt fiir Wiederaufbau .................................................. 167
4.4.3 Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen
in Entwicklungsländern (DEG) ........................................................... 170
4.5 Euromarktkredite .................................................................................... 171
4.6 Auslandsfactoring ................................................................................... 173
4.7 Leasing im Auslandsgeschäft .................................................................. 175
4.8 Projektfinanzierungen ............................................................................. 177
4.8.1 Projektfinanzierung über private Banken ................................... 178
4.8.2 Institutionelle Projektfmanzierung ............................................. 179
4.8.3 Betreibermodelle ....................................................................... 182
4.9 Die Bedeutung der Dokumentation fiir das financial
engineering ............................................................................................. 184
Zusammenfassung zu den kommerziellen Instrumenten der
Risikobegrenzung ......................................................................................... 186
Kontrollfragen zu Kapitel IV: ....................................................................... 190
Kapitel V: Absicherung des Wechselkursrisikos .................................................. 191
5.1 Devisen-und Devisenhandel.. ................................................................. 192
5. 1.1 Allgemeines ............................................................................... 192
5.1.2 Die Kurse am Devisenmarkt ...................................................... 196
5.1. 3 Das Risiko der Banken im Devisenhandel... ............................... 199
5.1.4 Die amtliche Kursfestsetzung ("Fixing") .................................... 204
5.1.5 Währungen der Welt.. ................................................................ 210
5.1. 6 Das europäische Währungssystem ............................................. 213
5.1.6.1 Teilnehmer und Bandbreiten ........................................ 213
5.1.6.2 Der "Euro" als europäische Währung ........................... 219
5.2 Der Devisenterminmarkt ......................................................................... 224
5.2.1 Unterschiede zum Kassamarkt.. ................................................. 224
5.2.2 Die Notierungen des Devisenterminmarktes .............................. 225
5.2.3 Ablauf eines Devisentermingeschäfts ......................................... 228
5.2.4 Der effektive Swap .................................................................... 233
XI
5.2.5 Tenninkurse und KurselWartungen ............................................ 235
5.3 Devisenoptionen ..................................................................................... 238
5.3.1 Notierungen und Grundgeschäfte ............................................... 239
5.3.2 Devisenoptionen als Spekulationsinstrument ............................. 246
5.3.3 Devisenoptionen im Import-und Exportgeschäft ....................... 248
5.3.4 Hedging bei Devisenoptionen .................................................... 254
5.3.5 Währungsoptionen als Absicherung bei
internationalen Ausschreibungen .............................................. 261
5.4 Der Aufbau einer "Gegenposition" durch Futures .................................... 264
5.5 Geldmarktabsicherung ("Zinsarbitrage") ................................................. 271
5.5.1 Geschäftsablauf einer Zinsarbitrage ........................................... 271
5.5.2 Parallelität von Swap und Zinsdifferenz ..................................... 277
5.6 Netting von Zahlungsströmen .................................................................. 281
5.7 Wechselkursabsicherung und Hermes ..................................................... 285
5.8 Flexible Währungsvereinbarungen .......................................................... 288
5.8.1. Gleitklauseln ............................................................................. 288
5.8.2 Währungskörbe .......................................................................... 293
Kontrollfragen zu Kapitel V .......................................................................... 295
Anlage 5.1: Devisenkurse und Cross-Rates ......................................... 298
Anlage 5.2: Devisenterminkurse, -optionen und
Geldmarktsätze auf dem Euromarkt .................................................... 299
Kapitel VI: Internationale Zins risiken .................................................................. 301
6.1 Zinsswaps ............................................................................................... 305
6.2 Zins-/Währungsswaps ............................................................................. 309
6.3 FOlWard-Rate Agreements ....................................................................... 310
6.4 Caps, Floors und Collars ......................................................................... 311
6.5 Swaptions ............................................................................................... 315
6.6 Zins-Futures ............................................................................................ 315