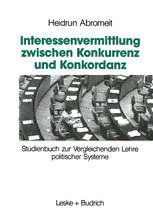Table Of ContentHeidrun Abromeit, Interessenvermittlung
zwischen Konkurrenz und Konkordanz
Heidrun Abromeit
Interessenvermittlung
zwischen Konkurrenz
und Konkordanz
Studienbuch zur
Vergleichenden Lehre
politi scher Systeme
+
Leske Budrich, Opladen 1993
ISBN 978-3-8100-1134-3 ISBN 978-3-322-96029-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-96029-0
© 1993 by Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung
auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags
unzuliissig und strafbar. Das gilt insbesondere flir Vervielfaltigungen, Ubersetzungen, Mi
kroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Einfiihrung ............................................................................... 7
1. Zum Begriff des Interesses und zum Problem
seiner Vermittlung ........................................................ 13
l.l. Der Interessenbegriffund die "realistische Utopie" des
Liberalismus .................................................................... 13
l.2. Das Problem der Objektivierbarkeit von Interessen ................... 16
1.3. Das Interesse: ein komplexer Begriff. .................................... 19
1.4. Interessenvermittlung: das Problem ...................................... 21
2. Interessenvermittlung: die Akteure ................................ 23
2.l. Typen der Interessenvermittlung .......................................... 23
2.2. Die Akteure: Interessen, Funktionen, Handlungsimperative ........ 26
2.2.l. Die Biirger ...................................................................... 26
2.2.2. Die Parteien .................................................................... 29
2.2.3. Die Verbande ................................................................... 35
2.2.4. Die Biirokratie ................................................................. 42
2.2.5. Die Justiz ........................................................................ 46
2.3. Typische Interaktionsmuster ................................................ 48
2.4. Entscheidungsregeln ......................................................... 53
3. "Herrschaft der Parteien"? Die Konkurrenzdemokratie .. 58
3.1. Der Idealtyp Zweiparteiensystem und seine Funktionslogik ........ 58
3.2. Parteienkonkurrenz im Zweiparteiensystem ............................ 63
3.2.l. Gro.Bbritannien ................................................................. 63
3.2.2. Die Zwei-Parteien-Mechanik in der Bundesrepublik ................. 74
3.3. Parteienkonkurrenz im Vielparteiensystem ............................. 85
3.3.1. Vielparteiensysteme: "Prototyp" und Funktionslogik ................. 85
5
3.3.2. Italien ............................................................................ 89
3.4. Die USA: ein Sonderfall.. ................................................. 101
3.5. Fazit ............................................................................ 114
4. "Herrschaft der Regionen"? Der Foderalismus ............ 116
4.l. Der Iooeralistische Idealtyp und seine Funktionslogik ............. 116
4.2. FOderalismus in der Praxis ................................................ 123
4.2.l. USA ............................................................................ 123
4.2.2. Schweiz ........................................................................ 129
4.3. Zur Vereinbarkeit von Parteien-und Bundesstaatlichkeit:
die Bundesrepublik ......................................................... 13 5
4.4. Fazit ............................................................................ 144
5. "Herrschaft der Verbande"? Der Korporatismus .......... 146
5.l. Der korporatistische IdeaItyp und seine Funktionslogik ........... 146
5.2. Korporatismus in der Praxis .............................................. 152
5.2.l. Die osterreichische "Soziaipartnerschaft" ............................. 152
5.2.2. Die "Konzertierte Aktion" in der Bundesrepublik ................... 166
5.3. Ein nicht-korporatistischer Verbandestaat: Die Schweiz .......... 171
5.4. Fazit ............................................................................ 175
6. "Herrschaft Aller"? Die Konkordanzdemokratie .......... 177
6.l. Zur Funktionslogik der Konkordanz ................................... 177
6.2. Konkordanz in der Praxis: Die Schweiz ............................... 183
7. "Herrschaft der Vernunft"?
Zur Rolle "neutraler" Akteure ..................................... 199
7.l. Die neutrale Gewalt und die Huter der Verfassung ................. 199
7.2. Die "Republik der Beamten": Frankreich ............................. 202
7.3. Justizialisierung der Politik: Die Bundesrepublik ................... 214
8. Interessenvermittlung zwischen Immobilismus
und demokratischem Anspruch ................................... 221
Literaturverzeichnis ............................................................. 230
Sachregister ......................................................................... 238
6
Einfuhrung
Die biirgerliche Gesellschaft gilt allgemein als individualistische; "im
Mittelpunkt steht der Mensch" (wie Werbeslogans uns gem weismachen),
und zwar als Einzel-Konsument wie als Einzel-Wahler. Basis dieser Ge
sellschaftsformation ist indessen nicht das Individuum all' sich, sondem
sein Interesse. Wie gleich zu sehen sein wird, ist sein Interesse nicht iden
tisch mit seinen Bediirfnissen, Wiinschen, Strebungen; es ist nicht einmal
identisch mit deren (abstrahierendem) Substrat, sondem stets schon geseIl
schaftlich vermittelt. Das "authentische" Interesse des Individuums exi
stiert nur in der Utopie, in einer "Welt ohne Gesellschaft".
Insofem lieBe sich sagen, daB VermittIungsprozesse die Gesellschaft
konstituieren. Die biirgerliche Gesellschaft wiederum konstituiert sich -
zumindest insoweit sie sich als demokratische versteht -durch Prozesse der
Interessenvermittlung. Damit ist von vornherein nicht nur betrachtliche
Komplexitat, sondem vor allem auch die QueUe vieif<i1tiger Verzerrungen,
besser: der Abweichungen vom gedachten Ideal der Authentizitat, gesetzt;
denn nicht die Bediirfnisse der Individuen sind der relevante Input oder
steuem gar - "vermittelt" - den sozio-okonomisch-politischen ProzeB, son
dem Interessen, die ihrerseits erst durch gesellschaftliche Vermittlung
entstehen.
Ais demokratische legitimiert die biirgerliche Gesellschaft sich durch
die Bindung gesamtgesellschaftlicher Entscheidungen an diese gesell
schaftlichen (sprich Individual-) Interessen. Die Legitimitat demokrati
scher Systeme basiert also auf funktionierender Interessenvermittlung.
Ungliicklicherweise fehlenjedoch die letztgiiltigen Kriterien dafiir, was das
"Funktionieren" ausmacht; es gibt keine a priori richtige Interessenvermitt
lung, ebenso wenig wie es a priori wahre (authentische, objektive) Interes
sen gibt. Von daher ist die Legitimitat politi scher Systeme wie staatlicher
Entscheidungen stets bruchig: Stets lassen sich ihnen Abweichung, Verzer
rung, Manipulation der "eigentlichen" Interessenlage vorwerfen. Das ent
hebt nicht von der Notwendigkeit, an der MeBlatte "Riickbindung an die
7
gesellschaftlichen Interessen" festzuhalten - urn so mehr, als seit einiger
Zeit in nahezu allen westlich-demokratischen Staaten der Eindruck wach
sender Abgehobenheit der politischen Klasse sich aufdrangt, Politikver
drossenheit sich ausbreitet und die Legitimitiitsgrundlagen erodieren.
Bei der Untersuchung von Prozessen und Systemen der Interessenver
mittlung befindet man sich demnach auf schwankendem Boden, besonders
in normativer Hinsicht. Denn wahrend Interessenvermittlung einerseits so
unvermeidlich wie legitimatorisch unabdingbar ist, haftet der Interessen
durchsetzung im offentlichen BewuBtsein haufig etwas Aruiichiges an. Der
Begriff Interesse enthalt die Konnotation des Egoistischen und Partikula
ren, das der Realisierung des Gemeinwohls entgegensteht. Der Interessierte
urteilt nicht mehr objektiv; die "interessierten Kreise" kungeln und kochen
ihr Stippchen zum Schaden der Aligemeinheit; darum ist "Herrschaft der
Interessen" -gar der Interessenten -das Gegenteil der "Herrschaft der Ver
nunft". Vor allem gilt dieses Vorurteil dort, wo Interessen sich organisie
ren: Die Organisation erweckt den Verdacht, die betreffende Gruppe wolle,
zum Schaden der anderen, das Gemeinwohl usurpieren. Die negative Be
wertung bezieht sich dabei nicht etwa auf die mit der offentlichen Defini
tion eines jeden Interesses gegebene Moglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit
seiner Verzerrung, sondem schon allein auf die Interessiertheit schlecht
hin: Sie sei es, die den Blick auf die vemiinftige Ordnung verstelle.
Das Vorurteil speist sich aus zwei anderen: der Vorstellung, das Ge
meinwohl sei grundsAtzlich etwas anderes als die Summe des Wohls der
Individuen, und der Annahme, die Politik sei ein Nullsummenspiel, in dem
die Interessenrealisierung des einen stets den Nachteil des anderen impli
ziert. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die deutsche offentlich-politi
sche Debatte der Nachkriegszeit -von der Wamung vor der "Herrschaft der
Verbande" (Theodor Eschenburg) bis zu der vor der "Anspruchsinflation"
der unersAttlichen Interessierten; die vorgeschlagenen Gegenmittel reichen
von der "Formierten Gesellschaft" (Ludwig Erhard) der 60er Jahre tiber die
Einbindung der Interessierten in "Konzertierte Aktionen" bis zum "Soli
darpakt" der Gegenwart. Gleichwohl ist auch den Kritikem der "Herrschaft
der Interessen" bewuBt, dafi Politik ohne die Bindung an die gesellschaft
lichen Interessen nicht nur nicht funktioniert, sondem ihrer legitimatorisch
bedarf.
Nicht das Ob der Interessenvermittlung ist darum im Prinzip das Pro
blem, sondem das Wie. 1m folgenden werden nun verschiedene Systeme
der Interessenvermittlung vorgestellt bzw. verschiedene politische Sy
sterne unter dem Aspekt der Interessenvermittlung verglichen. Dem Ver
gleich kommt es nicht darauf an, Rangfolgen im Sinne der Einordnung
8
realer Systeme auf einem Kontinuum von "verzerrter" zu "richtiger" Inter
essenvermittlung zu erstellen. Auch der in der eben eIWahnten (konser
vativen) Verbandekritik dominierende Gesichtspunkt der Gemeinwohl
Schadlichkeit oder -Vertraglichkeit wird keine Rolle spieleD. Eingeordnet
werden die untersuchten realen Systeme vielmehr auf einem Kontinuum
von Konkurrenz zu Konkordanz, und das hellit nach dem Umfang der
Interessenreprasentanz im gesamtgesellschaftlichen Entscheidungssystem.
Mit dem letzteren ist in erster Linie der Staat bzw. sind die Institutionen
der Staatswillensbildung gemeint, doch sind Staat und gesamtgesell
schaftliches Entscheidungszentrum nicht immer deckungsgleich. In man
chen Landern fallen wichtige Entscheidungen uber gesamtgesellschaftliche
Regelungen aullerhalb des staatlichen Institutionensystems -teils "aus Ver
sehen" (auf Grund der Unfabigkeit staatlicher Instanzen, den gesellschaft
lichen Regelungsbedarf zu decken), teils als Folge bewufiter Auslagerung
staatlicher Funktionen in "quasi-nichtstaatliche" Agenturen ("quasi non
governmental organisations" oder Quangos) oder in gesellschaftliche Sub
systeme. Das Stichwort "Konkurrenz" charakterisiert bier Systeme einfa
cher Mehrheitsherrschaft, die nach dem Prinzip der minimalen Gewinnko
alition operieren, in denen also der regieren kann, der im Parlament uber
etwas mehr als die Hiilfte der Sitze verftigt. Dagegen sind unter "Konkor
danz" Systeme maximaler Mehrheitsherrschaft zu subsumieren, die auch
Minderheitsgruppen an der Entscheidungsfindung beteiligen (was nicht
unbedingt im Parlament geschehen mull). Wo im ersteren Typ das Fallbeil
der einfachen Mehrheit die Entscheidung herbeifiihrt, wird im zweiten Typ
die Entscheidung in Verhandlungen gesucht.
Die erste Frage an die hier betrachteten Systeme lautet also: Reprasen
tieren gesamtgesellschaftliche Entscheidungen nur eine knappe Mehrheit
der gesellschaftlichen Interessen, sind Minderheitsgruppen einbezogen,
finden tendenziell alle Gruppen Berucksichtigung? Die Frage nach dem
Grad der Inklusion impliziert die nach Symmetrie oder Asymmetrie der
Interessenberucksichtigung: Sind manche Gruppen immer dominant, gibt
es Dauer-Vetogruppen, gibt es strukturelle Minderheiten, die smndig uber
gangen werden? 1m Zusammenhang damit interessiert schlie6lich ein
dritter Fragenkomplex: Welche Typen der Organisation von Interessen er
leichtern welchen Interessen die Durchsetzung, und wie ist die Machtver
teilung zwischen diesen Typen?
Hinter diesen Fragen verbirgt sich eine bestimmte Vorstellung von Ge
rechtigkeit. Denn nicht die - unqualifizierte - Ruckbindung der Politik an
irgendwelche gesellschaftlichen Interessen macht den demokratischen
Charakter von politischen Systemen aus. Das legitimatorische Potential der
9
Interessenvermittlung griindet sich vielmehr auf die Einlosung des Ver
sprechens, daB jeder einmal zum Zuge kommen konne, jeder/jede Gruppe
eine Chance habe, niemand auf Dauer benachteiligt oder gar unterdruckt
werde. Darum
sind Interessenvermittlungs-Systeme urn so gerechter, je grofier ihre
Inklusivitat ist. Dabei ist allerdings zwischen dauerhafter und voruber
gehender Inklusivitat zu difIerenzieren; so kann die einfache Mehr
heitsherrschaft durch haufigen Regierungswechsel fur permanenten
Ausgleich sorgen;
ist Interessenvermittlung urn so gerechter, je gleichmaBiger die unter
schiedlichen Interessen Beriicksichtigung finden;
sind politische Systeme urn so gerechter, je besser sie imstande sind,
Ungleichheiten in den gesellschaftlich gegebenen Chancen der Interes
sendurchsetzung in einer Art Sekundarverteilung abzumildem.
1m Vordergrund des Vergleichs der verschiedenen politischen Systeme
stehen im angegebenen Zusammenhang naturgemaB die Interessenvermitt
lungs-Agenturen, d.h. konkret die jeweiligen Parteien- und Verbandesy
sterne. Die Inklusivitat der Interessenberucksichtigung und damit (im Um
kehrschlufi) die Selektivitat des Gesamtsystems wird variieren (1) je nach
dem, ob die Parteien - und welche Art von Parteien - die dorninanten Ak
teure sind oder die Verbande. Sie wird variieren (2) je nachdem, ob Partei
en und Verbande voneinander abhangig sind, miteinander kooperieren
oder unabhangig voneinander agieren, also mit den Interaktionsweisen
zwischen ihnen. Die Selektivitat wird uberdies (3) beeinflufit durch die
yom institutionellen (Verfassungs-) System vorgesehenen Entscheidungs
regeln. Deren Relevanz variiert wiederum mit der Struktur und Dominanz
des Parteiensystems; so konnen die verfassungsmaBigen Entscheidungsre
geln modifiziert oder gar ad absurdum gefuhrt werden durch die Entschei
dungspraxis, die sich aus der Art des Parteienwettbewerbs ergibt.
Die Parteiensysteme spielen in der folgenden Darstellung darum eine
vergleichsweise prominente Rolle. Ihre potentiellen Konkurrenten im
Kampf urn den Zugang zum Entscheidungszentrum sind aber nicht nur die
Verbande, sondem auch die Regionen (sofem diese politisch verfafit sind),
die Ministerialburokratie, ja dort, wo ein richterliches Priifungsrecht fest
installiert und akzeptiert ist, sogar die Justiz. Entsprechend werden nach
einander (1) Systeme vorgestellt, in denen deutlich die Parteien dominieren
("Parteienstaaten"), (2) Bundesstaaten mit mehr oder weniger gro.Bem Ein
flufi der Gliedstaaten, (3) von Gro.Bverbanden dorninierte Systeme (Neo
Korporatismus, "Verbande-staaten"), (4) ein Gemeinwesen, das tendenziell
aIle wichtigen Gesellschaftssegmente ins Entscheidungssystem einbezieht,
10
(5) von prima facie nicht-politischen Akteuren gepragte Systeme ("Herr
schaft der Experten", Justizialisierung der Politik). Die einzelnen Kapitel
werden zunachst die - idealtypische -Funktionslogik des jeweiligen Inter
essenvermittlungssystems erlautern und anschlie6end die praktische
Funktionsweise an Hand ausgewiihlter Lander illustrieren. Beispielhaft
herangezogen werden dafiir (1) die hOchst unterschiedlichen Parteienstaa
ten Gr06britannien, Bundesrepublik und ltalien - sowie, zum Kontrast, der
Nicht-Parteienstaat USA; (2) die Bundesstaaten USA, Schweiz und Bun
desrepublik; (3) die osterreichische "Sozialpartnerschaft" - mit Seitenblik
ken auf die deutsche Konzertierte Aktion der spaten 60er und friihen 70er
Jahre und auf den Verbandestaat Schweiz; (4) die schweizerische Konkor
danzdemokratie. Den EinfluB von Verwaltung und Justiz schlie61ich soIl
(5) ein Blick auf Frankreich und wiederum die Bundesrepublik verdeutli
chen. Die genannten politischen Systeme werden demnach fallweise und
ausschnitthaft als besonders typisch fUr bestimmte Konstellationen von In
teressenvermittlungs-Agenturen, z.T. aber auch als abweichende FaIle vor
gefuhrt.
Vor dem Einstieg in den Vergleich realer Interessenvermittlungssy
sterne sind allerdings die einzelnen Akteure bzw. Organisationen genauer
zu charakterisieren. Jeder Typ eines organisierten Inter6Sses hat seine eige
nen Organisationsprobleme, folgt bestimmten Handlungsimperativen, ist
auf besondere Funktionen spezialisiert, entwickelt spezifische Eigeninter
essen. Jede Organisationsform ist darum fur die Vermittlung unterschiedli
cher Interessen unterschiedlich gut geeignet und steht damit fur eine be
stimmte Art der Verzerrung von Interessen bzw. der Selektivitat der Inter
essenberucksichtigung. Doch dienen der Interessenvermittlung nicht allein
eigens zu dem Zweck gebildete Organisationen; Interessenten bedienen
sich zugleich vorgefundener Institutionen (wie der Burokratie oder der
Justiz), deren Funktionsweise wiederum spezifische Verzerrungen oder Se
lektivitiiten erwarten laBt.
Die Analyse der verschiedenen kollektiven Akteure bedient sich im ub
rigen okonomischer Kategorien; d.h. sie leitet das Verhalten der Akteure
aus ihren Eigeninteressen sowie aus den Konstellationen ihres als
"politischer Markt" konzipierten Umfeldes abo Bei der Verknupfung des
einen mit dem anderen wird prinzipiell Rationalitat unterstellt. Die ent
sprechenden Verhaltenshypothesen konstituieren darum Idealtypen, von
denen die unordentliche Realitat zuweilen abweicht, die aber gleichwohl
auf generelle Reaktionsmuster und Verhaltenstendenzen verweisen.
11