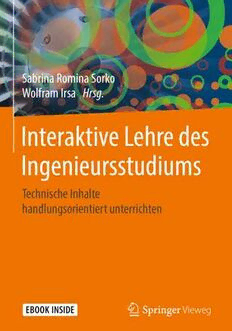Table Of ContentInteraktive Lehre des Ingenieursstudiums
Sabrina Romina Sorko · Wolfram Irsa
Hrsg.
Interaktive Lehre des
Ingenieursstudiums
Technische Inhalte handlungsorientiert
unterrichten
Hrsg.
Sabrina Romina Sorko Wolfram Irsa
FH JOANNEUM FH JOANNEUM
Graz Hitzendorf
Österreich Österreich
ISBN 978-3-662-56223-9 ISBN 978-3-662-56224-6 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56224-6
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-
lierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Vieweg
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich
vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen-
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem
Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren
oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Feh-
ler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen
in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.
Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von
Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany
Vorwort
Warum wird in der Technik immer noch versucht Verantwortung aus Fachbüchern zu
lernen? Und: Was hat dieses Buch damit zu tun? Diese Fragen sollen zum Reflektieren
anregen und Inspiration für die eigene technische Lehre bieten. Auf den nächsten Zeilen
beschreiben die Herausgeber, ihre Motivation für das vorliegende Lehr- und Übungsbuch
und erzählen, wie das intensive Befassen mit der Thematik die eigene Lehre positiv beein-
flusst hat.
Technischer Unterricht ist nach wie vor sehr traditionell gestaltet: Das komplexe Fach-
wissen steht zumeist im Vordergrund und muss mit den vorhandenen zeitlichen und räum-
lichen Ressourcen vermittelt werden. Klassischer Frontalvortrag anhand von Fachliteratur
prägt das tägliche Bild der Lehre. Nun leben wir jedoch in einer Zeit, in der sich der
Anspruch an die künftigen Ingenieure massiv verändert. Diese sind und werden nicht nur
mehr rein Techniker sein, sondern weitere Kompetenzen benötigen. Das Stichwort dazu
heißt Digitalisierung.
Ein Schwerpunkt dahingehend liegt aus unserer Erfahrung auf der Kommunikations-
kompetenz und der Teamfähigkeit. Dazu kommen die Anforderungen des vernetzten
Denkens und des verantwortungsvollen Lösens komplexer technischer Problemstel-
lungen, welche durch die reine Vermittlung von technischem Fachwissen nicht erreicht
werden können. Wird von den späteren Technikern aktives, bedachtes Handeln erwartet,
so muss dies auch in der Aus- und Weiterbildung trainiert werden. Solche Fähigkeiten
können allein aus Büchern heraus nicht gelernt werden. Es ist also ein Bedarf da, um den
Unterricht mit neuen didaktischen Methoden zu vermitteln und damit die Ingenieure auf
ihre späteren Aufgaben im Berufsleben adäquat vorzubereiten.
Das vorliegende Lehr- und Übungsbuch versucht den oftmals abstrakt wirkenden
Begriff der Kompetenzorientierung greifbar zu machen und anschaulich auf die techni-
sche Lehre umzulegen.
Die Autoren haben sich auf das „Experiment Methodenvielfalt“ eingelassen. Ausgehend
von einer Kompetenzorieniterungsinitiative im Jahr 2012 am Institut Industrial Manage-
ment der FH JOANNEUM wurde sukzessive eine Kompetenzroadmap für die technische
Lehre aufgebaut. So verschwanden Schritt für Schritt reine Frontalvortragseinheiten und
machten Platz für neue innovative Methoden. Ein Schlüsselerlebnis war der Einsatz der
V
VI Vorwort
Methode „Gruppenpuzzle“ in der Lehrveranstaltung Produktionstechnik. Bereits nach
dem ersten Einsatz war eine deutliche Motivationssteigerung bei den Studierenden festzu-
stellen. In den vergangenen Jahren wurde der Einsatz der Methode dann weiter verfeinert
bis die Lernenden in der Lage waren, komplexe technische Aufgabenstellungen kompakt
zu erklären und mit anderen Fachbereichen zu vernetzen. Der Sukkus daraus aus Sicht
der Lehrperson: „Es ist eine Umstellung, die zwar anfangs zeitintensiv waren, aber einen
weit höheren Outcome bei den Lernenden erzielt hat. Es konnten technische Themen auf-
gelockert und mit weiteren Schlüsselbereichen angereichert werden. Das hat auch dazu
geführt, dass immer mehr Frauen ihre Stärken in dem traditionell männlich dominierten
Technikfeld einbringen können.“
Die Herausgeber leisten nicht nur einen Beitrag dazu, den Spagat zwischen traditionel-
lem Lernen und dynamischen neuen Anforderungen im technischen Bereich zu schließen,
sondern nehmen auch ihre gesellschaftliche Verantwortung war, ein stark männlich domi-
niertes Themenfeld weiter für Frauen zu öffnen.
Mit diesen Gedanken wünschen wir Ihnen viel Neugierde, Mut und Engagement für
ihre Lehre und hoffen, dass Ihnen das Buch dabei hilft, Ihre Lehre ein Stück innovativer
zu gestalten.
Sabrina Romina Sorko und Wolfram Irsa
Geleitwort
Lehre Hochschulen ist forschungsgeleitet; mit der Nase im Wind der neuen, wissenschaft-
lichen Entwicklung. Der Fokus liegt auf dem Fach im Allgemeinen und den fachlichen
Erkenntnissen im Speziellen, die aufgrund der Forschungs- und/oder Praxiserfahrung der
Experten in den Lehrveranstaltungen vermittelt werden. Kaum eine Lehrperson im tech-
nischen Bereich an Hochschulen startet ihre Karriere als Lehrender oder Lehrbeauftragte
mit didaktischer oder gar fachdidaktischer Ausbildung. Viele Hochschulen versuchen des-
wegen, dieses Manko mit Didaktik-Weiterbildungsmaßnahmen auszugleichen. Warum?
Weil die Studierenden die angebotenen Feedback-Instrumente nutzen, um eines deutlich
zu machen: „Wir wollen gute Lehre!“
Nun ist es schwierig, „gute“ Lehre festzumachen. Immer wieder werden wesentliche
Prinzipien genannt: Handlungsorientierung, Outcome-Orientierung, Methodenmix, Aktu-
alität der Fachinhalte, Authentizität der Lehrenden, Lehr-/Lernzielorientierung, Kommu-
nikation auf Augenhöhe, Vorhandensein und Einhalten von Vereinbarungen (Syllabi),
Fairness – Experten finden zu dieser unvollständigen Liste wichtige Ergänzungen.
Aus Sicht eines Wirtschaftsingenieur-Instituts mit Technik- und Wirtschaftsinhalten
gibt es tendenziell über Jahrzehnte unterschiedliches Feedback der Studierenden zu diesen
„Erfolgsfaktoren für gute Lehre“. Wenngleich es aus Sicht der Studierenden in beiden
Bereichen herausragende und überdurchschnittliche Lehre gibt – hier scheint die Persön-
lichkeit der Lehrperson ein wesentlicher Einflussfaktor zu sein –, sind es immer wieder
technische Lehrveranstaltungen, bei denen Potenziale zur „besseren Vermittlung“ rück-
gemeldet werden. Auch hier sind die Begründungen und Hypothesen Legion: schwierige
Inhalte, überforderte Studierende, tendenziell höhere Notendurchschnitte, Fokus auf die
Fachlichkeit – you name it. Tatsache bleibt, dass sich international die Wirtschaftspäda-
gogik als eigene Wissenschaftsdisziplin etabliert hat, wohingegen sich Technikpädagogik
oder Technikdidaktik erst mit Lehrstühlen in Deutschland und der Schweiz formiert.
Sicherlich nicht absprechen kann man technischen Lehrpersonen, dass sie Ihre Sache
nicht lieben – im Gegenteil. Damit ist gemäß dem deutschen Kulturphilosophen Max Brod
ein wichtiger Grundstein gelegt: „Lernen kann man stets nur von jenem, der seine Sache
liebt, nicht von dem, der sie ablehnt.“ Vielleicht liegt es doch an einem (konstruktivisti-
schem) Konzept und seiner Umsetzung mit (vielen) Methoden und Instrumenten? Schon
VII
VIII Geleitwort
Albert Einstein betonte, er unterrichte seine Schüler nie: „… ich versuche nur, Bedingun-
gen zu schaffen, unter denen sie lernen können.“
Am Institut Industrial Management waren diese und ähnliche Überlegungen der Aus-
gangspunkt für eine strategische Initiative „Technik lieben lernen“: neue Infrastruktur
(Laboratorien, technische Lehrsätze etc.), Ausbildungsinitiativen, neue Auswahlkriterien
für (technische) Lehrbeauftragte (siehe Kriterien oben), Beratung durch pädagogische
Hochschulen, wiederkehrende Projekte zur Detektion von Problempunkten und Generie-
rung von Lösungen, neue Literatur sowie zusätzliche Lehreinheiten in besonders schwie-
rig wahrgenommenen Fächern (z.B. Mathematik) waren die bisherigen Schritte. Das vor-
liegende Buch ist ein wesentlicher weiterer Schritt in dieser Strategie. Es externalisiert
und dokumentiert Erkenntnisse aus der Forschung und Erfahrungen aus der Praxis, und
ermöglicht mit vielen Impulsen, Knowhow und Instrumenten motivierten technischen
Experten die selbständige Qualitätsarbeit an der eigenen Lehre.
Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Sabrina Romina Sorko und Herrn DI Wolfram Irsa,
die mit der Initiative zu dem vorliegenden Buch „Interaktive Lehre des Ingenieurstudiums –
technische Inhalte handlungsorientiert unterrichten“ mit großem Einsatz als Herausgeber
und Autoren einen wichtigen Beitrag in der Weiterentwicklung der Technikdidaktik liefern.
Die mit dem Buch verbundenen Einsichten und Instrumente werden auch unserem Insti-
tut helfen, die technischen Lehrveranstaltungen – und damit die angebotenen Studien –
für unsere Studierenden zu optimieren.
Prof. Dr. Martin Tschandl
Leiter des Wirtschaftsingenieur-Instituts Industrial Management,
FH JOANNEUM Kapfenberg
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ....................................................... 1
Sabrina Romina Sorko
1.1 Technik-Didaktik als Voraussetzung nachhaltiger technischer Lehre ..... 1
Literatur ......................................................... 3
Teil I Grundlagen der Technik-Didaktik
2 Kompetenzen im Zeitalter der Digitalisierung ......................... 7
Sabrina Romina Sorko und Birgit Rabel
2.1 Input-Output-Outcome ......................................... 7
2.2 Grundlagen der Kompetenzentwicklung im
ingenieurswissenschaftlichen Bereich ............................. 9
2.2.1 Fachkompetenz ........................................ 9
2.2.2 Methodenkompetenz .................................... 10
2.2.3 Sozialkompetenz ....................................... 10
2.2.4 Persönliche Kompetenz .................................. 11
2.3 Digitale Kompetenz ........................................... 11
2.3.1 Digitale Fachkompetenz ................................. 12
2.3.2 Digitale Methodenkompetenz ............................. 13
2.3.3 Digitale soziale Kompetenz ............................... 13
2.3.4 Digitale persönliche Kompetenz ........................... 13
2.4 Sicherstellung des Kompetenzerwerbs ............................ 14
2.4.1 Lehr- und Lernmethoden ................................. 15
2.4.2 Förderung digitaler Kompetenzen am Beispiel „Grundlagen
technischer Programmierung“ ............................. 17
Literatur ......................................................... 23
3 Handlungsorientierung im Zeitalter der Digitalisierung ................ 25
Wolfram Irsa
3.1 Definitionen ................................................. 25
IX
X Inhaltsverzeichnis
3.2 Grundlagen der Handlungsorientierung im ingenieurswissenschaftlichen
Bereich ..................................................... 28
3.2.1 Lernendenorientierung ................................... 30
3.2.2 Lernorientierung ....................................... 31
3.2.3 Inhaltsorientierung ...................................... 31
3.2.4 Prozessorientierung ..................................... 31
3.2.5 Produktorientierung ..................................... 32
3.3 Methoden für die Handlungsorientierung .......................... 32
3.3.1 Stationenlernen ........................................ 32
3.3.2 Freiunterricht .......................................... 33
3.3.3 Projektunterricht ....................................... 33
3.3.4 Lernen durch Lehren .................................... 34
3.3.5 Mehrdimensionales Lernen ............................... 34
3.4 Vor- und Nachteile von Handlungsorientierung ..................... 35
Literatur ......................................................... 37
4 Bedeutung von Lehr-/Lernzielen .................................... 39
Sabrina Romina Sorko
4.1 Planung des technischen Unterrichts .............................. 39
4.2 Gestaltung zielorientierten Unterrichts ............................ 40
4.2.1 Leitprinzipien für die Formulierung ingenieurswissenschaftlicher
Lehr-/Lernziele ........................................ 40
4.2.2 Inhaltliche Ausgestaltung ................................. 41
4.2.3 Detaillierungsgrad ...................................... 42
4.3 Harmonisierung von Lehr-/Lernzielen ............................. 42
4.3.1 Lehrziele richtig kommunizieren ........................... 43
4.3.2 Lernziele richtig abholen ................................. 45
Literatur ......................................................... 46
Teil II Technischer Lehr- und Übungskatalog
5 Index zum Übungskatalog ......................................... 49
Sabrina Romina Sorko und Wolfram Irsa
5.1 Fachlicher Umfang ............................................ 49
5.2 Didaktische Hinweise ......................................... 50
5.3 Verwendete Methoden ......................................... 51
6 Werkstoffeigenschaften ........................................... 53
Wolfgang Waldhauser und Eva Maria Neubauer
6.1 Grundlagen der Werkstoffkunde ................................. 53
6.1.1 Einteilung und strukturelle Betrachtung der Werkstoffe ......... 55
6.1.2 Technische Werkstoffeigenschaften ......................... 59
6.1.3 Werkstoffauswahl ....................................... 62