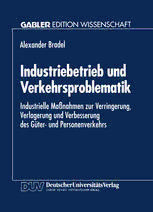Table Of ContentBrodel
Industriebetrieb und Verkehrsproblemotik
GABLER EDITION WISSENSCHAFT
Alexander Bradel
Industriebetrieb und
Verkehrsproblemati k
Industrielle MaBnahmen zur
Verringerung, Verlagerung
und Verbesserung des
GUter- und Personenverkehrs
Mit einem Geleitwort
von Prof. Dr. Horst Koller
DeutscherUniversitatsVerlag
Die Deutsche Bibliothek - ClP-Einheitsaufnahme
Bradel, Alexander:
Industriebetrieb und Verkehrsproblematik : induslrielle
Massnahmen zur Verringerung, Verlagerung und Verbesserung
des Guter-und Personenverkehrs / Alexander Bradel.
Mit einem Geleitw. von Horst Koller. -
Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl.; Wiesbaden: Gabler, 1995
(Gabler Edition Wissenschaft)
lugl.: Wurzburg, Univ., Diss., 1995
ISBN 978-3-8244-6223-0 ISBN 978-3-322-95412-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-95412-1
Der Deutsche Universitats-Yerlag und der Gabler Verlag sind Unternehmen der
Bertelsmann Fachinformation.
Gabler Verlag, Deutscher Universitats-Verlag, Wiesbaden
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1995
Lektorat: Claudia Splittgerber
Dos Werk einschlieBlich oller seiner Teile ist urheberrechtlich ge
schutz!. Jede Verwertung auf3erhalb der engen Grenzen des Ur
heberrechtsgesetzes ist ohne lustimmung des Verlages unzul.!lssig
und strafbar. Dos gilt insbesondere fur Vervielfaltigungen, Uber
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver
arbeitung in eleklronischen Systemen.
HOchste inhalrliche und technische Qualitat unserer Produkte ist unser liel. Bei der Pro
duktion und Auslieferung unserer Bucher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses Buch ist auf
sOurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt ouch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB
solche Nomen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten waren und daher von jedermann benutzt werden durften.
ISBN 978-3-8244-6223-0
Fur Rita und Benedikt
- VI/-
Geleitwort
Industriebetriebe sind bei der DurchfUhrung ihrer Geschaftstatigkeit als Nachfrager
von Verkehrsleistungen unterschiedlicher Art in erheblichem Maf5e von der Funk
tionsfahigkeit des gesamtwirtschaftlichen Verkehrssystems abhangig. Die wach
sende Beanspruchung von Verkehrsmitteln durch die Industrie k6nnte aber anderer
seits auch einer der Grunde fur die stellenweise Oberlastung des Verkehrswesens
und die daraus resultierenden negativen Effekte sein, die unter dem Schlagwort
"Verkehrsinfarkt" derzeit in Deutschland diskutiert werden. Die vorliegende Arbeit
untersucht die spezifische Stellung des Industriebetriebs im Spannungsfeld zwi
schen gesamtwirtschaftlicher Verkehrsproblematik und rationalem einzelwirtschaft
lichen Entscheidungsverhalten, um daraus Ansatzpunkte zur Reduzierung der ent
standenen Verkehrsprobleme in Deutschland abzuleiten, die mit den betriebswirt
schaftlichen Zielsetzungen der einzelnen Industriebetriebe grundsatzlich kompatibel
sind.
Diese faktenreiche und systematische Analyse der Verkehrsproblematik wendet sich
nicht nur an Wissenschaftler und Studenten, die sich besonders mit Verkehrs
wissenschaft, Logistik und Industriebetriebslehre beschaftigen. Der Verfasser pra
sentiert eine Fulle von Verbesserungsvorschlagen, die in der Industrie und im Ver
kehrswesen unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden k6nnten. Insofern ist dieser
Arbeit ein breites Publikum und eine positive Resonanz auch in der Wirtschaftspra
xis zu wunschen.
Prof. Dr. Horst Koller
-IX -
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist wahrend meiner Assistentenzeit am Lehrstuhl fUr Betriebs
wirtschaftslehre und Industriebetriebslehre der Bayerischen Julius-Maximilians-Uni
versitat Wurzburg entstanden und wurde im Juli 1995 von der wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultat der genannten Universitat als Dissertation angenommen.
Ich danke insbesondere meinem akademischen Lehrer und Doktorvater, Herrn Prof.
Dr. Horst Koller, fUr die Unterstutzung dieser Dissertation und fUr die idealen, von
Offenheit und Menschlichkeit gekennzeichneten Arbeitsbedingungen an seinem
Lehrstuhl. Die ausgepragte Praxisorientierung von Herrn Prof. Dr. Horst Koller in
Forschung und Lehre hat die Ausrichtung der Arbeit wesentlich beeinflul3t. Herrn
Prof. Dr. Rainer Thome danke ich fur die zugige Erstellung des Zweitgutachtens.
Fur wertvolle inhaltliche Anregungen und die gleichermal3en engagierte wie kritische
Durchsicht des Manuskripts danke ich besonders Frau cando rer. pol. Nadja Elias,
Herrn Dr. Heiko Kirchgal3ner und Herrn Dipl.-Kfm. Frank Piller. Zu danken ist aul3er
dem Frau Dipl.-Kffr. Angela Gruner, Herrn Dr. Frank Schafer und Herrn Dipl.-Kfm.
Markus Ziegler, unseren Sekretarinnen Frau Ellen Semmler und Frau Hermine
Schoffmann sowie allen studentischen und wissenschaftlichen HilfskrMten des
Lehrstuhls fUr ihre fachliche und organisatorische UnterstOtzung. Daruber hinaus
trugen all die genannten ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu der sehr angeneh
men Atmosphare am Lehrstuhl bei.
Den zweifelsfrei wichtigsten und in Worte nur schwer zu fassenden Anteil am er
folgreichen Abschlul3 dieser Dissertation hat jedoch meine Familie. Meine Frau Rita
half mir durch ihre Liebe und Geduld, durch das Fernhalten storender Einflusse und
ihren Zuspruch ebenso uber schwierige Phasen hinweg wie die gemeinsame Freude
uber die Geburt und das Heranwachsen unseres Sohnes Benedikt. Rita und Bene
dikt ist dieses Buch in Liebe und Dankbarkeit gewidmet.
Alexander Bradel
-X/-
INHALT SVERZEICHNIS
ABKORZUNGSVERZEICHNIS ....................................................................... XVII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ........................................................................ XXV
1 Einfuhrung .......................................................................................... 1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung .............................................................. 1
1.2 Aufbau der Arbeit .................................................................................. 2
2 Wissenschaftstheoretische Fundierung ................................................... 3
2.1 Einordnung des Untersuchungsgegenstandes in die Wirtschaftswissen-
schaften ............................................................................................... 3
2.2 Untersuchungsrelevante Grundlagen der Systemtheorie .............................. 5
2.2.1 Systembegriff und -kennzeichen ..................................................... 5
2.2.2 Spezielle Systemtypen nach ausgewahlten Merkmalskriterien und
untersuchungsrelevante Implikationen ............................................. 7
2.2.2.1 Beschaffenheit .................................................................. 7
2.2.2.1.1 Materielle und immaterielle Systeme ..................... 7
2.2.2.1.2 Probleme der Modellbildung ................................. 8
2.2.2.2 Offenheit .. , ...................................................................... 9
2.2.2.2.1 Geschlossene und offene Systeme ....................... 9
2.2.2.2.2 Zweck- und Zielorientierung offener Systeme ......... 9
2.2.2.3 Dynamik ........................................................................ 10
2.2.2.3.1 Statische und dynamische Systeme .................... 10
2.2.2.3.2 Vorhersagbarkeit des Verhaltens dynamischer
Systeme .......................................................... 11
2.2.2.4 Komplexitat .................................................................... 11
2.2.3 Systemtheorie ............................................................................ 13
2.2.3.1 Begriff ........................................................................... 13
2.2.3.2 Wesentliche systemtheoretische Denkrichtungen ................ 13
2.2.3.2.1 Allgemeine Systemtheorie und Kybernetik ........... 13
2.2.3.2.2 Analytisch-formale und heuristisch-mentale
Systemtheorie .................................................. 1 7
2.2.3.3 Zusammenhang zwischen Systemtheorie, Betriebswirt-
schaftslehre und Management. ......................................... 1 8
3 Einbindung des Industriebetriebs in das Verkehrssystem ........................ 21
3.1 Innere Struktur und Umwelt des Systems Industriebetrieb ......................... 21
3.1.1 Begriffsklarungen ........................................................................ 21
3.1.2 Innere Struktur des Systems Industriebetrieb .................................. 23
3.1.2.1 Zielsystem ...................................................................... 23
3.1.2.2 System der produktiven Faktoren ...................................... 28
-X/I-
3.1.2.3 System der funktionalen Elemente ..................................... 32
3.1.2.4 Betriebliche Logistik als systemdurchdringende Quer-
schnittsfunktion .............................................................. 33
3.1.2.4.1 Begriff und Ziel der Logistik ............................... 33
3.1.2.4.2 Teilfunktionen der Logistik ................................. 36
3.1.2.4.3 Hierarchieebenen der Logistik ............................ 38
3.1.3 Umwelt des Industriebetriebs ....................................................... 38
3.1.3.1 Elemente der aufgabenspezifischen Umwelt ....................... 39
3.1.3.2 Umweltdimensionen der aufgabenspezifischen und der glo-
balen Umwelt .............................................................. ··. 40
3.1 .4 Anforderungen an die betriebliche FOhrung aufgrund der Komplexi-
tat des Systems Industriebetrieb und seiner Umwelt ....................... 42
3.2 Innere Struktur und Umwelt des Verkehrssystems in der Bundesrepublik
Deutschland ....................................................................................... 43
3.2.1 Begriffsklarungen ........................................................................ 43
3.2.2 Innere Struktur des Verkehrssystems ............................................ 44
3.2.2.1 Zielsystem ...................................................................... 44
3.2.2.2 System der Verkehrsbereiche ........................................... 46
3.2.2.3 System der produktiven Faktoren ...................................... 48
3.2.2.3.1 Verkehrsobjekte ............................................... 48
3.2.2.3.2 Verkehrsinfrastruktur ........................................ 51
3.2.2.3.3 Verkehrsmittel ................................................. 53
3.2.2.4 System der funktionalen Elemente ..................................... 53
3.2.2.4.1 Verkehrsmarkte und die auf ihnen agierenden An-
bieter und Nachfrager ....................................... 53
3.2.2.4.1.1 Begriffsklarung ............................... 53
3.2.2.4.1.2 Primarmarkt ................................... 54
3.2.2.4.1.3 Sekundarmarkte ............................. 57
3.2.2.4.2 Hierarchieebenen .............................................. 58
3.2.3 Umwelt des Verkehrssystems ...................................................... 59
3.2.3.1 Elemente der aufgabenspezifischen Umwelt ....................... 59
3.2.3.2 Umweltdimensionen der aufgabenspezifischen und der glo-
balen Umwelt ................................................................. 59
3.3 Industriebetriebe als Subsysteme des Verkehrssystems ............................ 60
3.3.1 Einbindung von Industriebetrieben auf der Nachfrageseite des prima-
ren Verkehrsmarkts in das Verkehrssystems .................................. 62
3.3.1.1 Grundlegende Beziehungen zwischen Verkehrssystem und
Industriebetrieben auf der Nachfrageseite des Primarmarkts .62
3.3.1.2 Zusammenhange zwischen gesamt- und einzelwirtschaft-
lichen Verkehrskosten und -nutzen .................................... 65
3.3.1.2.1 Gesamtwirtschaftliche Verkehrskosten und
-nutzen ........................................................... 65
3.3.1.2.2 Verkehrskosten und -nutzen des Industriebetriebs 69
-XIII-
3.3.1.3 Ableitung von Schwerpunkten einer verkehrsbezogenen
Umwelt- und Unternehmungsanalyse ................................ 76
3.3.2 Betriebe der Automobilindustrie als Beispiele fOr zusatzlich auf der
Angebotsseite sekundarer Verkehrsmarkte agierende Industrie-
betriebe ..................................................................................... 78
4 Verkehrsproblematik in der Bundesrepublik Deutschland ........................ 81
4.1 Vorbemerkungen ................................................................................. 81
4.1.1 Annaherung an den Begriff Verkehrsproblematik ............................. 81
4.1.2 Weitere Vorgehensweise ............................................................. 81
4.2 Bisherige Entwicklung des materielien Verkehrs ....................................... 82
4.2.1 Entwicklung von Verkehrsaufkommen und -Ieistung im GOter- und
Personenverkehr ......................................................................... 82
4.2.1.1 GOterverkehr .................................................................. 82
4.2.1.2 Personenverkehr ............................................................. 88
4.2.2 Entwicklung der Kapazitatsauslastung ........................................... 92
4.2.2.1 Entwicklung der Infrastrukturauslastung ............................. 93
4.2.2.2 Entwicklung der Verkehrsmittelauslastung .......................... 99
4.3 Gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Relation des materielien Verkehrs
als MaBstab fOr die Verkehrsproblematik .............................................. 106
4.3.1 Problematik der Darsteliung gesamtwirtschaftlicher Kosten und
Nutzen .................................................................................... 106
4.3.2 Negative gesamtwirtschaftliche Effekte ....................................... 107
4.3.2.1 Ressourcenverbrauch und -bindung ................................. 107
4.3.2.1.1 Verbrauch materielier Ressourcen ..................... 107
4.3.2.1.2 Bindung personelier Ressourcen ....................... 118
4.3.2.2 Unfalie ......................................................................... 121
4.3.2.3 Emissionen ................................................................... 127
4.3.2.3.1 Schadstoffemissionen ..................................... 128
4.3.2.3.2 Larmemissionen ............................................. 132
4.3.2.4 Stauungen ................................................................... 133
4.3.2.5 Weitere negative Effekte ................................................ 135
4.3.2.6 Zusammenfassende Beurteilung ...................................... 137
4.3.3 Positive gesamtwirtschaftliche Effekte ......................................... 137
4.3.4 Gesamtwirtschaftliche Bilanz des materielien Verkehrs ................... 142
4.4 Prazisierung des Begriffs Verkehrsproblematik ....................................... 145
5 Auswirkungen bisheriger und zuki.inftiger Entwicklungen im Verkehrs-
system auf den Industriebetrieb ......................................................... 147
5.1 Vorbemerkungen ............................................................................... 147
5.2 Auswirkungen der bestehenden gesamtwirtschaftlichen Verkehrsproble-
matik auf den Industriebetrieb ............................................................. 147