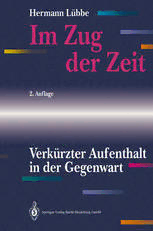Table Of ContentLübbe . Im Zug der Zeit
Hermann Lübbe
Im Zug der Zeit
Verkürzter Aufenthalt in der Gegenwart
Zweite Auflage
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
Prof. Dr. Hermann Lübbe
Philosophisches Seminar
Universität Zürich
Rämistraße 71, CH-8006 Zürich
ISBN 978-3-662-07853-2
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Lübbe, Hermann: Im Zug der Zeit: verkürzter Aufenthalt in der Gegenwart
Hermann Lübbe. - 2.Aufl.
ISBN 978-3-662-07853-2 ISBN 978-3-662-07852-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-07852-5
Dieses Werk ist urheberrechtIich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, . der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungs
anlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Ver
vielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur
in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils gehenden
Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen
unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
© Springer-Verlag Berlin Heide1berg 1992, 1994
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1994
Softcover reprint ofthe hardcover 2nd edition 1994
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als
frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften
Umschlaggestaltung: Struve & Partner, Atelier für GrafIk-Design, Heidelberg
Satz: Datenkonvertierung durch Elsner & Behrens GmbH, Oftersheim
SPIN 10468616 45/3140 - 5 4 3 2 1 0 - Gedruckt auf säurefreiem Papier
Vorwort
Die wissenschaftlich-technische Zivilisation ist wie nie zuvor eine
Zivilisation vergangenheits zugewandt. Die Intensität unserer Anstren
gungen zur Vergangenheitsvergegenwärtigung ist historisch beispiellos.
Exemplarisch heißt das: Mit der Dynamik unserer Zivilisation wächst
zugleich die Zahl der Museen, und komplementär zur Modernität
unseres städtebaulichen Lebensambientes entwickelt sich der Denkmal
schutz.
Wieso kultiviert gerade die moderne Zivilisation das Bewußtsein ihrer
eigenen Geschichtlichkeit? Was macht uns, gegenläufig zu unserer
spezifisch modernen Zukunftsbezogenheit, heute wie nie zuvor vergan
genheitsinteressiert? Die Beantwortung dieser Fragen setzt Einsicht in
den Beschleunigungscharakter unserer zivilisatorischen Evolution vor
aus. Je rascher sich objektiv unsere Lebensverhältnisse ändern, um so
aufdringlicher wird subjektiv die Erfahrung, daß wir in wesentlichen
Hinsichten selbst unsere jüngeren Vergangenheiten in der Gegenwart
nicht mehr wiederzuerkennen vermögen. Fortschrittsabhängig erhöht
sich in Wissenschaft, Technik und Ökonomie die Veraltensrate, und die
drei oder vier Generationen, die gleichzeitig miteinander leben, sind in
der modernen Kultur nicht nur altersmäßig, vielmehr darüber hinaus
auch durch kulturelle Prägungen unterschiedlicher Geschichtsepochen
voneinander verschieden.
In größerenl und kleineren2 Arbeiten habe ich in vergangenen Jahren
den Ursprung des historischen Bewußtseins aus der Erfahrung kulture
volutionärer Dynamik plausibel zu machen versucht. Ich konnte mich
bei diesem Versuch unter anderem mit Reinhart Koselleck in Überein
stimmung wissen: Erst dann, wenn fürs Bewußtsein der Zeitgenossen sich
1 Cf. dazu vor allem das Kapitel "Evolutionäre Beschleunigung und historisches
Bewußtsein" in meinem geschichtswissenschaftstheoretischen Buch "Geschichts
begriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie", Baselj
Stuttgart 1977, S. 304-335.
2 Etliche Detailstudien zum Ursprung des historischen Interesses aus der Erfah
rung evolutionärer Beschleunigung sind in dem Sammelband "Die Aufdringlich
keit der Geschichte", Graz, Wien, Köln 1989, abgedruckt, so "Der Fortschritt
und das Museum", S. 13-29, oder "Historisierung und Ästhetisierung", S. 46-63.
VI Vorwort
"Erfahrungsraum" und "Erwartungshorizont" trennen3, erscheint die
Vergangenheit als wirklich vergangen, das heißt als unwiederholbar
abgeschlossen oder nur noch in verwandelter Gestalt gegenwärtig, und
die kulturelle Evolution, die uns in beschleunigter Bewegung von der
Vergangenheit entfernt, wird als irreversibel, als singulär, als unvorher
sehbar-zukunftsoffen und somit als Geschichte im modernen historisti
schen Sinn erkennbar.
Koselleck war es aber auch, der bei Erörterungen dieses Themas in der
unvergessenen Studiengruppe "Theorie der Geschichte"4 verblüffender
weise fand, es sei doch schwierig, der These vom Beschleunigungs
charakter der zivilisatorischen Evolution empirische Evidenz zu ver
schaffen. Feuilletonistische Expressionen des Eindrucks, den die ver
meintliche Hyperdynamik unserer Zivilisation bei Intellektuellen hinter
läßt, gibt es genug5• Skeptiker melden sich aber auch zu Wort und finden
zu Recht, mit subjektiven Eindrücken ließen sich weitreichende kultur
theoretische Behauptungen schwerlich begründen6•
Es ist die Absicht dieses Buches, den fraglichen Beschleuni
gungscharakter der modernen Kultur anschaulich zu machen. Materia
lien, die man dafür benötigt, liegen zu einem erheblichen Anteil in
wohlbekannten Arbeiten unserer Historiker längst bereit. Aus nahelie
genden Gründen erwiesen sich dabei Ergebnisse aus der wirtschafts-und
technikhistorischen Forschung als besonders interessant - von Landes7
bis White8• Auch die Philosophie, aus deren Blickpunkt solche For
schungsergebnisse kulturevolutionstheoretisch erst zu sprechen begin
nen, wird man bei der Lektüre der einschlägigen Veröffentlichungen
3 Reinhart KOSELLEcK: "Erfahrungsraum" und "Erwartungshorizont" - zwei
historische Kategorien. In: Reinhart KosELLEcK: Vergangene Zukunft. Zur
Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt/Main 1989, S. 349-375.
4 Aus der Arbeit dieser Studiengruppe, die in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre
in der Werner-Reimers-Stiftung zu Bad Homburg regelmäßig zusammentrat,
sind mehrere wichtige geschichtswissenschaftstheoretische Publikationen her
vorgegangen. Exemplarisch sei erwähnt Jürgen KOCKA, Thomas NIPPERDEY
(Hrsg.): Theorie und Erzählung in der Geschichte. Theorie der Geschichte.
Beiträge zur Historik, Band 3. München 1979.
5 Cf. exemplarisch Paul VIRILIO: Geschwindigkeit und Politik. Ein Essay zur
Dromologie. Aus dem Französischen übersetzt von Ronald VOULLII'o. Berlin
1988. - Unter dem Titel "Vitesse et Politique" zuerst erschienen 1977.
6 Cf. unten S. 269ff.
7 David S. LANDES: Der entfesselte Prometheus. Technologischer Wandel und
industrielle Entwicklung in Westeuropa von 1750 bis zur Gegenwart. Köln 1973.
8 Lynn WHITE: Medieval Religion and Technology. Collected Essays. Berkeley, Los
Angeles, London 1978.
Vorwort VII
nicht vermissen. Die Geschichtswissenschaft ist ungleich philosophi
scher als viele Philosophen anzunehmen geneigt sind.
In anderen Fällen indessen findet man die Materialien, die den
Beschleunigungscharakter unserer zivilisatorischen Evolution zur Evi
denz zu bringen geeignet sind, unverbunden und kontingent in der
Zerstreuung. Höchst disparate Institutionen sind an der Erzeugung oder
der Verwaltung dieser Materialien beteiligt, und die professionelle
Berichterstattung und theoretische Aufbereitung erfolgt in Fachzeit
schriften, die sich an Fachkommunitäten sehr unterschiedlicher Zusam
mensetzung richten. Was verbindet das Archivwesen mit der amtlichen
Statistik? Wieso wächst in der Verwaltung die Menge der produzierten
Akten noch ungleich rascher als die Zahl der Verwaltungsstellen? Welche
Konsequenzen ergeben sich daraus für die Archivierungspraxis und
damit für die Praxis der Sicherung der Quellen der historischen
Erforschung unserer Gegenwart, wenn diese zukünftig Vergangenheit
geworden sein wird? Wie ändert sich, technisch und kulturell, die
Funktion wissenschaftlicher Bibliotheken unter dem Druck absinkender
Halbwertszeit wissenschaftlicher Literatur? Wie läßt sich erklären, daß
auf den ältesten Stätten humaner Erinnerungskultur, auf unseren
Friedhöfen nämlich, gegenwärtig die Zahl der sogenannten anonymen
Bestattungen rasch zunimmt und die Bestatteten somit von vornherein
sichergestellt haben möchten, daß eine friedhofskulturelle Erinnerung an
sie nicht mehr stattfinden kann? Wieso hat just die künstlerische
Avantgarde die Museumskunst gefördert, und was läßt uns inzwischen
die Bauten der antihistoristischen architektonischen Moderne als histori
sche Bauten wahrnehmen?
Das sind höchst disparate Fragen. Wer in der Durcharbeitung der
Materialien, auf die sich diese Fragen beziehen, von der aktuellen
Friedhofskulturgeschichte bis zum Archivwesen und von der Interaktion
zwischen Patentrecht und technischer Evolution bis zu den Hintergrün
den aktueller Speicherbibliothekspläne auf die in ihnen sich spiegelnden
kulturellen Zeitverhältnisse achtet, wird sich in seinem billigen Verlangen
nach Belegen für die These vom Beschleunigungscharakter unserer
zivilisatorischen Evolution bedient finden. Es bleibt dann sogar unbe
nommen, die These vom Beschleunigungscharakter unserer zivilisatori
schen Evolution trivial zu finden. So geht es in der Wissenschaftspraxis ja
immer wieder einmal: Hat man mit einiger Mühe zur Evidenz gebracht,
worüber kurz zuvor noch Skeptiker sich ironisch äußerten, so sieht es
jedermann. Nicht trivial bleibt freilich die Ableitung von Schwierigkei
ten, die wir mit unserer Gegenwartszivilisation haben, aus der Erschöp
fung institutioneller und individueller Kapazitäten kultureller Innova
tionsverarbeitung. Auch Erinnerungskapazitäten haben Grenzen. Die
VIII Vorwort
erwähnte aktuelle Praxis anonymer Bestattung, zum Beispiel, läßt sich
von hier aus verständlich machen. Es gibt Phänomene der Überforde
rung des historischen Bewußtseins, und nicht zuletzt in der sogenannten
Postmoderne zeigt sich das.
Nicht trivial sind auch die kulturellen Phänomene modernitätsspezifi
scher Zeitumgangskultur. In einer dynamischen Zivilisation wird Zeit
einerseits knapper, und wie nie zuvor sind wir auf Instrumentarien ihrer
rationalen Nutzung und auf temporal immer weiter vorauseilende
Planung angewiesen. Auch die Tugend der Pünktlichkeit erweist sich als
spezifisch modern. Ohne sie wären wir im sozialen Lebenszusammen
hang zur temporalen Handlungskoordination und damit zur Wahrneh
mung von Kommunikationschancen nicht befähigt. Andererseits bedeu
tet wirtschaftlich genutzter wissenschaftlicher und technischer Fort
schritt nicht zuletzt Produktivitätsfortschritt, das heißt Steigerung der
Produktion pro Zeiteinheit, und eben dieser Produktivitätsfortschritt
setzt disponible, insbesondere berufspflichtentlastete Lebenszeit frei.
Wie nie zuvor in einer Kultur dehnen sich heute für die Individuen die
Lebenszeiträume, in denen nichts geschähe, wenn es nicht selbst be
stimmt geschähe. Die produktive Beantwortung dieser Herausforderung
hat Voraussetzungen und Folgen, deren Analyse einen weiteren Teil
dieses Buches bildet. Gesamthaft ergibt sich ein Bild der Temporalverfas
sung unserer modernen Kultur, das jenseits von geschichtsphilosophi
schen Fortschritts- oder Verfallstheorien nach einer evolutionstheoreti
schen Interpretation unserer kulturellen Gegenwartslage verlangt. Auch
dazu möchte dieses Buch einen Beitrag leisten. -
Eine ausführliche Einleitung bietet Gelegenheit zur Vororientierung
über Inhalt und Zusammenhang der Sachkapitel des Buches in Quintes
senzen. Auf Belege mußte dabei verzichtet werden. Die Register nennen
sämtliche im Text wie in den Anmerkungen erwähnten Personennamen
sowie die wichtigsten Begriffsnamen, insbesondere die Namen der hier
eingeführten neuen Begriffe.
Mit der überwiegenden Menge der in diesem Buch theoretisch
verarbeiteten Materialien sind Phjlosophen professionell nicht vertraut.
Entsprechend war mir auch die Einarbeitung in sie nur in Nutzung der
Ratschläge möglich, die mir Fachleute bereitwillig in ausführlichen
Gesprächen gaben. Dafür habe ich vielen zu danken. Als Adressaten
meines Dankes darf ich für das Archivwesen ausdrücklich Herrn
Archivdirektor Dr. Walter Deeters in AurichjOstfriesland erwähnen, für
den Bereich der amtlichen Statistik den Präsidenten des Statistischen
Landesamtes Baden-Württemberg, Herrn Prof. Dr. Max Wingen, für das
Bibliothekswesen den ehemaligen Direktor der Deutschen Bibliothek in
Frankfurt am Main, Herrn Prof. Dr. Günther Pflug, desgleichen meinen
Vorwort IX
Bruder Rainer Lübbe, Dipl.-Bibliothekar an der Landesbibliothek zu
Oldenburg, für die moderne Kunst meinen inzwischen verstorbenen
früheren Bochumer Kollegen Max Imdahl sowie meinen langjährigen
Mitarbeiter, den Kunsthistoriker lic. phil. Alois M. Müller. Die theoreti
schen Aspekte zivilisatorischer Evolution hatte ich des öfteren mit Bruno
Fritsch, meinem Kollegen an der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule in Zürich, zu erörtern Gelegenheit. Auch ihm möchte ich
ausdrücklich danken, nicht zuletzt aber meinen Freunden Karlfried
Gründer und Odo Marquard für viele Gespräche über den Ursprung der
historischen Kulturwissenschaften aus dem Geist der Moderne.
Die Last einer elementaren Einarbeitung in Sachbereiche, auf die sich
die Zuständigkeit von Philosophen nicht eo ipso erstreckt, lag auch bei
meinen derzeitigen Mitarbeitern, Frau lic. phil. Sidonia Blättier Schie
mann, Herrn lic. phil. Tobia Bezzola, Herrn Dr. David Bosshart und
Herrn Dr. Marco Molteni. Ihnen habe ich über die Gelegenheit der
Erörterung von Sachproblemen hinaus für Literaturbeschaffung, für
Mithilfe bei der Korrektur sowie bei der Herstellung der Register zu
danken. Bei Frau Grete Stoll-Langenberg lag die technische Herstellung
des Manuskripts. Diese Technik ist heute anspruchsvoll, und nur wer sie
beherrscht, bringt dem Autor wie dem Verleger Gewinn. Das war hier
gewährleistet - nicht zuletzt dank mannigfachen freundlichen Beistands,
den in allen Programmierungsfragen Herr Dr. Alois Rust gewährte.
Dank gebührt schließlich der Fritz Thyssen Stiftung, die es mir möglich
machte, mich für einige Zeit aus der akademischen Routinearbeit in eine
Klausur zurückzuziehen. Ohne diese Zeitfreistellung hätte sich der
Gesamtzeitraum, innerhalb dessen ich mich mit diesem Buch zu
beschäftigen hatte, weit mehr als verdoppeln müssen.
Zürich. Herbst 1991 Hermann Lübbe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ............................................. .
Vorbemerkung zur Lage der zeittheoretischen Literatur 25
1. Schwierigkeiten mit der Erinnerung.
Über den Umgang mit der Vergangenheit im Fortschritt 37
1.1 Die Gegenwart der Toten.
Historisierter Friedhof und anonyme Bestattung .......... 37
1.2 Denkmalschutz oder die Paradoxien des Versuchs,
Altes neu alt zu machen ............................... 55
1.3 Die historisierte Moderne oder die Postmoderne .......... 75
1.4 Exkurs über Rückbau ................................. 88
2. Avantgarde oder Wie man wider Willen die Vergangenheit
fortschreitend interessanter macht ...................... 91
2.1 Das Avantgarde-Paradox:
Die Vergangenheit rückt der Gegenwart näher ............ 91
2.2 Avantgarde-Komplemente: Eklektik und Klassik .......... 107
3. Avantgarde und politische Geschichtssinnverwaltung ...... 119
3.1 Avantgardistische Kunst und totalitäre Herrschaft ........ 119
3.2 Politischer Avantgardismus oder Fortschritt und Terror .... 137
4. Informationsdynamik und Überlieferungsbildung ......... 155
4.1 Die Bürokratie und das Reliktmengenwachstum .......... 155
4.2 Kassation oder die archivarische Altaktenvernichtung ..... 167
4.3 Präzeption oder die gegenwärtige Vorwegnahme
zukünftiger Vergangenheitsrezeption .................... 191
4.4 Speicherbibliotheken oder der Zwang zur Entmischung
aktueller und veralteter Information ..................... 212
XII Inhaltsverzeichnis
5. Informationsdynamik und wissenschaftlich-technische
Evolution ........................................... 229
5.1 Wissenschaftskulturelle Folgen dynamisierter
Erkenntnispraxis ..................................... 229
5.2 Innovationsverdichtung in der technischen Evolution ...... 251
6. Exkurse............................................. 269
6.1 Exkurs 1. Kulturevolutionäre Beschleunigung:
Schein oder Sein? ..................................... 269
6.2 Exkurs H. Der Streit um die Kompensationsfunktion
der Geisteswissenschaften .............................. 281
7. Zeitnutzungszwänge .................................. 305
7.1 Technisch induzierte Zeitnutzungszwänge ................ 305
7.2 Zeit als Medium der Handlungskoordination.
Sozial bedingte Zeitnutzungszwänge ..................... 315
8. Zeitgewinne und kulturelle Zeitnutzungsfolgen ............ 329
8.1 Zeit als Freiheit ...................................... 329
8.2 Kulturelle und soziale Differenzierungsfolgen
der Zeitfreiheit ....................................... 343
9. Erlebte und gemessene Zeit ............................ 359
9.1 Subjektive und objektive Zeit .......................... 359
9.2 Kulturzeit und Naturzeit .............................. 379
Personenverzeichnis ...................................... 397
Begriffsverzeichnis ....................................... 405