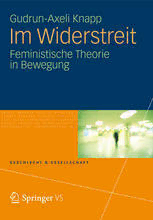Table Of ContentGeschlecht und Gesellschaft
Band 49
Herausgegeben von
B. Kortendiek, Duisburg-Essen, Deutschland
I. Lenz, Bochum, Deutschland
H. Lutz, Frankfurt/Main, Deutschland
M. Mae, Düsseldorf, Deutschland
S. Metz-Göckel, Dortmund, Deutschland
M. Meuser, Dortmund, Deutschland
U. Müller, Bielefeld, Deutschland
M. Oechsle, Bielefeld, Deutschland
B. Riegraf, Paderborn, Deutschland
P.-I. Villa, München, Deutschland
Geschlechterfragen sind Gesellschaftsfragen. Damit gehören sie zu den zentralen
Fragen der Sozial-und Kulturwissenschaften; sie spielen auf der Ebene von Sub-
jekten und Interaktionen, von Institutionen und Organisationen, von Diskursen
und Policies, von Kultur und Medien sowie auf globaler wie lokaler Ebene eine
prominente Rolle. Die Reihe „Geschlecht & Gesellschaft“ veröffentlicht heraus-
ragende wissenschaftliche Beiträge, aus der Frauen- und Geschlechterforschung,
die Impulse für die Sozial- und Kulturwissenschaften geben. Zu den Veröffent-
lichungen in der Reihe gehören neben Monografien empirischen und theoretischen
Zuschnitts Hand- und Lehrbücher sowie Sammelbände. Zudem erscheinen in
dieser Buchreihe zentrale Beiträge aus der internationalen Geschlechterforschung
in deutschsprachiger Übersetzung.
Herausgegeben von
Dr. Beate Kortendiek, Prof. Dr. Michael Meuser,
Universität Duisburg-Essen TU Dortmund
Prof. Dr. Ilse Lenz, Prof. Dr. Ursula Müller,
Ruhr-Universität Bochum Universität Bielefeld
Prof. Dr. Helma Lutz, Prof. Dr. Mechtild Oechsle,
Johann-Wolfgang-Goethe Universität Universität Bielefeld
Frankfurt/Main
Prof. Dr. Birgit Riegraf,
Prof. Dr. Michiko Mae, Universität Paderborn
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
Prof. Dr. Paula-Irene Villa,
Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, LMU München
TU Dortmund
Koordination der Buchreihe:
Dr. Beate Kortendiek,
Netzwerk Frauen-
und Geschlechterforschung NRW,
Universität Duisburg-Essen
Gudrun-Axeli Knapp
Im Widerstreit
Feministische Theorie in Bewegung
Gudrun-Axeli Knapp Voestalpine
Universität Hannover, Deutschland Linz, Österreich
Bernhard Schmidt
Langenhagen, Deutschland
ISBN 978-3-531-18267-4 ISBN 978-3-531-94139-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-531-94139-4
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufbar.
Springer VS
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden 2012
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Einbandentwurf: KünkelLopka GmbH, Heidelberg
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer Science+Business Media
www.springer-vs.de
Inhalt
Einleitung .............................................................. 7
I Rückblenden: Auseinandersetzung mit Weiblichkeit
Der „weibliche Sozialcharakter“ – Mythos oder Realität ?
Soziologische und sozialpsychologische Aspekte
des Sozialcharakter-Konstrukts .......................................... 29
Arbeitsteilung und Sozialisation: Konstellationen von Arbeitsvermögen
und Arbeitskraft im Lebenszusammenhang von Frauen .................. 57
Die vergessene Differenz ................................................ 101
II Traditionen – Brüche
Traditionen – Brüche. Kritische Theorie
in der feministischen Rezeption ......................................... 129
Konstellationen von Kritischer Theorie und Geschlechterforschung ...... 165
III Aporie als Grundlage: Denken in Bewegung
Aporie als Grundlage. Zum Produktionscharakter
der feministischen Diskurskonstellation ................................. 193
Macht und Geschlecht. Neuere Entwicklungen
in der feministischen Macht- und Herrschaftsdiskussion ................. 225
6 Inhalt
Machtanalyse in Zwischen-Zeiten ....................................... 261
Schmuggeln, lernen, ignorieren. Erfahrungen unter Schwestern ......... 271
Frauen-Solidarität und Differenz. Zum politischen
und utopischen Gehalt des „affidamento“-Konzepts ..................... 287
Grundlagenkritik und „stille Post“. Zur Debatte
um einen Bedeutungsverlust der Kategorie „Geschlecht“ ................ 301
Postmoderne Theorie oder Theorie der Postmoderne ?
Anmerkungen aus feministischer Sicht .................................. 329
„Trans-Begriffe“, „Paradoxie“ und „Intersektio nalität“.
Notizen zu Veränderungen im Vokabular der Gesellschaftsanalyse ....... 385
IV Intersektionalität
Traveling Theories: Anmerkungen zur neueren Diskussion
über „Race, Class, and Gender“ .......................................... 403
Verhältnisbestimmungen: Geschlecht, Klasse, Ethnizität
in gesellschaftstheoretischer Perspektive ................................ 429
„Intersectional Invisibility“. Anknüpfungen und Rückfragen
an ein Konzept der Intersektionalitätsforschung ......................... 461
Konstellationen – Konversationen: Drei Geschichten ..................... 483
Editorische Anmerkung ................................................. 505
Einleitung
In ihrer Quellensammlung zur Neuen Frauenbewegung in Deutschland spricht
Ilse Lenz vom „magischen Viereck“ (Lenz 2008: 360), das sich nach 1980 zwi-
schen Frauenbewegungen, Frauenforschung, Gleichstellungsstellen und frauen-
bewegten Politikerinnen entfaltete. Die Ausstrahlungskraft dieses „Vierecks“
beruhte in den Jahren des Aufbruchs und der institutionellen Verankerung fe-
ministischer Anliegen auf dem hohen Maß an Vernetzung sowie wechselseitiger
Legitimationsproduktion und Bestärkung zwischen Akteurinnen in den unter-
schiedlichen Praxisfeldern. Zwar war die Beziehung der „zwei (un)geliebten
Schwestern“ (Metz-Göckel 1989) von Frauenforschung und Frauenpolitik nie frei
von Spannungen und von Anfang an auch Gegenstand von Auseinandersetzun-
gen. Gleichwohl wurden diese in dem übergreifenden Raum einer feministischen
Öffentlichkeit ausgetragen, die sich bei allem Dissens im Einzelnen auf einen ge-
meinsamen Impetus der Kritik patriarchaler Verhältnisse berufen konnte. Seit
den 1980er Jahren hat sich das Interaktionsfeld zwischen sozialer Bewegung,
Wissenschaft und institutionalisierter Frauen- und Gleichstellungspolitik erheb-
lich verändert. Damit veränderte sich ein Stück weit auch der transversale Dis-
kursraum, der sie verband. In einem wissenssoziologischen Text zum Verhältnis
von Geschlechterwissen und sozialer Praxis konstatiert Angelika Wetterer, dass
die verschiedenen Provinzen von Genderwissen und -praxis unterschiedliche
und teilweise konkurrierende Wirklichkeitskonstruktionen nicht nur hervor-
bringen – sondern auch unter den Bedingungen institutioneller Differenzierung
hervorbringen müssen (Wetterer 2008). Dieser Sachverhalt kann dann zum Pro-
blem werden, wenn die Bereiche sich unter dem Einfluss verschärfter Spezia-
lisierung und Professionalisierung gegeneinander abschotten und füreinander
fremdsprachig zu werden drohen. Unverständlich füreinander zu werden ist ge-
fährlich, wenn man aufeinander angewiesen ist.
In den kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen ist viel darüber dis-
kutiert worden: Feministische Theorie, die sich separiert sowohl von den Bezü-
gen auf soziale Bewegungen als auch auf institutionalisierte Politik, und die sich
selbstgenügsam in den Parallelwelten ihrer wissenschaftlichen Disziplinen ein-
richtet, sägt an dem Ast, der sie (noch) trägt. Paradoxerweise, und eben darin liegt
ein zentraler Konflikt des „akademischen Feminismus“ (Hark 2005) begründet,
G-A. Knapp, Im Widerstreit, DOI 10.1007/978-3-531-94139-4_1,
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden 2012
8 Einleitung
gilt das aber auch in der Gegenrichtung: Als Wissenschaft kann feministische
Theorie nicht so agieren, als sei sie Politik; wissenschaftliche Anerkennung ver-
schaffen ihr allenfalls, zumindest nach dem Selbstideal der scientific community,
wissenschaftsimmanente Profilierungen sowie Distanz zu Politik und normativer
Kritik. Doch bekanntlich gilt auch, dass akademische Diskursregeln nicht völlig
losgelöst am Wertehimmel schweben, sondern sozial situiert und mit Machtpoli-
tiken untrennbar verflochten sind. Nicht selten hat das Ideal einer nur der Ob-
jektivität und Wertneutralität verpflichteten Diskursgemeinschaft Zwecken der
Ausgrenzung, der Machtsicherung und der interessengeleiteten Zuweisung von
Sprecherpositionen gedient. Dies ist nicht nur ein verbreiteter Befund der Wis-
senschaftsforschung und der Historischen Epistemologie; für die Frauen- und
Geschlechterforschung gehört sie zu den Grunderfahrungen (Hausen/Nowotny
1986; Gehring/Klinger/Knapp/Singer 2003).
Der Spagat, in dem sich die Frauen- und Geschlechterforschung hier und
heute bewegt, ist beträchtlich. Strukturelle Gründe dafür liegen in den bekann-
ten Gegenläufigkeiten von wissenschaftlichem Erkenntnis- und politischem Ver-
änderungsinteresse, Neutralitäts- und Kritikanspruch, die wieder verstärkt als
nicht nur der Tendenz nach, sondern als in einem grundsätzlichen Sinne in-
kompatibel behauptet werden. Weitere Faktoren tragen dazu bei, dass die Situa-
tion heute komplizierter ist als in den Anfängen. So haben sich die feministische
Emanzipationsbewegung und ihre wissenschaftlichen wie politischen Verzwei-
gungen insgesamt verändert. Diese Veränderungen manifestieren sich in Ab-
wanderungstendenzen und Ermüdungserscheinungen, wie sie Ute Gerhard in
ihrem Buch „Atempause“ (1999) beschreibt, aber ebenso in der Diversifika tion
des Feminismus und der Streuung feministischer Ideen in unterschiedlichste
Kontexte hinein (Villa 2003). Das feministische „Wir“ und die Sektoren des „ma-
gischen Vierecks“ sehen heute anders aus als in den 1980er Jahren. Dabei ist al-
lerdings – gegen die räumliche Statik der Metapher vom „Viereck“ – zweierlei
im Blick zu behalten: Aus einer Perspektive, die die biographischen Bewegungen
der jeweiligen Akteurinnen in Rechnung stellt, sind die Bereiche nie so getrennt
gewesen, wie sie in der strukturellen bzw. systemischen Sicht erscheinen. Zumin-
dest in einer Richtung hat es immer Durchlässigkeit gegeben: Ein Großteil der
Personen, die heute im Bereich der Gleichstellungspolitik arbeiten, hat studiert
und sich während seines Studiums, teilweise auch noch danach, mit feministi-
schen Theorien und empirischen Befunden der Frauen- und Geschlechterfor-
schung beschäftigt. Nicht selten handelt es sich um Wissenschaftlerinnen, die
mangels Stellen an den Hochschulen auf den größeren Arbeitsmarkt im Bereich
der Gleichstellungs- und Frauenpolitik ausgewichen sind. Sie verfügen daher
Einleitung 9
potentiell über besondere Einsicht in die Spannungen zwischen feministischer
Theorie bzw. Forschung und politischer Intervention.
Eine zweite Beschränkung der Metapher vom „Viereck“, die räumliche
Trennungen akzentuiert, liegt darin, dass alle ihre Bereiche von übergreifen-
den Entwicklungen einer zunehmenden Vermarktlichung tangiert sind, die in
den Feldern zwar je spezifisch bearbeitet werden müssen, aber ihrer Anforde-
rungslogik nach gleichsinnig funktionieren. Beschreibungen der Umrisse und
Auswirkungen dieses Wandels in den verschiedenen Feldern und deren Wechsel-
wirkungen bleiben aber bislang notwendig etwas impressionistisch, weil empiri-
sche Untersuchungen dieser Zusammenhänge noch weitgehend fehlen.
Zunehmend wichtig für die Analyse der gegenwärtigen Situation des Femi-
nismus erscheinen mir besonders jene Veränderungen, die sich nicht als Sym-
ptome seiner Marginalität und seines Veraltens, sondern im Gegenteil als Effekte
seiner eigenen Erfolge begreifen lassen – wobei auch das Veralten selbst, und
dies gehört zu den vielen Paradoxien des Feminismus, zumindest teilweise auf
Erfolgen basiert. Im Zuge ihres Wirksamwerdens und ihrer Verbreitung haben
feministische Forderungen die Rahmenvorgaben und Regeln der verschiedenen
Praxiskontexte sowohl transformiert als sich auch in sie eingefügt und ihnen
anverwandelt. Das schafft veränderte und verändernde Handlungs- und Refle-
xionsbedingungen. Auffällig ist in den Sozial- und Kulturwissenschaften heute
die Drift zwischen einem sich in Publikationen nach wie vor manifestierenden
Festhaltenwollen an dem an die Wurzeln gehenden, d. h. radikalen Impuls fe-
ministischer Gesellschafts- und Wissenschaftskritik und deren Erneuerung mit
Blick auf die Problemlagen und Deutungshorizonte der Gegenwart auf der einen
und der gleichzeitig stattfindenden institutionellen Begünstigung enger gefass-
ter, primär anwendungsorientierter Gender-Kompetenzen auf der anderen Seite.
Dabei handelt es sich nicht mehr nur um Unterschiede, die Differenzierungen
der jeweiligen Praxisbereiche im Sinne der sektoralen Trennung ausdrücken. Im
Bereich der Wissenschaft geht es um Verdrängungskonkurrenzen im selben Feld.
An vielen Universitäten im deutschen Sprachraum konnten sich in der jüngeren
Vergangenheit Gender-Einrichtungen im innerakademischen Wettbewerb um
knappe Mittel nur deshalb erfolgreich durchsetzen oder zumindest auf prekärem
Niveau halten, weil ihre Protagonistinnen sowohl die Innovationsrhetorik be-
dienten als auch, unter Tilgung des Adjektivs „feministisch“, die Nützlichkeit der
von ihnen lieferbaren Qualifikationen zur Ressourcenmobilisierung glaubhaft zu
machen wussten. Auch die Bologna-Reformen erlaubten residuale Formen der
Absicherung in Form von „Gender-Modulen“ oder durch die Verankerung von
„Gender-Aspekten“ in „Praxis-Modulen“, auch in diesem Kontext wurde strate-