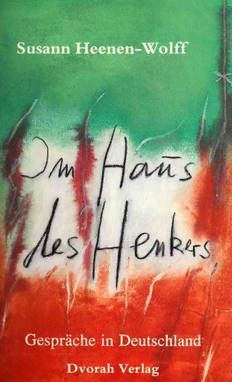Table Of ContentGespräche in Deutschland
Dvorah Verlag
Die achtzehn Gespräche, die in diesem
Buch dokumentiert werden, wurden
im Lauf des Jahres 1991 in verschiede-
nen Städten Deutschlands geführt, ei-
nes in Paris.
Sie können eine vorläufige Antwort ge-
ben aufdie häufig gestellte Frage: War-
um haben Opfer der Schoah s^ch ausge-
rechnet in Deutschland niedergelassen?
Und: Mit welchen Gedanken, Träu-
men und mit welcher Angst leben sie
hier? Wie erfahren sie die alten, die neu-
alten, die neuen Deutschen?
Susann Heenen-Wolff wurde 1956 ge-
boren. Sie studierte Pädagogik, Psycho-
logie und Soziologie in Frankfurt am
Main und promovierte über »Die
Frcudschc Pychoanalysc zwischen Assi-
milation und Antisemitismus«.
1975-1976 lebte sie inJerusalem.
Neben ihrer publizistischen Tätigkeit
ist sie als Psychoanalytikerin tätig.
BuchVeröffentlichungen:
»Wenn ich Oberhuber hieße«. Die
Freudsche Psychoanalysezwischen Assi-
milation und Antisemitismus. Frank-
furt am Main, 1987
»Erez Palästina«. Juden und Palästinen-
ser im Konflikt um ein Land. Frankfurt
am Main, 3. Auflage 1990
Esther Bejarano Kurt Borzik Ignatz Bubis Lola
• • •
Fischel Moses Gercek Rosa Fischer Gitta
• • •
Guttmann AlfredJachmann RolfK. Bertha
• • •
Kellner Mia Lehmann Gerd Lifschitz Max
• • •
Mannheimer Sophie Marun Hans Radziewski
• • •
Trude Simonsohn • Florence Singewald •
Isak Wasserstein
»Im Haus des Henkers«
Gespräche in Deutschland
Herausgegeben von Susann Heencn-Wolff
Umschlaggestaltung: Sarah Schumann
© 1992 by Alibaba Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Satz Textline, Oberursel
Druck: Fuldaer Vcrlagsanstalt GmbH
Printed in The Federal Republic ofGermany
DVORA VERLAG
ist das Literaturprogramm
im ALIBABA VERLAG
Susann Heenen-Wolff
IM HAUS DES HENKERS
Gespräche in Deutschland
Dvorah Verlag
Frankfurt am Main
Vorwort
5
1. Moses Gercek, München n
2. Trude Simonsohn, Frankfurt 32
3. Rosa Fischer, Hannover 52
4. Hans Radziewski, Berlin (West) 65
5. Bertha Kellner, Erfurt 77
6. RolfK., Unna 9I
7. Kurt Borzik, Frankfurt !26
8. Florence Singewald, Erfurt !^8
9. Ignatz Bubis, Frankfurt K5^
10. Isak Wasserstein, München j8o
1 1. Mia Lehmann, Berlin (Ost) 203
12. Sophie Marun, Berlin (Ost) 214
13. AlfredJachmann, Frankfurt 224
14. Max Mannheimer, München 240
15. Gerd Lifschitz, Berlin (West) 249
16. Gitta Guttmann, Frankfurt 262
17. Esther Bejarano, Hamburg 278
18. Lola Fischel, Hannover 301
Vorwort
»Wie findet man die Leute?« wurde ich während meiner
Recherchen für das vorliegende Buch von Freunden und
Bekannten immer wieder gefragt. Die Frage ist naheliegend.
Man weiß, daß die Nationalsozialisten bei ihrem Versuch, die
Juden vom Planeten Erde zu tilgen, mit äußerster Gründlich-
keitvorgegangen sindundin Deutschlandnurnoch sehrweni-
geJuden leben. Es war deshalb überraschend, wie leicht ich auf
Anhieb Überlebende der Shoah in verschiedenen Städten
Deutschlands gefunden habe.
Jeder Überlebende, mit dem man spricht, stellt paradoxer-
weise eine Irritation dar. Wie haben sie überleben können, wo
doch eigentlich kein Entkommen, kein Überleben möglich
war?Jeder Überlebende scheint die Beschreibungen des natio-
nalsozialistischentotalenVernichtungssystemsLügenzustrafen.
Aber die Gespräche zeigen, wie zufällig dieses Überleben
war. Einmal war es die rechtzeitige Auswanderung, dann war
es das Vorrücken der sowjetischen Armee und die folgende
Evakuierung der Todeslager, ein anderes Mal war es — leider
selten— der List und dem Mut von Verwandten und Freunden
zu verdanken, daß in diesem totalitären System doch noch
lebensrettende Nischen aufgetan werden konnten.
Die Gespräche, die ich geführt habe, handeln nicht in erster
Linie vom Überleben in der Emigration, im Versteck, im
Gefängnis, bei der Zwangsarbeit, im Konzentrationslager, im
Vernichtungslager. Sie handeln vor allem von der Zeit danach.
Wie war es möglich, daß nach der Ermordung von Millio-
nen jüdischer Menschen durch Deutsche Überlebende sich
gerade wieder in Deutschland niederließen? Eine im Jahre
UNRRA
1945/1946 von der Flüchtlingsorganisation (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration) durchge-
führte Untersuchung unter etwa zwanzigtausendJuden in den
Flüchtlingslagern ergab, daß 96,8% von ihnen den festen Wil-
len hatten auszuwandern1
.
Im Haus des Henkers
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nachdem das
Ausmaß der Verbrechen der Nationalsozialisten in vollem
Umfang bekannt wurde, gingen Juden in aller Welt davon
aus, daß Deutschland in Zukunft ein gebanntes Land sein
würde, so wie einstmals Spanien nach der Vertreibung der
Juden im Jahre 1492. In den Jahren 1945 bis 1950 hielten
sich jedoch zeitweise bis zu zweihunderttausend jüdische
DP's (displaced persons) in Deutschland auf, viele von
UNRRA
ihnen in Übergangslagern, die die vor allem im
bayerischen Raum zur Verfügung stellte. Die Überleben-
den der Shoah warteten dort auf Ausreisemöglichkeiten, -
die einen nach Israel, das im Jahre 1948 gegründet wurde,
die anderen nach Amerika, dem zweiten Gelobten Land,
für das sich viele Überlebende nach der für sie günstigen
Novellierung des Einwanderergesetzes entschieden. Aber
einige deutsche Juden blieben, und vor allem osteuropäi-
sche Juden ließen sich in Deutschland dauerhaft nieder.
Anfang der fünfzigerJahre zählte man funfzehntausend Mit-
glieder der neu konsolidierten Jüdischen Gemeinden in der
jungen Bundesrepublik.
Lange lebten diese Juden mit der Ideologie der gepackten
Koffen, wie es scherzhaft unterJuden hieß, — mit dem festen
Willen, bald doch noch auszuwandern, wenn nicht diesesJahr,
dann aber im nächsten - spätestens im übernächsten. Heute
leben schätzungsweise funfzigtausend Juden in Deutschland,
dreißigtausend von ihnen sind Mitglieder der Jüdischen
DDR
Gemeinden. In der wurden 1961 eintausendfunfhundert
Gemeindemitglieder gezählt, ihre Zahl wirdjetzt aufwenige
hundert geschätzt.
Eine Vielzahl von Veröffentlichungen nach 1945 hat sich
mit den Folgewirkungen von Verfolgung und Lagerhaft unter
dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt2 Auch wurden
.
Untersuchungen über die sogenannte >zweite Generation<
nach Auschwitz veröffentlicht, d.h. über die Kinder der ehe-
mals Verfolgten3 In den achtzigerJahren schließlich erschie-
.
nen erste Untersuchungen und Zeitzeugnisse über das Leben
vonJuden in Österreich, der Bundesrepublik, schließlich auch
DDR
in der 4
.
Die Geschichte derJuden in Deutschland nach 1945 ist also
erstin allcrjüngstcrZeitGegenstand wissenschaftlichen Intcrcs-
Vorwort
7
ses geworden, und zwarhauptsächlich bei derjüdischen Mino-
BRD
rität selbst (vgl. Monika Richarz,Juden in der und in der
DDR
seit 1945, in: Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945,
Frankfurt 1986). Die Gruppe jenerJuden, die sich nach 1945
auf deutschem Boden sammelten, setzte sich außerordentlich
heterogen zusammen. Die wenigen deutschenJuden waren in
der Regel völlig assimiliert, viele hatten nicht-jüdische Ehe-
partner, während der große Teil der aus Osteuropa stammen-
den Juden noch Jiddisch sprach und die ersten Erfahrungen
mit (Reichs-)Deutschen bei der Selektion im Lager gemacht
hatte.
Nach dem wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepu-
blik und der Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes
(»Wiedergutmachung«) kehrten in den fünfziger Jahren erst-
mals auch deutscheJuden in ihr einstiges Heimatland zurück.
Aus Ungarn und der Tschechoslowakei wandertenJuden nach
dem Aufstand von 1956 und dem Prager Frühling 1968 in die
Bundesrepublik ein.
Es ist zunächst festzuhalten, daß es (außer persönlichen
Lebenszeugnissen, Autobiographien) keine Dokumentationen
bzw. Untersuchungen der Lebenserfahrungen von Überleben-
den der Shoah nach 1945 in Deutschland gibt. Mir erklärt sich
dies aus der Tendenz, die Tatsachejüdischen Lebens in Nach-
kriegsdeutschland zu verleugnen, und zwar in erster Linie von
Seiten der jüdischen Gemeinschaft selbst. Aus ihren Reihen
stammenaberinersterLiniedieForscherjüdischerLebensreali-
tät vor dem Hintergrund der Shoah.
Der HistorikerDan Dinersprichtvon einer>negativen Sym-
biose< zwischen Deutschen undJuden nach dem Nationalsozia-
lismus (in: Babylon. Beiträge zurjüdischen Gegenwart, Frank-
furt 1986). Damit kennzeichnet er die Tatsache einer - umge-
kehrt proportionalen — gemeinsamen historischen Erfahrung:
»FürDeutsche wie fürJuden istdasEreignisderMassenvernich-
tung zum Ausgangspunkt ihres Selbstverständnisses gewor-
den, eine Art von gegensätzlicher Gemeinsamkeit - ob sie es
wollen oder nicht. Deutsche wieJuden sind durch dieses Ereig-
nis neu aufeinander bezogen worden. Solch negative Symbio-
se, von den Nazis konstituiert, wird aufGenerationen hinaus
das Verhältnis beider zu sich selbst, vor allem aber zueinander,
prägen.« (a.a.O.)
8 Im Haus des Henkers
Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten melden
sich erste leise Zweifel an dieser Bestimmung deutscher Identi-
tät, zumindest bei einigen meiner Gesprächspartner.
ImJahre 1991, also in dem Zeitraum, in dem die folgenden
Gespräche stattfanden, sind die Überlebenden der Shoah, die
noch bewußte Erinnerungen an die Nazi-Zeit verfugen, min-
destens achtundfünfzig Jahre alt (Jahrgang 1933). Angesichts
der geringeren Überlebenschancen von Kindern während der
Shoah ist der größere Anteil der Überlebenden mindestens
Sechsundsechzig Jahre alt (Jahrgang 1925), das heißt, daß die
meisten sich ihrem Lebensabend nähern.
VielemeinerGesprächspartnersprechenDeutsch mitschwe-
rem Akzent. In der Verschriftung geht dies leider verloren. Ich
habe mich gleichwohl bemüht, den Wortlaut so wenig wie
möglich zu korrigieren. Der Leser wird feststellen, daß häufig
Brüche im Gesprächsverlauf zu verzeichnen sind. Ich habe
auch daraufverzichtet, meine Fragen im Nachhinein zu schö-
nen, und so wird man z. B. feststellen, daß ich nach dem
Geburtsnamen frage, als mir erklärt wird, daß gerade die
Nachricht vom Tod der eigenen Mutter kam. Es hat etwas
Ungeheueres, bei Kaffee und Kuchen über Verfolgung und
Vernichtung zu sprechen.
Bei den Gesprächen wurde viel geweint.
Nicht alle der von mir kontaktierten Überlebenden waren
zu einem Gespräch bereit. Vielmehr wurde ich einige Male
recht barsch abgewiesen, ohne daß ich überhaupt die Zeit
gehabt hätte, zu erklären, um was es geht. Andere haben
immer wieder Terminschwierigkeiten vorgeschützt, bis ich
verstanden habe, daß sie lieber nicht über ihre Erfahrungen
sprechen möchten. Die Namen meiner Gesprächspartner sind
nur aufWunsch verändert worden (zweimal), es geht aus dem
Text hervor.
Susann Heenen-Wolff
Paris, im Winter lggi
1 vgl. Idith Zertal: Verlorene Seelen. Diejüdischen DP's und die israelische
Staatsführung, in: /ka/Babylon/ke/. Beiträge zurjüdischen Gegenwart. Heft
5, Verlag Neue Kritik, Frankfurt 1989
2 Ausder unübersehbaren Anzahl von Titeln zu Folgewirkungen von Verfol-
gungund Lagerhaftseien einigegenannt:
- Psychoanalytic Reflections on the Holocaust, Hrsg. v. Steven Luel & Paul
Marcus, New York 1984