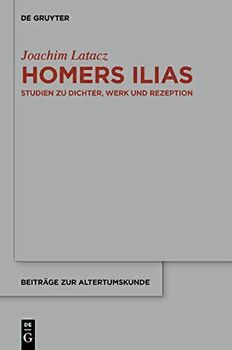Table Of ContentJoachim Latacz
Homers Ilias
Beiträge zur Altertumskunde
Herausgegeben von Michael Erler, Dorothee Gall,
Ludwig Koenen und Clemens Zintzen
Band 327
Joachim Latacz
Homers Ilias
Studien zu Dichter, Werk und Rezeption
(Kleine Schriften II)
Herausgegeben von
Thierry Greub, Krystyna Greub-Frącz
und Arbogast Schmitt
ISBN 978-3-11-030619-4
e-ISBN 978-3-11-030636-1
ISSN 1616-0452
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Abbildung Frontispiz: Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC-by-sa 3.0
© 2014 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen
∞ Gedruckt auf säurefreiem Papier
Printed in Germany
www.degruyter.com
Tabula gratulatoria
Michael von Albrecht (Heidelberg) Widu-Wolfgang Ehlers (Berlin)
Klaus Alpers (Hamburg) Heiner Eichner (Wien)
Karin Alt (Berlin) Johannes Andreas Eichrodt
Annemarie Ambühl (Groningen/ (Stiftsschule/Gymnasium
Mainz) Kloster Einsiedeln)
Bernard Andreae (Rom) Michael Erler (Würzburg)
Emil Angehrn (Basel) Manfred Erren (Freiburg/Br.)
Rüstem Aslan (Çanakkale/TR)
Hellmut Flashar (München)
Antonín Bartoněk (Brno/CZ) Hans Freimann (Lörrach)
Michał Bednarski (Katowice/PL) Andreas Fritsch (Berlin)
Marion Benz (Freiburg/Br.) Heide Froning (Marburg)
Wolfgang Bernard (Rostock) Therese Fuhrer (München)
Monika Bernett (München)
Peter Bernholz (Basel) Hans Armin Gärtner (Heidelberg)
Anton Bierl (Basel) Guido Gallacchi (Basel)
Andrea Bignasca (Basel) Volkmar von Graeve (Milet)
Margarethe Billerbeck (Fribourg) Fritz Graf (Columbus, OH)
Peter Blome (Basel) Jonas Grethlein (Heidelberg)
Gottfried Boehm (Basel) Thierry Greub (Köln)
Dietrich Boschung (Köln) Krystyna Greub-Frącz (Köln)
Urs Breitenstein (Basel) Hans-Ueli Gubser (Basel)
Claude Brügger (Basel) Martin-A. Guggisberg (Basel)
Leonhard Burckhardt (Basel)
Walter Burkert (Zürich) Olav Hackstein (München)
Jürgen Hammerstaedt (Köln)
William M. Calder III (Urbana- Henriette Harich-Schwarzbauer
Champaign, IL) (Basel)
Hubert Cancik (Berlin) Friedrich-Wilhelm von Hase
Andreas Cesana (Mainz) (Mannheim)
Eric H. Cline (Washington, DC) Helmut Heit (Berlin)
Marina Coray (Basel) Ernst Heitsch (Regensburg)
Konrad Heldmann (Kiel)
Joachim Dalfen (Salzburg) Heinrich Hettrich (Würzburg)
Margaretha Debrunner (Basel) Judith Hindermann (Basel)
Sigrid Deger-Jalkotzy (Salzburg) Tonio Hölscher (Heidelberg)
Ueli Dill (Basel) James Holoka (Ypsilanti, MI)
Paul Dräger (Trier) Martin Hose (München)
Hartwig Isernhagen (Basel) Wolf-Lüder Liebermann (Bielefeld/
Emanuel Isler (Basel) Gießen)
Tomas Lochman (Basel)
Peter Jablonka (Tübingen) Walther Ludwig (Hamburg)
Markus Janka (München) Georges Lüdi (Basel)
Richard Janko (Ann Arbor, MI) Wolfgang Luppe (Halle/Saale)
Irene de Jong (Amsterdam)
D. N. Maronitis (Athen)
Lutz Käppel (Kiel) Hans-Peter Mathys (Basel)
Athanasios Kambylis (Hamburg) Christian Meier (München)
Richard Kannicht (Tübingen) Michael Meier-Brügger (Berlin/
Gerhilde und Ferenc Kása (Lörrach/ Hamburg)
Budapest) Ella van der Meijden-Zanoni (Basel)
Helen Kaufmann (Oxford) Beat Meyer-Wyss (Basel)
Stefan Kipf (Berlin) Oliver Michalsky (Berlin)
Robert Kirstein (Münster/Tübingen) Franco Montanari (Genua)
Michiel Klein-Swormink (Boston) Ian Morris (Stanford)
Hans Kloft (Bremen) Glenn Most (Pisa/Chicago)
Ludwig Koenen (Ann Arbor, MI) Achatz von Müller (Basel/Hamburg)
Bernd Kolf (Leipzig) Martin Müller (Liestal)
Robert Kopp (Basel) Fritz-Heiner Mutschler (Dresden)
Katja Korfmann (Ofterdingen)
Manfred Kraus (Tübingen) Marco Nicola (Basel)
Martha Krieter (Zürich/Basel) Wolf-Dietrich Niemeier (Athen)
Uta Kron (Jena) Johannes Nollè (München)
Andreas Külling (Basel) René Nünlist (Köln)
Bernhard Kytzler (Durban, SA)
Douglas Olson (Freiburg/Br.–
Thomas Lambrecht (Basel) Minneapolis)
Manfred Landfester (Gießen) Henning Ottmann (München)
Roland Laszig (Freiburg/Br.)
Marion Lausberg (Augsburg) Ernst Pernicka (Tübingen/
Eckard Lefèvre (Freiburg/Br.) Mannheim)
Katharina Legutke (Berlin) Karl Pestalozzi (Basel)
Gustav Adolf Lehmann (Göttingen) Christian Pietsch (Münster)
Achim Wolfgang Lenz (Chur) Serena Pirrotta (Berlin)
Lexikon des frühgriechischen Epos Robert Plath (Erlangen)
(Hamburg) Egert Pöhlmann (Erlangen)
Maria Liatsi (Ioannina) Irene Polke (Königstein/Ts.)
Karl Reber (Lausanne) Wilfried Stroh (München)
Michael Reichel (Düsseldorf) Rolf A. Stucky (Basel)
Hansjörg Reinau (Basel) Jerzy Styka (Kraków)
Christiane Reitz (Rostock) Werner Suerbaum (München)
Antonios Rengakos (Thessaloniki)
Edzard Reuter (Stuttgart) Rainer Thiel (Jena)
Christoph Riedweg (Zürich) Lukas Thommen (Basel)
Eva Tichy (Freiburg/Br.)
Johannes Saltzwedel (Hamburg) Catherine Trümpy (Heidelberg)
Carlo Scardino (Freiburg/Br.) Hans Jürgen Tschiedel (Eichstätt)
Alexandra Scharfenberger (Köln) Kurt Tschopp (Basel)
Petra Schierl (Basel)
Albert von Schirnding (Egling) Gyburg Uhlmann (Berlin)
Karin Schlapbach (Ottawa) Jürgen von Ungern-Sternberg (Basel)
Renate Schlesier (Berlin) Knut Usener (Wuppertal)
Johan Schloemann (München)
Ernst A. Schmidt (Tübingen) Edzard Visser (Basel/Mayen)
Arbogast Schmitt (Marburg/Berlin) Ernst Vogt (München)
Christine Schmitz (Münster) Sabine Vogt (Bamberg)
Heike Schmoll (Frankfurt/Main)
Franka Schneider (Franckesche Rudolf Wachter (Lausanne/Basel)
Stiftungen, Halle) Christine Walde (Mainz)
Ernst-Richard Schwinge (Kiel) Walter Wandeler (Basel)
Ruth Scodel (Ann Arbor, MI) Katharina Wesselmann (Basel)
Kurt Seelmann (Basel) Martin L. West (Oxford)
Bernd Seidensticker (Berlin) Stephanie West (Oxford)
Kurt Sier (Leipzig) Alfried Wieczorek (Mannheim)
Erika Simon (Würzburg) Andreas Willi (Oxford/Basel)
Rolf Soiron (Basel) Martin M. Winkler (Fairfax, VA)
Joseph Sopko (Basel) Georg Wöhrle (Trier)
Hans-Peter Stahl (Pittsburgh, PA)
Frank Starke (Tübingen) Bernhard Zimmermann (Freiburg/Br.)
Magdalene Stoevesandt (Basel) Reto Zingg (Basel)
Vorwort
Ein Buchvon Joachim Latacz mit seinen Arbeiten aus den letzten 20 Jahren zu
HomersIliasistnichtirgendeinHomerbuch,daszuvielenanderenhinzukommt,
esisteinGrundbuch–fürdieStudierenden,füralleandergroßenLiteraturder
Antike Interessierten, aber ebenso für die internationale Forschergemeinschaft,
diesichumdieErschließungdergeschichtlichenBedingungenderhomerischen
DichtungundvorallemumdieDeutungdiesesTextesalsLiteraturbemüht.
SeitmehralseinemhalbenJahrhundertbeschäftigtsichJoachimLataczmit
allen Aspekten des Homerischen Werks und hat für seine Forschungen höchste
Anerkennung–weltweit–erhalten.DerhiervorgelegtenSammlungseinerjün-
gerenArbeitenkommtdieselangeErfahrungseinesUmgangsmitHomerzugute.
DenGewinndokumentiertdasBuchinvielerHinsicht.
Es gibt auch, ja gerade in der neueren Forschung nur wenige Homer-Inter-
preten,diedieForschungsgeschichtenichtnurinihrenneuerenPhasen,sondern
inallenihrenPhasen–vonderAntikeanüberdieklassischenRezeptionsphasen
der Neuzeit bis in die Gegenwart – so gut kennen wie Joachim Latacz. Das au-
ßergewöhnlichumfassendegelehrteWissen,überdaserverfügt,isteinewichtige
Voraussetzungdafür,dassseineArbeitennichtaufeinzelnemodischeTendenzen
fixiertsind,sonderneinegroßeFüllevonDeutungsaspektenmitbedenken.Dieser
reiche Wissensfundus führt bei Joachim Latacz aber nicht dazu, dass seine Ar-
beitenzu einer bloßen Demonstrationvon Gelehrtheit werden,er führtganzim
Gegenteilzukonkreter,inhaltlichgefüllterAnschaulichkeitundvorallemdazu,
die historischverschiedenen Aneignungsweisen Homers innerhalb der Rezepti-
onsgeschichte aufeinander zu beziehen und das bleibend Aktuelle sichtbar zu
machen.
DasistdieVoraussetzungdafür,dassdieSammlungderwichtigstenAufsätze
zuHomersIlias,dieJoachimLataczindenletzten20Jahrengeschriebenhat,ein
GesamtbilddiesesWerksundseinesDichtersbietet.DieAufsätzesindzumTeilfür
einbreiteresgebildetesPublikumgeschriebenundhabendaherdieausdrückliche
Absicht, die großen, charakteristischen Merkmale des Homerischen Epos her-
auszuarbeiten und durch ihre Verbindung die Ordnung des Ganzen sichtbar zu
machen. Die meisten der hier publizierten Aufsätze abergreifen in die aktuelle
ForschungeinundbeziehenPosition.Lataczverzichtetnichteinervermeintlich
leichterenLesbarkeitzuliebeaufeinedifferenzierteDarstellungderProblemlage
in ihrer Komplexität, sondern sichert seine Deutungen durch philologisch, ar-
chäologisch und historisch sorgfältig erschlossene Quellen ab. Dass seine wis-
senschaftlichenArbeitendennochnichtnurfürdenFachmannattraktivundein
Gewinnsind,sondernfürjeden,deranLiteraturinteressiertist,liegtdaran,dass
X Vorwort
beiihmdiefachwissenschaftlicheGrundlagetatsächlicheineGrundlageist,deren
dienendeFunktionimmerdeutlichgemachtist.LataczbeteiligtseinenLeseran
demProzess,wieErkenntnissegefundenundbegründetwerden,selbstundmacht
immer mitverfolgbar, welchem Ziel die einzelnen Argumente dienen: Weshalb
beschäftigen wir uns überhaupt noch mit der Person Homers? Wie ist das Ver-
hältnis der Werke Homers zu denen seiner erschließbaren Vorgänger, und was
folgtdarausfürHomersbesondereQualität?AufdieseWeisewirdderLeserinein
lebendigesDenkenhineingezogen.ErbekommtnichtnurInformationen,sondern
verstehtdieGründesamtihrenFolgerungen,ausdeneneinWissenentsteht.
DieserVerfahrensweiseentsprichtdieGliederungdesBuches.Esbeginntmit
Kapiteln zu Homer als Person und damit zugleich bereits zu der über ein bloß
historisches Interesse hinausgehenden Frage, inwieweit wir aus den Texten er-
schließen können, dass sie das Werk eines Autors sind – gleichgültig,welchen
Namenwirihmgeben.
DerzweitegroßeAbschnitt‘DasWerk’behandeltzunächstvonverschiedenen
Gesichtspunkten her die Vorgeschichte, die man kennen muss, um die Beson-
derheiteinesliterarischenWerks,sodannganzbesondersabereinesWerkswiedie
Ilias verstehen zu können: Was geschah in den Jahrhunderten, die zwischen
Homer und der alten Grundgeschichte liegen, in die er seine eigene Geschichte
einbettet?WieistdasUmfelddereigenenZeit,indereinAutorwieHomertätig
werden konnte, beschaffen? Wie wurden die Geschichten um Troia vor Homer
erzähltundwelchekulturellenEntwicklungensindVoraussetzungdafür,dassaus
einer mündlichen Erzähltradition schließlich ein schriftlich fixiertes Kunstwerk
werdenkonnte?WaswissenwirüberdieBesonderheitdersoentstandenenepi-
schenDichtungsweise,wiesiebeiHomervorliegt?
Das Zentrum des Buches bilden dann die Kapitel,die die Deutungder Ilias
selbst zum Gegenstand haben. Am Beginn steht ein in analysierender Nacher-
zählungentstehenderAufweisdesBauplansderIlias.Dasist,sowieLataczdieses
Themabehandelt,keinebloßformale Untersuchung,dasAnliegenistvielmehr,
diekompositorischeEinheitdieseshochkomplexenWerksherauszuarbeitenund
sodessenliterarischeQualitäterkennbarzumachen.EinKapitelüberdieTech-
niken des Erzählens,wie sie die neuere Erzählforschung mit vielen Differenzie-
rungen entwickelt hat,ergänzt die Analyse der Werkkomposition um einen for-
malen Aspekt, dessen Möglichkeiten und Grenzen das Kapitel aufzeigt. In die
MittederIlias-InterpretationführendiebeidenKapitelüberAchilleus,diezentrale
GestaltdesWerks.DieIliasist–andersalsderspätergegebeneTitelsuggeriert–
keineGeschichtevonIlios(=Troia)undauchkeineGeschichtedestroianischen
Krieges,sonderneineAchilleïs,eineDarstellungdesHandelnsundLeidensdieser
einen großen Figur – mit ihren verhängnisvollen (das primäre Publikum der
Dichtung mahnenden) Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Der Facettenreich-