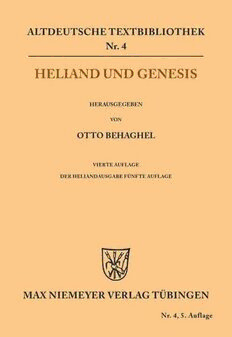Table Of ContentHeliand und Genesis
Herausgegeben
von
Otto Behaghel
Vierte Auflage
Der Heliandausgabe fünfte Auflage
/ \ \
m{N
Halle (Saale)
Verlag von Max Niemeyer
1933
Altdeutsche Textbibliothek, herausgegeben you H. Paul
Nr. 4.
Inhaltsverzeichnis.
Seite
Vorwort ν—χ
Erklärung· der gebrauchten Abkürzungen . . xi—xn
Einleitung xm—xxxiv
Uebersicht liber den Inhalt des Heliand . . . xxxv—xxxvi
Präfatio und Versus 1—3
Text des Heliand 4—207
Uebersicht über den Inhalt der Genesis . . . 210
Text der Genesis 211—248
Wörterbuch 249—289
Nachträge 290
Vorwort zur zweiten Auflage.
Ich habe, im Einklang mit den Untersuchungen von
Sievers, meiner Ausgabe des Heliand den Monacensis zu-
grunde gelegt, in dem Sinne, dass in jedem einzelnen
Fall die Fassung der beiden Handschriften gegeneinander
abgewogen, aber die Lesung von M aufgenommen wurde,
wenn sich keine innere Entscheidung treffen liées.
Auch die Rechtschreibung ist die des Monacensis,
soweit er vorhanden; eine Umschrift der betreffenden
Stücke des Cottonianus schien mir undurchführbar.
Normalisiert habe ich im Heliand wie in der alt-
sächsischen Genesis nur insoweit, als ich für die dentale
Spirans im Inlaut und Auslaut â gesetzt habe, fUr die
labiale 5 im Inlaut, f im Auslaut. Für die Stamm-
silben habe ich Quantitätsbezeichnung durchgeführt. Die
Endnngen blieben nnbezeichnet, da es sich nicht sicher
feststellen lässt, ob volle Endungen hier noch vorhanden
waren. Im angelsächsischen Text bin ich in der An-
nahme und Bezeichnung von Langdiphthongen gelegent-
lich zurückhaltender gewesen, als man es heute zu
sein pflegt.
Kaufmann hat ZsfdPh. XXXII, 511 sich also ver-
nehmen lassen: „es ist hohe Zeit, dass eine kritische
Ausgabe des Heliand komme, aber in einer Orthographie,
VI
bei deren Herstellung der Herausgeber sich ebenso un-
abhängig von unseren Handschriften halten, als auf das
vorsichtigste bestrebt sein muss, die geschichtlichen Werte
der Ueberlieferung zu schützen und zur Darstellung zu
bringen." Ich glaube von mir sagen zu dürfen, dass ich
wohl den nötigen Mut besitze, um mich von der Ueber-
lieferung frei zu machen; ich halte jedoch bei den
Hilfsmitteln, die uns zu Gebote stehen, die Erfüllung
von Kauffmanns Forderung für ganz undurchführbar.
Wenn an einzelnen Stellen des Heliand meine Vers-
zählung nicht „stimmt" (Kauffmann, Beitr. XII, 290), so
bin ich dabei mit vollem Bewusstsein verfahren, weil
ich an Sievers' Zählung festhalten wollte. ')
Das gleiche Verfahren habe ich auch bei der Genesis
eingeschlagen, doch habe ich ausser den Zähinngen
Wülkers und Braunes auch eine Durchzählung der Verse
eingeführt.
Von der angelsächsischen Genesis stand mir eine neue
Vergleichung zur Verfügung, die Herr Professor Dr. Horn
in liebenswürdigster Weise für mich hergestellt hat.
Die Verbesserungsvorschläge der Gelehrten habe ich
beim Heliand und der altsächsischen Genesis vollständig
mitzuteilen gestrebt, bei der angelsächsischen Genesis
mit einer gewissen Auswahl: ich konnte mich nicht
entschliessen, alle die Wunderlichkeiten von Greverus
aufzunehmen, um so weniger, als ich ihnen dann auch
*) Es wäre dringend wünschenswert, dass man bei neuen
Ausgaben, nicht nur auf unserem, sondern auch auf anderen
Gebieten, allgemein so verführe, die Zählungen der älteren
Ausgaben beibehielte, soweit das irgendwie durchführbar ist.
Nichts ist verdriesslicher, als wenn beim Aufsuchen von Zitaten
alle Augenblicke Umrechnungen stattfinden müssen.
νπ
im Wörterbnch hätte Raum gestatten milssen, was bis-
weilen ganz unmögliche Ansätze ergeben hätte.Eine
Neuerung gegenüber der ersten Auflage ist es, wenn
ich — einer Anregung Braunes entsprechend — m den
Lesarten auch Verweise auf die einschlägige Literatur
gebe. Da diese Anregung erst während des Druckes
an mich kam, enthalten die Varianten zum Heliand nur
die nötigsten Berufungen auf kritische Ausführungen;
eine besondere Uebersicht S. XXIV ff. bringt Nachträge
und Hinweise auf die Erörterungen, die einzelnen Stellen
des Heliand gelten, ohne Aenderungen vorzunehmen.
Auch im Wörterbuch habe ich Verweise auf die
Literatur angebracht; doch sind sie hier mehr gelegent-
lich, nach einer bisweilen durch den Zufall bestimmten
Auswahl eingefügt, während ich bei den Verweisen zum
Text Vollständigkeit angestrebt habe.
Die Varianten stehen am Fuss der Seiten, und im
Text ist durch Kursivdruck der variierten Worte auf
sie verwiesen; das sieht zwar nicht gut aus, scheint
mir aber empfehlenswert zu sein.
Am Kopf der Seiten gebe ich beim Heliand Ver-
weisungen auf Tatian und Otfried, bei der Genesis auf
die Vulgata, um durch die Vergleichung das Verständnis
des Textes und die Erkenntnis der verschiedenen
dichterischen Eigenart zu fördern.
Lebhaften Dank schulde ich W. Horn, der die
Freundlichkeit gehabt hat, die Druckbogen des angel-
sächsischen Textes und des. Wörterbuchs einer Durchsicht
') Zur Ergötzlichkeit stehe hier Greverus' Bemerkuug
zu v. 342: „morther-inne, Mörderhöhle oder Verbrecherhöhle =
Hölle. Inne ist im Englischen von dem Hause (eigentlich
Inneren des Hauses) auf ein Gasthaus reduziert worden."
Vili
zu unterziehen, und F. Holthausen, der mir liebens-
würdigerweise seine Handexemplare des Heliand und
der Genesis zur Verfügung gestellt hat; auf diese Quelle
beziehe ich mich, wenn ich in den Varianten von privater
Mitteilung Holthausens rede.
Gieseen, den 14. Dezember 1902.
Vorwort zur dritten Auflage.
Ich habe die neueren Forschungen über Heliand
und Genesis nach Kräften für die neue Ausgabe ver-
wertet. Die zu einzelnen Stellen des Textes gehörenden
Verweise sind nun überall in den Anmerkungen unter-
gebracht.
E. A. Kock hat an meiner Interpunktion Anstoss
genommen. Er denkt dabei offenbar an Fälle wie
Hei. 3733: tho he an thene will innen, | geng an that
godes hus, under würde wohl vorziehen, so zu schreiben:
tho he cm thene wih innen geng, an that godes hus,
wie das frühere Herausgeber getan haben, ich hätte
gedacht, dass der Grund meines Verfahrens deutlich auf
der Hand liege. Das ältere Verfahren würde an zahl-
reichen Stellen ein doppeltes Enjambement ergeben,
eine Zerreissung der syntaktischen Einheit durch das
Versende und eine Zerreisung des folgenden Halbverses
durch die syntaktische Pause. Ich erwarte den Beweis
dafür, dass das dem Stil und der Rhythmik des Heliand
IX
angemessen wäre. Meinerseits verweise ich auf einen
Fall wie 4114: so mag hébenkuninges, thiu mikile
mäht godes. Hier setzen Rückert und Piper überhaupt
kein Zeichen, nehmen also an, dass thiu mikile maht
απ ο κοινού stehe; aber hedenkuninges thiu mikile maht
ist syntaktisch unmöglich.
Auch diesmal war W. Horn so freundlich, die
Druckbogen des angelsächsischen Textes und des
Wörterbuchs durchzusehen, und F. Holthausen hat die
Liebenswürdigkeit gehabt, mich auf Druckversehen auf-
merksam zu machen und eine Anzahl von Besserungen
vorzuschlagen. Leider konnten seine Hinweise zum
Teil erst in den Nachträgen berücksichtigt werden.
Giessen, den 11. Februar 1910.
Vorwort zur vierten Auflage.
Ich kann hier nur den ersten Satz des Vorworts
der dritten Auflage wiederholen. Wieder hat W. Horn
in freundlicher Weise seines Amtes gewaltet. W. Braune,
F. Holthausen, F. Kluge, F. Klaeber, R. Meissner,
E. Schröder, E. Sie vers haben die neue Auflage durch
mancherlei Hinweise, insbesondere auf Druckversehen,
gefördert. Ihnen allen sei herzlicher Dank gesagt.
Ε. A. Kock will meine Erklärung, dass hedenkuninges
thiu mikile maht syntaktisch unmöglich sei (s. oben)
durch den Hinweis auf angelsächsische Beispiele wider-
χ
legen (Jubilee Jaunts and Jottings 46.) Demgegenüber
darf ich vielleicht ganz schüchtern bemerken, dass der
fieliand altsächsisch, nicht angelsächsisch geschrieben
ist. Als eine weitere Stütze meiner Auffassung nenne
ich Hei. 3465, wo die Tilgung des Kommas nach dem
ersten Halbvers ein dem Heliand fremdes eforò χοινοϋ
ergäbe, ferner 302, 595, 1799, 3465.
Anm. Zufällig kommt mir bei der Korrektur ein
moderneres Beispiel meiner Interpunktion unter die Hände:
Herrn. Kurz, Lisardo 108 dass er die edle Gestalt, ihre demütige
Herrschaft ausübend, in tiefen Trauerkleidern die vielfach
Verwaiste an sich vorübergehen sah.
Glessen, den 19. August 1919.
0. Behaghel.