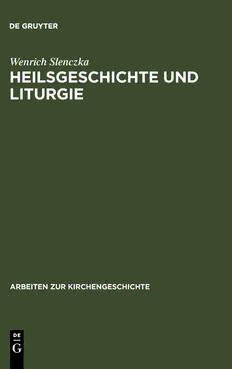Table Of ContentWenrich Slenczka
Heilsgeschichte und Liturgie
w
DE
G
Arbeiten zur Kirchengeschichte
Begründet von
Karl Hollf und Hans Lietzmannf
Herausgegeben von
Christoph Markschies, Joachim Mehlhausen f
und Gerhard Müller
Band 78
Walter de Gruyter · Berlin · New York
2000
Wenrich Slenczka
Heilsgeschichte und Liturgie
Studien zum Verhältnis von Heilsgeschichte und Heilsteilhabe
anhand liturgischer und katechetischer Quellen
des dritten und vierten Jahrhunderts
Walter de Gruyter · Berlin · New York
2000
® Gedruckt auf säurefreiem Papier, das die
US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.
Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme
Slenczka, Wenrich:
Heilsgeschichte und Liturgie : Studien zum Verhältnis von Heilsge-
schichte und Heilsteilhabe anhand liturgischer und katechetischer
Quellen des dritten und vierten Jahrhunderts / Wenrich Slenczka. —
Berlin ; New York : de Gruyter, 2000
(Arbeiten zur Kirchengeschichte ; Bd. 78)
Zugl.: München, Univ., Diss., 1996
ISBN 3-11-016494-9
© Copyright 2000 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, D-10785 Berlin
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover-
filmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Druck: Werner Hildebrand, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer-GmbH, Berlin
Einbandgestaltung: Christoph Schneider, Berlin
Vorwort
Die Liturgie ist seit längeren Jahren ein wichtiges Thema innerhalb
der evangelischen Kirchen, aber auch in der Ökumene geworden.
Neue Gottesdienstformen werden landauf landab praktiziert und
ökumenische Gottesdienste kreiert. Teils greift man begeistert alte
Liturgien auf, weil man sie für ökumenisch hält, teils lehnt man
alles, was alt ist, ab, weil man es heute für unverstehbar hält. Was
aber nach wie vor vernachlässigt wird, ist die ernsthaft theologische
Erforschung der Liturgie der Väter. Die Liturgik, zumal die histori-
sche Arbeit daran, ist ein Stiefkind der Theologie.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Gottesdienst in
patristischer Zeit. Die Quellen gehören in eine Epoche, in der die
heute relevanten kirchlichen Spaltungen noch nicht bestanden - dafür
aber andere Trennungen, die Gemeinden und ihre Leiter Umtrieben.
Einige liturgische Stücke, die wir heute noch verwenden, waren
bereits damals wörtlich in Gebrauch (z.B. der Einleitungsdialog zum
Präfationsgebet, die Kyrie-Rufe u.v.m.). Doch die Liturgie war sei-
nerzeit noch relativ neu. Dennoch kam man ohne einführende
Katechesen nicht aus. Die Katecheten hatten keine leichte Aufgabe
und haben sie sehr ernst genommen. In mancher Hinsicht können sie
uns heute ein Beispiel sein, wieviel Lehre man einer Gemeinde zumu-
ten muß, damit diese ihre Verantwortung in der Kirche wahrnehmen
kann. Sie können uns ebenso helfen, die Wahrheit der Liturgie mit
den „Augen des Glaubens" anzusehen.
Die vorliegenden Studien können nur einen Einblick in liturgische
und katechetische Quellen des dritten und vierten Jahrhunderts ge-
ben. Obwohl nur wenige Texte erhalten sind, sind sehr viel mehr
Untersuchungen nötig, um das Geheimnis des Gottesdienstes in alt-
kirchlicher Zeit zu begreifen. Freilich ist auch in früheren Jahren
einiges an Arbeit geleistet worden, doch angesichts der Bedeutung
des Gottesdienstes für die Kirche damals (und natürlich auch heute),
sind die Forschungen noch gering.
Die vorliegende Arbeit wurde als Dissertation von der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
München angenommen. Ich möchte mich bei Herrn Professor D.
VI Vorwort
Georg Kretschmar, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Rußland, der Ukraine, Kasachstan und Mittelasien (ELKRAS), be-
danken, der diese Arbeit betreut hat, obwohl es nicht leicht war,
über die weite Distanz zwischen München und Rußland den Kontakt
zu halten. Dennoch hat er mir mit wertvollem Rat weitergeholfen.
Dem Zweitgutachter sei ebenfalls gedankt. Mein Dank gilt auch
meinem Mentor im Vikariat, Herrn Pfarrer Tilmann Haberer, der
mir die nötige Zeit eingeräumt hat, damit ich die Dissertation neben
der Gemeindearbeit in St.Lukas (München) noch abschließen konn-
te. Dadurch war ich in der Lage, wieder nach Rußland zu gehen, um
dort in der ELKRAS Dienst zu tun. Es gäbe noch viele namentlich
zu erwähnen, die mich an der Universität und im Collegium
Oecumenicum in München, bei einem einjährigen Studienaufenthalt
an der Geistlichen Akademie der Russischen Orthodoxen Kirche in
St.Petersburg, in der St.Lukasgemeinde in München, sowie aus meiner
Familie während der Arbeit an der Dissertation begleitet haben.
Hervorheben möchte ich meine Frau, cand. theol. Luise Slenczka,
die wichtige Hilfe zur Fertigstellung des Manuskripts geleistet hat.
Den Herausgebern danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die
Reihe „Arbeiten zur Kirchengeschichte". Für den Druck wurden nur
kleine Korrekturen und Literaturergänzungen vorgenommen. Für
einige Hinweise danke ich Herrn Professor Dr. Ch. Markschies.
Außerdem wurden zur Erleichterung für den Leser die Quellenzitate
ins Deutsche übertragen und die Originalzitate in den Anmerkungen
aufgeführt. Die Übersetzungen, die ungeachtet des Stils möglichst
wörtlich gehalten wurden, stammen, wenn nichts anderes angegeben
ist, vom Verfasser der Arbeit. Besonderen Dank schulde ich meiner
Landeskirche, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für
einen namhaften Beitrag zu den Druckkosten.
Manching, WS
Inhalt
0. Einleitung 1
1. Die Traditio Apostolica des Hippolyt von Rom 17
1.1. Die Taufe in der Traditio Apostolica 18
1.2. Beobachtungen zum dritten Teil der TA 26
1.3. Das Hochgebet in TA 4 29
2. Das Euchologion des Ps.-Serapion von Thmuis 34
2.1. Exkurs: Ein Versuch über Theologie, Ort und Datum
des Euchologions 35
2.1.1. Der Aufbau des Euchologions 35
2.1.2. Der theologische Ort des Euchologions 39
2.1.2.1. Theologia 41
2.1.2.2. Oeconomia 45
2.1.3. Das Anaphoragebet im Euchologion 49
2.1.4. Ort, Zeit und Verfasser des Euchologions 53
2.2. Herrenmahl und Heilsgeschichte im Euchologion . . 55
2.2.1. Κοινωνία τοϋ σώματος και τοϋ αίματος 56
2.2.2. Τό ομοίωμα τοϋ θανάτου 58
2.3. Die Taufe im Euchologion 62
2.4. Die Salbungen 65
2.5. Die Ordinationen 70
2.6. Zusammenfassung 73
3. Die präbaptismalen Katechesen des
Kyrill von Jerusalem 75
3.1. Die Typologien ohne Bezug auf die Taufe 76
3.2. Taufe und Heilsgeschichte 80
3.2.1. Rekonstruktion der Taufliturgie Kyrills 81
3.2.2. Die alttestamentlichen Typoi des Taufwassers 86
3.2.3. Johannes der Täufer 89
VIII Inhalt
3.2.4. Jesus Christus 90
3.2.4.1. Die Taufe Jesu 90
3.2.4.2. Römer 6 93
3.2.4.3. Das Kreuz Christi 95
3.2.4.4. Zusammenfassung 96
3.3. Der Himmel auf Erden oder die Erde im Himmel . . 96
4. Die Jerusalemer Mystagogischen Katechesen 99
4.1. Die alttestamentlichen Typologien 99
4.2. Die bildlichen Symbole 104
4.3. Mimesis und Teilhabe am Heil 107
4.3.1. Mimesis in der Profangräzität und im NT 108
4.3.2. Mimesis Christi in den Mystagogischen Katechesen 110
4.3.3. Römer 6 118
4.4. Die Taufe Jesu 120
4.5. Die Eucharistiefeier 124
4.5.1. Die Liturgie des Herrenmahls 125
4.5.2. Der Empfang des Leibes und Blutes Christi 130
4.5.2.1. Brot und Wein als Typoi des Leibes und
Blutes Christi 130
4.5.2.2. Das geistliche Verständnis von Leib und Blut Christi 135
4.5.2.3. Epiklese und verba Christi 140
4.6. Ergebnis 142
5. Die beiden katechetischen Schriften des Ambrosius von
Mailand 144
5.1. Der Einfluss neuplatonischen Denkens in de sacr.
und de myst 145
5.1.1. Die Augen des Herzens und der neuplatonische
Aufstieg der Seele 145
5.1.2. corporalia et spiritalia und die neuplatonische Zwei-
Welten-Theorie 153
5.2. Die Auswirkungen der neuplatonischen Denkweise
auf die Deutung der Sakramente bei Ambrosius ... 157
5.2.1. Die Taufe 157
5.2.2. Das Altarsakrament 164
5.2.3. similitudo 166
5.2.4. Ergänzende Beobachtungen zum Einfluß des Neu-
platonismus auf de sacr. und de myst 169
Inhalt IX
5.2.5. Neuplatonismus und biblische Grundlage
bei Ambrosius 171
5.3. Das Hochgebet des Ambrosius im Kontext
altkirchlicher Hochgebete 173
5.4Γ Die Präfiguration von Taufe und Abendmahl in
geschichtlichen Ereignissen des AT und NT 182
5.4.1. Tauftypologien 182
5.4.2. Eucharistische Typologien 186
5.5. Die Bedeutung des irdischen Jesus für Taufe
und Gottesdienst 189
5.6. Ergebnis 195
5.7. Exkurs: Augustin - ein Ausblick 196
5.7.1. Alttestamentliche Typologien 197
5.7.2. Liturgische Typologien 202
5.7.2.1. sacramentum und memoria-die gottesdienstliche Zeit 202
5.7.2.2. similitudines 203
6. Die Katechesen des Johannes Chrysostomus 209
6.1. Die Bildersprache bei Johannes Chrysostomus 211
6.1.1. Die geistliche Hochzeit 212
6.1.2. Der geistliche Kampf, Gefangenschaft und Vertrag . 215
6.2. Die Begegnung mit Christus 218
6.3. Heilsgeschichte und Sakramente 224
6.3.1. Das himmlische Heiligtum 224
6.3.2. Der Exodus 226
6.3.3. Der Ursprung der Sakramente 230
6.3.4. Typos und Aletheia 233
6.3.5. Römer 6 und die Namen der Taufe 237
6.3.5.1. Die Namen der Taufe 237
6.3.5.2. Römer 6 und die Liturgie der Taufe 243
6.3.6. Römer 6 und das neue Leben der Getauften 249
6.4. Mimesis 250
6.5. Geist und Leib 253
6.6. Exkurs: Theodor von Mopsuestia - ein Ausblick . . 255
6.6.1. Das Gedächtnis Christi 257
6.6.2. Das Unterpfand des Geistes 265
Ergebnis 272