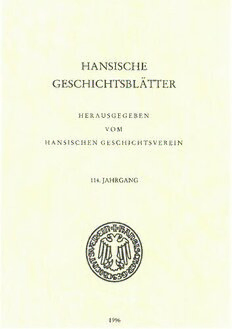Table Of ContentHANSISCHE
GESCHICHTSBLÄTTER
H E R A U S G E G E B E N
VOM
H A N S I S C H E N G E S C H I C H T S V E R E I N
114. JAHRGANG
1996
Zuschriften, die den Aufsatzteil betreffen, sind zu richten an Herrn Dr. Rolf
Hammel-Kiesow, Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostsee
raums, Burgkloster, Hinter der Burg 2-4, 23539 Lübeck; Besprechungsexemplare
und sonstige Zuschriften wegen der Hansischen Umschau an Herrn Dr. Volker
H enn, Universität Trier, Fachbereich III, Postfach 3825, 54286 Trier.
Manuskripte werden in Maschinenschrift (und ggf. auf Diskette) erbeten. Korrek
turänderungen, die einen Neusatz von mehr als einem Zehntel des Beitragsumfanges
verursachen, werden dem Verfasser berechnet. Die Verfasser erhalten von Aufsätzen
und Miszellen 20, von Beiträgen zur Hansischen Umschau 2 Sonderdrucke unent
geltlich, weitere gegen Erstattung der Unkosten.
Die Lieferung der Hansischen Geschichtsblätter erfolgt auf Gefahr der Empfänger.
Kostenlose Nachlieferung in Verlust geratener Sendungen erfolgt nicht.
Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Eintritt in den Hansischen Geschichtsverein ist jederzeit möglich. Der Jahresbeitrag
beläuft sich z. Zt. auf DM 40 (für in der Ausbildung Begriffene auf DM 20). Er
berechtigt zum kostenlosen Bezug der Hansischen Geschichtsblätter. - Weitere
Informationen gibt die Geschäftsstelle im Archiv der Hansestadt Lübeck, Mühlcn-
damm 1-3, 23552 Lübeck.
HANSISCHE
GESCHICHTSBLÄTTER
H E R A U S G E G E B E N
V O M
H A N S I S C H E N G E S C H I C H T S V E R E I N
114. JAHRGANG
1996
BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN
REDAKTION
Aufsatzteil: Dr. Rolf Hammel-Kiesow, Lübeck
Umschau: Dr. Volker Herrn, Trier
Für besondere Zuwendungen und erhöhte Jahresbeiträge, ohne die dieser Band nicht
hätte erscheinen können, hat der Hansische Geschichtsverein folgenden Stiftungen,
Verbänden und Städten zu danken:
POSSEH L-S'HFTUNG ZU LÜBECK
Freie und H ansestadt H amburg
Freie H ansestadt Bremen
H ansestadt Lübeck
Stadt K öln
Stadt Braunschweig
Landschaftsverband W f.stfalen-Lippe
L andschaftsverband R heinland
ISSN 0073-0327
Inhalt
Redaktionelles Vorwort....................................................................... 1
Aufsätze
Stuart Jenks
Zum hansischen Gästerecht............................................................... 3
Karl-Ludwig Wetzig
Jön Gerrekssons Ende oder Wie Island beinahe englisch gewor
den wäre.................................................................................................. 61
Rainer Postei
Grundlegungen und Anstösse für die Hanseforschung-Johann
Martin Lappenberg und Kurd von Schlözer.................................. 105
Joachim Deeters
Hanseforschung in Köln von Höhlbaum bis Winterfeld 123
Ernst Pitz
Dietrich Schäfer als Hanseforscher ................................................. 141
Bericht
Hansekaufleute in Brügge. Kolloquium in Brügge, Tagungszen
trum Oud Sint Jan, 25. - 28. April 1996.
von Detlef Kattinger............................................................................ 167
Hansische Umschau
In Verbindung mit Norbert Angermann, Roman Czaja, Detlev Ellmers,
Antjekathrin Graßmann, Elisabeth Harder-Gersdorff, Thomas Hill,
Stuart Jenks, Petrus H.J. van der Laan, Herbert Schwarzwälder, Hugo
Weczerka und anderen, bearbeitet von Volker Henn
Allgemeines............................................................................................. 173
Schiffahrt und Schiffbau ..................................................................... 190
Vorhansische Zeit ................................................................................. 210
Zur Geschichte der niederdeutschen Landschaften und der
benachbarten Regionen....................................................................... 211
Westeuropa............................................................................................. 262
Skandinavien........................................................................................... 282
Osteuropa................................................................................................ 290
IV
Für die Hanseforschung wichtige Zeitschriften........................... 337
Hansischer Geschichtsverein
Jahresbericht 1995 ................................................................................. 341
Liste der Vorstandsmitglieder ........................................................... 345
R E D A K T I O N E L L E S V O R W O R T
Die 111. Jahresversammlung des Hansischen Geschichtsvereins in Lipp-
stadt (5. - 8. Juni 1995) stand unter dem Thema „Entwicklung der Han
seforschung von Sartorius bis Rörig“. Von den dort gehaltenen Vorträgen
(siehe dazu den Geschäftsbericht am Ende des vorliegenden Bandes) wer
den im vorliegenden Band die Ausführungen von Rainer Postei, Joachim
Deeters und Ernst Pitz in zum Druck überarbeiteter Form veröffentlicht.
Der Vortrag von Joist Grolle, Von der Verfügbarkeit des Historikers -
Heinrich Reineke und die Hanse-Geschichtsschreibung in der NS-Zeit ist,
leicht modifiziert, unter dem Titel Von der Verfügbarkeit des Historikers -
Heinrich Reineke und die Hamburg-Geschichtsschreibung in der NS-Zeit
veröffentlicht worden in: Bajohr, Frank; Szodrzynski, Joachim (Hgg.),
Hamburg in der NS-Zeit, Ergebnisse neuerer Forschungen, Hamburg
1995, S. 25-57. Er kommt daher - auch auf Wunsch des Autors - in den
Hansischen Geschichtsblättern nicht zum Druck.
Da die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland
auch Rückwirkungen auf die Mittel haben, die der Geschichtswissenschaft
zur Verfügung stehen, kann der Hansische Geschichtsverein nicht alle
Vorträge der Jahresversammlung zum Druck bringen, nicht zuletzt weil die
Hansischen Geschichtsblätter auch ein Forum der hansischen Geschichts
forschung außerhalb der in den Jahresversammlungen dargebotenen The
men bleiben sollen. Damit ist die Beschäftigung mit der Geschichte der
hansischen Geschichtsschreibung innerhalb unseres Periodikums auf der
Grundlage der 111. Jahresversammlung jedoch nicht abgeschlossen. Einige
der in Lippstadt Vortragenden haben die Absicht geäußert, die von ihnen
behandelten Themen noch zu vertiefen und in einem der kommenden
Bände zum Druck zu bringen.
Rolf Hammel-Kiesow
Z U M H A N S I S C H E N G Ä S T E R E C H T
von Stuart Jenks
Vor einigen Jahren hat Rolf Sprandel1 das „innere Präferenzsystem“ als
eine der drei tragenden Säulen der wirtschaftlichen Stärke der hansischen
Fernhändler gegenüber der ausländischen Konkurrenz identifiziert. Zu
den Instrumenten dieser innerhansischen Präferenz gehörte seiner Ansicht
nach das Gästerecht, das sich in zahlreichen Geboten und Verboten der
Hansetage des 15. Jahrhunderts niederschlug. Allerdings erweist sich die
Bevorzugung der Mithansen bei näherer Betrachtung als begrenzt: Das
Brügger Kontor konnte z.B. im Jahre 1425 seinen Wunsch, englische und
holländische Lieger in den Hansestädten nicht zu dulden, beim Hansetag
nicht durchsetzen, und 1442 beklagte sich Lübeck, daß seine Kaufleute in
Reval im Vergleich zu den russischen Gästen benachteiligt würden. Die
mangelnde Konsequenz bei der innerhansischen Präferenz sei nach Spran
del darauf zurückzuführen, daß jede Hansestadt in „eine mehr hansische
und eine mehr regional interessierte Bürgerschaft“ gespalten und der von
der Hanse abgewandte Teil in zunehmendem Maße willens und fähig war,
seine regionalen Interessen zu vertreten. Einzelne Berufsgruppen innerhalb
einer Hansestadt haben diesen und jenen Rezeß erfolgreich bekämpft, so
beispielsweise die Danziger Schiffbauer das 1412 beschlossene hansische
Verbot des Schiffbaus für Fremde. Das - so Sprandel weiter - „antihansi
sche Stapelrecht“ war im späten 14. und im 15. Jahrhundert überall im
hansischen Raum im Vormarsch, und nicht nur die Butenhansen litten
darunter. Die einzelnen Hansestädte ergriffen Maßnahmen, um den Vorteil
ihrer Bürger zu wahren, auch auf Kosten der hansischen Beziehungen. Das
im 15. Jahrhundert unter Beschuß geratene, „innerhansische Präferenzsy
stem“ konnte allerdings gerettet werden: Man handelte einfach mit dem
Gut eines Auswärtigen und auf dessen Rechnung, aber im eigenen Namen.
Nach außen hin hatte es also den Anschein, als ob der Hansekaufmann
stets mit Propergut handelte, obwohl er in Wirklichkeit das Eigentum
anderer veräußerte. Daß die Hansetage wiederholt Handelsgesellschaften
mit Butenhansen verboten, verstärkte die innerhansische Präferenz.
1 Rolf SPRANDEL, Die Konkurrenzfähigkeit der Hanse im Spätmittelalter, in: HGbll.
102, 1984, S. 21-38, hier 26-33. Zusätzliche Abkürzungen: ASP = Max ToEPPEN (Hg.),
Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens (Acten der
Ständetage Ost- und Westprcussens 1-5), 5 Bde, Leipzig 1874-86.
4 Stuart Jenks
Man gewinnt den Eindruck, daß Sprandel das hansische Gästerecht
zwar als einen signifikanten Faktor des hansischen Erfolgs betrachtet, die
auswärtigen Privilegien und das kartellartige Verhalten der Hanse aber
weitaus höher einstuft.
Der Literaturbefund ist ansonsten enttäuschend. Seit Anfang unse
res Jahrhunderts werden rechtsgeschichtliche Untersuchungen des Gäste-
rcchts2 vorgelegt, die jedoch die germanische Vorzeit (bis hin zu den
Karolingern) in den Vordergrund stellen. Weil der Gast ursprünglich völlig
rechtlos war - es sei denn, er begab sich in den Munt eines Einheimi
schen und gelangte dadurch in den Schutz des germanischen Gastrechts-,
betrachten die Rechtshistoriker alle gastrechtlichen Bestimmungen als ei
ne kontinuierliche Verbesserung des ursprünglich rechtlosen Status der
Fremdlinge. Nur Schultze3 geht auf die rechtlichen Beschränkungen ein,
die die mittelalterliche Stadt den Auswärtigen in Handel und Gewerbe auf
erlegte, und konstatiert einen Bruch zwischen dem germanischen Fremd
lingsrecht und dem städtischen Gastrecht des Hoch- und Spätmittelalters4.
Ansonsten befassen sich die Untersuchungen in erster Linie mit den recht
lichen Beschränkungen, denen die Auswärtigen in den Bereichen des Straf-
und Verfahrensrechts (verminderte Zeugnis- und Zweikampffähigkeit, Ar
restrecht, Gastgerichte) sowie des Schulden- und Privatrechts (verminderte
Erb- und Grundeigentumserwerbsfähigkeit) unterworfen waren. So fehlt
diesen Untersuchungen ein spezifisch hansischer Zugriff. Die Handbücher
zur deutschen Rechtsgeschichte schließlich spiegeln die Schwerpunktset
zung der rechtshistorischen Untersuchungen lediglich wider und bringen
somit für unsere Thematik nichts5.
1 Hermann Rudorff, Zur Rechtsstellung der Gäste im mittelalterlichen städtischen
Prozess vorzugsweise nach norddeutschen Quellen (Untersuchungen zur deutschen
Staats- und Rechtsgeschichte 88), Breslau 1907; Hans Planitz, Studien zur Geschichte
des deutschen Arrestprozesses. Der Fremdenarrest, in: ZRG GA 39, 1918, S. 223-308,
40, 1919, S. 87-198; DERS., Über hansisches Handels- und Verkehrsrecht, in: HGbll. 51,
1926, S. 1-27, bes. S. 21-4; Hans Thieme, Die Rechtsstellung der Fremden in Deutschland
vom 11. bis zum 18. Jahrhundert, in: L’etranger. Foreigner (Recueils de la Societe Jean
Bodin pour l’histoire comparative des institutions 10), 2. Teil, Paris 1984, S. 201-16; DERS.,
Art. Fremdenrecht, in: HRG Bd. I (1971), Sp. 1270-2.
3 Alfred SCHULTZE, Über Gästerecht und Gastgerichte in den deutschen Städten des
Mittelalters, in: HZ 101, 1908, S. 473-528. Allerdings geht Schultze nur kurz auf die
Einschränkungen der Beteiligung des Gastes in Handel und Gewerbe ein (S. 498-503)
und leitet sofort zur Entstehung der Gastgerichte über.
4 Alfred SCHULTZE, Rez. von Otto STOLZ, Die tirolischen Geleits- und Rechtshilfever
träge (1909), in: VSWG 9, 1911, S. 229-37, hier S. 235.
5 Andreas Heuslf.r, Institutionen des Deutschen Privatrechts (Systematisches Hand
buch der Deutschen Rechtswissenschaft, 2. Abt., 2. Teil, Bd. 1), Leipzig 1885, S. 144-7;
Otto von GlERKE, Deutsches Privatrecht, Bd. 1: Allgemeiner Teil und Personenrecht
(Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft, 2. Abt., 3. Teil, Bd. 1),
Leipzig 1895, S. 443-9; Heinrich BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte (Systematisches
Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft, 2. Abt., 1. Teil, Bd. 1), Bd. 1, Berlin 21906,