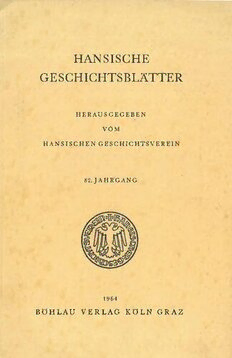Table Of ContentHANSISCHE
GESCHICHTSBLÄTTER
H E R A U S G E G E B E N
V O M
H A N S I S C H E N G E S C H I C H T S V E R E I N
8 2 . J A H R G A N G
1964
BOHLAU VERLAG KÖLN GRAZ
HANSISCHE
GESCHICHTSBLÄTTER
H E R A U S G E G E B E N
V O M
H A N S I S C H E N G E S C H I C H T S V E R E I N
82. J A H R G A N G
1964
B Ö H L A U V E R L A G K Ö L N G R A Z
S C H R I F T L E I T U N G
Aufsatzteil: Universitätsprofessor Dr. Paul Johansen, Hamburg.
Besprechungen und Umschau: Staatsarchivdirektor Dr. Carl Haase, Hannover.
Sekretariat: Dr. Hugo Weczerka, Hamburg.
Zuschriften, die den Aufsatzteil betreffen, sind zu richten an Herrn Professor
Dr. Paul Johansen, Historisches Seminar der Universität, 2 Hamburg 13, Von-
Melle-Park 6/IX; Besprechungsexemplare an das Sekretariat der Hansischen
Geschichtsblätter, ebendort; sonstige Zuschriften wegen der Hansischen Umschau
ab Band 83 an Herrn Dr. Hans Pohl, Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
der Universität, 5 Köln-Lindenthal, Albertus-Magnus-Platz.
Manuskripte werden in Maschinenschrift erbeten. Korrekturänderungen, die mehr
als zwei Stunden Zeitaufwand für den Bogen erfordern, werden dem Verfasser
berechnet. Die Verfasser erhalten von Aufsätzen und Miszellen 20, von Beiträgen
zur Hansischen Umschau 5 Sonderdrucke unentgeltlich, weitere gegen Erstattung
der Unkosten.
Die Lieferung der Hansischen Geschichtsblätter erfolgt auf Gefahr der Emp
fänger. Kostenlose Nachlieferung in Verlust geratener Sendungen erfolgt nicht.
Bezugsnachweis für die vom Hansischen Geschichtsverein früher herausgegebenen
Veröffentlichungen im Jahrgang 76, 1958, S. 236—240. Die seit langem ver
griffenen Bände 1—70 werden auf fotomechanischem Wege nachgedruckt. Ende
1966 wird der Nachdruck aller Bände abgeschlossen sein. Der endgültige Laden
preis liegt noch nicht fest; Mitglieder des Hansischen Geschichtsvereins erhalten
einen Nachlaß von 10%>. Bestellung an den Böhlau-Verlag, Köln, erbeten.
Die Veröffentlichung dieses Bandes im vorliegenden Umfang wurde durch eine
dankenswerte größere Beihilfe der Possehl-Stiftung zu Lübeck ermöglicht.
Druck der AschendorfTschen Buchdruckerei, Münster (Westf.)
IN H A LT
Aufsätze
Zur Historiographie der Hanse im Zeitalter der Aufklärung und der
Romantik. Von Karl H. Schwebel (Bremen)........................................................................1
Bürgerlicher Lehnsbesitz, bäuerliche Produktenrente und altmärkisch-
hamburgische Handelsbeziehungen im 14. Jahrhundert. Von Evamaria
Engel (B e r lin )...........................................................................................................................21
Elbschiffahrt und Elbzölle im 17. Jahrhundert. Von Karlheinz Blaschke
(D resd en )......................................................................................................................................42
Kopenhagen und die deutschen Ostseestädte 1750—1807. Von Aage Rasch
(K openhagen)..............................................................................................................................55
Miszellen
Bevölkerungszahlen der Hansestädte (insbesondere Danzigs) nach H.
Samsonowicz. Von Hugo Weczerka (Hamburg).............................................................69
Hansische Schiffs- und Bootsfunde an Weser und Elbe. Von Paul Hein-
sius (Freiburg/Br.)......................................................................................................................81
Hansische Umschau (nebst Besprechungsteil) 1963
In Verbindung mit Ahasver v. Brandt, Gert Hatz, Paul Heinsius, Ernst
Pitz, Friedrich Prüser, Herbert Schwarzwälder, Charlotte Warnke, Hugo
Weczerka und vielen anderen bearbeitet von Carl Haase
Allgemeines und Hansische Gesamtgeschichte...........................................................84
Vorhansische Z e i t ...................................................................................................................121
Zur Geschichte der einzelnen Hansestädte und der niederdeutschen Land
schaften ....................................................................................................................................130
Westeuropa ............................................................................................................................158
S k an din avien............................................................................................................................179
O steuropa....................................................................................................................................187
Hanseatische Wirtschafts- und Überseegeschichte................................................202
Autorenregister für die U m sch a u ..................................................................................209
M itarbeiterverzeichnis...........................................................................................................210
Für die Hanseforschung wichtige Zeitschriften (Abkürzungsverzeichnis) . 211
Nachrichten vom Hansischen Geschichtsverein 216
Z U R H I S T O R I O G R A P H I E DER H A N S E
IM Z E I T A L T E R D E R A U F K L Ä R U N G
U N D D E R R O M A N T I K - '
von
K A R L H. S C H W E B E L
„Um die Geschichte der Wissenschaften aufzuklären, um den Gang der
selben festzustellen, pflegt man sich sorgfältig nach ihren ersten Anfängen
zu erkundigen; man bemüht sich, zu forschen, wer zuerst irgend einem
Gegenstand seine Aufmerksamkeit zugewendet, wie er sich dabei be
nommen, wo und zu welcher Zeit man zuerst gewisse Erscheinungen in
Betracht gezogen, dergestalt daß von Gedanke zu Gedanken neue Ansich
ten sich hervorgetan“1.
In diesem Goethewort liegt eine der zahlreichen Auseinandersetzungen
des Dichters mit der Welt des Geschichtlichen vor, deren Tiefe und Am
bivalenz Friedrich Meinecke bewogen hat, ihm sein berühmtes zehntes
Kapitel in seinem Werke über „Die Entstehung des Historismus“ zu
widmen. Goethes Standort erhellt aus der hier vertretenen Auffassung
der menschlichen Kultur als eines entwicklungsgeschichtlichen Prozesses
des geistigen Fortschrittes und aus dem Wert, den er der historischen
Betrachtungsweise beimißt, einer „Erörterung, welche den mannichfachsten
Anlaß gibt, die menschlichen Geisteskräfte zu kennen und zu schätzen“ 2.
Bei der Formulierung des Themas ist bewußt von der geistesgeschicht
lichen Epochentrennung Aufklärung — Romantik ausgegangen, um klar
zu machen, daß unser Bemühen hier nur sein kann, die Hanseforschung
des 18. und des 19. Jahrhunderts an Hand ausgewählter Einzelbeispiele
in einen übergeordneten Sinnzusammenhang einzuordnen, nicht aber —
was technisch unmöglich und auch langweilig wäre — registrierend und
referierend so etwas wie einen neuzeitlichen Hanse-Wattenbach in nuce
aufzublättern. Es möge ferner Einverständnis darüber herrschen, daß
grundsätzlich nur die Gesamthanse betreffende Veröffentlichungen in
Auswahl, nicht aber — oder nur ausnahmsweise — Monographien zur Ge
schichte einzelner Städte zur Sprache kommen können, so charakteristische
Beispiele die letzteren auch für bestimmte Entwicklungsstufen der Hanse
historie liefern können.
* Vortrag, gehalten auf der Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins in
Herford am 5. Juni 1963, ergänzt durch Anmerkungen.
1 J. W. Goethe, Geschichte meines botanischen Studiums (1817, ergänzt 1831).
* Ebda.
1 HGbl. 82
2 Karl H. Schwebel
Mit dieser reservatio mentalis ist hoffentlich genügend Ballast ab
geworfen, um unsere Hanse-Kogge auf Kurs zu halten, d. h. die in unserer
Berichtszeit entstandenen speziellen Hanseforschungen unter entwick
lungsgeschichtlichem Aspekt in den größeren Zusammenhang der von den
Strömungen der Zeit ergriffenen allgemeinen Historie einzuordnen. Die
Breite des Themas zwingt im übrigen zum Verzicht auf ins Detail gehende
Inhaltsanalysen einzelner Werke. Das bewahrt glücklicherweise vor der
Versuchung, den Autoren wegen der ihnen zu verdankenden mehr oder
minder großen Fortschritte des Wissens um die hansische Vergangenheit
Zensuren zu geben.
Wenn man sich vergegenwärtigt, welchen Widerhall ein so allseitig
bedeutendes geschichtliches Phänomen wie die Hanse in der zeitgenös
sischen oder modernen Literatur gefunden hat, so kann die Dürftigkeit des
Ergebnisses im Verhältnis zum Gewicht des Gegenstandes nur über
raschen. Darauf hat bereits Karl Koppmann, soweit die mittelalterliche
historiographische Überlieferung in Frage steht, im ersten Band der
Hansischen Geschichtsblätter hingewiesen3. Er vergleicht das durch die
Anwesenheit gebildeter Kleriker der Historie günstige geistige Klima der
hansischen Bischofsstädte mit dem „trostlosen Schweigen“ etwa in Städten
von der Bedeutung Stralsunds und Rostocks. Wie wenig auch „Die Flanse
im deutschen dichterischen Schrifttum“ sich als Stoff niedergeschlagen hat,
zeigt der so betitelte Aufsatz von Merbach im Pfingstblatt von 19344.
Da sind ein paar Dichter, die sich bedeutende Gestalten aus der hansischen
Vergangenheit zum Vorwurf genommen haben, Emanuel Geibel und
Karl Gutzkow den Jürgen Wullenweber, ersterer auch Johann Wittenborg
in seiner Ballade. Störtebecker avanciert sogar zum Opernheld mit viel
Theaterdonner. Aber das ist künstlerisch wenig belangvoll, und man
könnte daraus schließen, daß in unserer Berichtszeit die Hanse im Be
wußtsein der Gebildeten wie des Volkes kaum noch lebendig war. Und
schließlich: hat nicht eine der drei nach dem Wiener Kongreß allein
selbständig gebliebenen Hansestädte, Hamburg, eine Zeitlang gezögert,
das staatsrechtlich obsolete Element des Hansischen erneut in ihren
Staatstitel aufzunehmen?5.
Wie steht es aber in unserer Epoche mit der eigentlich historiogra-
phischen Literatur als dem Ausdruck eines zeitgenössischen Geschichts
bewußtseins? Wenn man mit Nietzsche nach dem Nutzen und Nachteil
der Historie für das Leben fragt, so ist hier zunächst ein Blick auf die
3 Karl Koppmann, Zur Geschichtsschreibung der Hansestädte vom 13. bis zum
15. Jahrhundert, in: HGbll. 1 (1871), 55 ff.
4 Pfingstbll. des HGV, Blatt XXIV, 1934.
5 Vgl. Hans Kellinghusen, Der hamburgisdhe Staatstitel, in: ZVHG 41 (1951),
268 ff.
Zur Historiographie der Hanse 3
Lebenswirklichkeit der Hansestädte im 18. Jahrhundert angezeigt. Es
ergibt sich dabei der Unterschied zwischen zwei Kategorien von Kom
munen: Die einen haben schon vor langer Zeit ihre politische Selbständig
keit mit der Stellung von wirtschaftlich mehr oder minder bedeutenden
Landstädten in territorialen und dynastischen Herrschaftsbereichen ver
tauscht. Der Bürger steht hier als Untertan im absolutistisch-merkanti-
listischen Obrigkeitsstaat ad nutum Serenissimi. Für ihn ist das Hansische
zu einem leeren Kokon, zu dem Rudiment einer halb vergessenen histori
schen Entwicklungsphase geworden. Sein Lebensgefühl ist weniger ge
schichtsbedingt als von den Realitäten seines Daseins in einer höfisch
feudalen Gesellschaftsordnung bestimmt.
Hiervon macht die zweite Gruppe, die der drei Städte des sogenannten
engeren Bundes, Lübeck, Bremen und Hamburg, eine Ausnahme, indem
ihr eine merkwürdige Laune des Schicksals es vergönnte, ihre politische
Selbständigkeit zu bewahren. Für Lübeck als Reichsstadt war das leichter
als für die beiden anderen, die erst im 17. und 18. Jahrhundert ihre Eman
zipation vom Stadtherrn mit dem Erwerb der Reichsunmittelbarkeit
krönten.
Die mittelalterliche Hanse stellte durch ihre Ballung überregionaler
Wirtschaftskraft zugleich einen jener politischen Machtfaktoren dar, welche
die Struktur des feudalen Reiches zersetzten. Sie ließ sich daher nicht
reichsrechtlich institutionalisieren und in den ständischen Organismus
einbauen, vielmehr sollten die Könige nach dem Wunsche der Fürsten
daran sein, solche unerlaubten und unerwünschten Städtebünde ganz und
gar abzutun.
Mit dem reichsstädtischen Element dagegen verhält es sich ganz anders
als mit dem hansischen. Die staatsrechtliche Integrität der Reichsstädte
als eines zwar nicht sehr angesehenen, so doch anerkannten Reichsstandes
blieb bis zum Ende des alten Reiches prinzipiell unbestritten. Wenn auch
mancher fürstliche Hecht im städtischen Karpfenteich mit frecher Gewalt
einen fetten Bissen erschnappte: die Versteinerung der Reichsverfassung
ersetzte von Rechts wegen den Machtcharakter des Staates durch das
historische Legitimitätsprinzip. Rechtshändel vor den Reichsgerichten und
bella diplomatica traten an die Stelle des lebendigen Spiels der politi
schen Kräfte.
Die ungebrochene Kontinuität der Entwicklung des urbanen Lebens
mußte eine besonders enge Beziehung der Reichsstädte zu der Welt der
Geschichte herbeiführen, die wiederum in einer viel reichhaltigeren
historisch-publizistischen Literatur ihren Ausdruck gefunden hat. Sie hat
zweifellos vornehmlich apologetischen Charakter, ist zweckbestimmt und
-gebunden und in jeder Hinsicht vorwissenschaftlich. Aber diese von
Nietzsche so genannte antiquarische Historie entspringt Empfindungen
des bewahrenden und verehrenden Nachfahren, die der Philosoph als
l*
4 Karl H. Sdiwebel
„das Wohlgefühl des Baumes an seinen Wurzeln11 bezeichnet, „das
Glück, sich nicht ganz willkürlich und zufällig zu wissen, sondern aus
einer Vergangenheit als Erbe, Blüte und Frucht herauszuwachsen und
dadurch in seiner Existenz entschuldigt, ja gerechtfertigt zu werden“ 6.
Bei der ideellen Existenzbehauptung der drei letzten Hansestädte war
nun offensichtlich das reichsstädtische Element das wesentliche, das
hansische das beiläufige. Dies blieb so bis zum Zusammenbruch des Reichs
gefüges nach der Jahrhundertwende, der zugleich einen Bruch in der
historischen Kontinuität bedeutete. Bezeichnenderweise scheiterte 1806
auch der Versuch des Bremer Senators Johann Smidt, die hansische Tra
dition als Basis einer neuen überregionalen Verbindung zu benutzen7.
Wenn die Deutsche Bundesakte die hansischen Schwestern zusammen mit
Frankfurt nur als freie Städte führte, nahm sie staatsrechtlich von der
engeren hanseatischen Gemeinschaft keine Notiz. Völkerrechtlich haben
dagegen die drei Städte die Rechtsnachfolge der mittelalterlichen Hanse
weiterhin behauptet, wie aus ihrer Handelsvertragspolitik des 18. und
19. Jahrhunderts hervorgeht8. Trotz der auf Herkommen und Interessen
verwandtschaft beruhenden lockeren Zusammenarbeit der Stadtrepubliken
kann in unserer Berichtszeit nicht von „Hanse“ in dem damit gemeinten
umfassenden Wortsinne die Rede sein, und die Geschichte Lübecks, Bre
mens und Hamburgs und ihrer Beziehungen ist alles andere als Hanse
historie.
Die Jahrhundertwende bringt durch ihre staatsrechtlichen Umwälzungen
auch eine Wandlung im Wesen der Historiographie der mittelalterlichen
Gesamthanse. Ihre bisher unverkennbare publizistisch-politische Tendenz
auf Propagandawirkung zugunsten der Städte entfällt. Das Zeitalter der
Wissenschaftlichkeit beginnt auch für die Hansehistorie. Doch davon später
mehr9.
Auf der Suche nach gesamthansischen Geschichtswerken, welche für die
soeben charakterisierte erste Epoche unserer Berichtszeit als umfassende
Belege dienen können, beginnt bereits die Verlegenheit. Ein allseitig aus
wertbares Musterbeispiel ist nicht vorhanden, so daß wir die Komponenten
unserer definitiven Vorstellung aus Einzelquellen zusammenholen müssen.
Als weit entfernter Vorläufer kann hier nur am Rande Johannes An-
gelius Werdenhagen gestreift werden, dessen für den heutigen Leser
ungenießbarer „Tractatus Generalis de rebuspublicis Hanseaticis“ 1630
6 Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben.
Kröners Taschenausgabe, Bd. 37, o. J., 21.
7 Vgl. Kurt Detlev Möller, Zur Politik der Hansestädte im Jahre 1806, in: ZVHG
41 (1951), 330 ff.
8 Vgl. Jürgen Prüser, Die Handelsverträge der Hansestädte Lübeck, Bremen und
Hamburg mit überseeischen Staaten im 19. Jahrhundert (Veröff. a. d. Staats
archiv d. Fr. Hansestadt Bremen, Bd. 30), Bremen 1962.
9 Vgl. unten 11 ff.