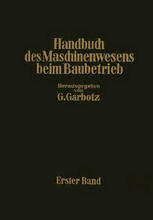Table Of ContentHandbuch
des Maschinenwesens
beim Baubetrieb
Herausgegeben von
Dr. Georg Garbotz
o. Professor an der Technischen Hochschule Berlin
Erster Band
I. Teil: Die Einrichtung und der Betrieb maschinell
arbeitender Baustellen von Oberingenieur
Dr.-Ing. 0 t to Wa I c h, Privatdozent an
der Technischen Hochschule Berlin
II. Teil: Die Verwaltung und lnstandhaltung der
Gerate und Baustoffe von Dr. G e 0 r g Gar bot z ,
o. Professor an der Technischen Hochschule Berlin
Mit 313 Textabbildungen
Berlin
Verlag von Julius Springer
1931
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1931
AIle Rechte, insbesondere das der "Obersetzung
in fremde Sprachen, vorbehalten.
Copyright 1931 by Julius Springer in Berlin.
ISBN-13: 978-3-642-89008-6 e-ISBN-978-3-642-90864-4
DOl: 10.1 007/978-3-642-90864-4
Vorwort.
Zwei Entwicklungsstufen fiihren zum fertigen Bauwerk: Die Planung oder
Konstruktion und der Herstellungsvorgang. Es kennzeichnet die betriebs
technischen Unterschiede zwischen Maschinen- und Bauindustrie, die durch die
Begriffe Massen- und Einzelherstellung oder ortsfester Fabrik- und unstandiger
Baubetrieb beleuchtet werden, daB die erstere schon um die Jahrhundertwende
beginnt, die Fragen des Herstellungsvorganges als gleichwertig und eng verbunden
mit denen der Konstruktion zu behandeln, wahrend die Bauindustrie erst in den
letzten Jahren in groBerem MaBe diesen Fragen Interesse entgegenzubringen
scheint. Die Forderung eines Bauunternehmers wie Soeser1 "wir mussen weniger
Konstruktionsingenieure, wir mussen mehr Betriebsingenieure aus
bilden" fiihrt daher dazu, daB der Bauingenieur sich mit den vielerlei Fragen
der Baubetriebslehre und unter diesen wieder mit denen seiner Werkzeug
maschinen, d. h. also der Maschinen, die beirn Herstellungsvorgang auf der
Baustelle in weitestem Sinne benotigt werden, ganz anders als bisher bescMf
tigen muB.
Charakteristisch hierfur ist, daB die Vereinigung der Bauingenieurabteilungen
aller Hochschulen Deutschlands bei ihrer letzten Tagung am 7. Marz 1931 in
Dresden beschlossen hat, in Zukunft neben den konstruktiven auch betriebs
technische Probleme in den Diplomaufgaben starker in den Vordergrund zu
schieben, eine Auffassung, die schon dadurch gerechtfertigt ist, daB 80 bis 90%
aller Bauingenieur-Studierenden spater beirn Unternehmer und nur der Rest
bei den Staatsbauverwaltungen Verwendung finden.
Die Schwierigkeit zur Verwirklichung dieses Zieles besteht nur darin, daB es
sich einmal um Dinge handelt, die, wie praktisches Gefiihl, Organisationstalent,
Fiihrereigenschaften, Menschenbehandlung usw. nich t er lern t werden konnen,
und daB geeignete Lehrkrafte, die auf der Baustelle groB geworden sind, an
den Hoch- und Fachschulen fehlen. Lediglich Berlin und teilweise Munchen
sowie Dresden bieten hierzu den Studierenden vorerst die Moglichkeit. Hinzu
kommt, daB es eine ahnlich umfassende Literatur wie auf konstruktivem Ge
biete (siehe auch den Literaturnachweis am Ende des Buches) nicht gibt, daB
vielmehr das Wissenswerte in einer beschrankten Zahl von Aufsatzen der in- und
auslandischen Fachpresse verstreut ist, und daB eine Forschungsarbeit auf diesem
Gebiete noch so gut wie gar nicht vorliegt.
Es handelt sich also bei der Baubetriebslehre und dem Sondergebiet des
Maschinenwesens beim Baubetrieb um noch vollig unbeackertes Neuland. Den
Versuch, auf einem Teilgebiet dem Studierenden und Praktiker die Arbeit zu er
leichtern, will neben der am Lehrstuhl im Aufbau befindlichen Literatur
kiutei iiber das Gesamtgebiet der Baubetriebslehre im In- und Aus
lande und dem mit Unterstutzung des PreuBischen Ministeriums fur Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung ins Leben gerufenen Forschungsinstitut fiir
Maschinenwesen beim Baubetrieb das vorliegende Handbuch machen, das
bewuBt auf die Bediirfnisse der Verbraucher-, weniger der Erzeugerkreise zu
geschnitten ist. Der Gesichtswinkel der Anwendung der Maschine ist also in
den Vordergrund geschoben. Er war auch die Veranlassung, daB einmal die
Einteilung des Buches weniger nach maschinentechnischen als nach bau-
1 Soeser: Allgemeine Baubetriebslehre, S. 3.
IV Vorwort.
betrie bstechnischen Gesichtspunkten erfolgte und daB vor aHem fiir die Ein
fiihrung ein Bauingenieur, wie Dr. Walch, gewonnen wurde, um das Buch von
vornherein der Bauingenieurideologie anzupassen.
Es sei an dieser Stelle allen Mitarbeitem, vor aHem Herrn Oberingenieur
Dr. Walch, meinem standigen Assistenten Herrn Dipl.-Ing. Bonwetsch und
all den Firmen sowie der Verlagsbuchhandlung Julius Springer gedankt, die
durch Zurverfiigungstellung von Material und die Ausstattung mit erstklassigem
Bildmaterial das Zustandekommen des Werkes ermoglicht haben. In dankbarer
Erinnerung aber muB ich auch der Zeiten gedenken, wo ich bei der Philipp Holz
mann A. G., Frankfurt/Main unter der Forderung von Herrn Baurat Galewski
und bei der Siemens-Bauunion in Berlin durch Herrn Dr. KreB all das Material
und die praktischen Erfahrungen sammeln konnte, ohne die ein Buch bau
betriebstechnischen Inhaltes wertlos ware.
Berlin, den 7. Juli 1931.
Dr. Georg Garbotz.
Inhaltsverzeichnis.
Erster Teil.
Die Einrichtung und der Betrieb maschinell arbeitender Baustellen.
Von Dr.-lng. O. Walch, Berlin.
Seite
A. Der Maschinenbetrieb im Bauwesen . . . • . . . . . . 1
I. Die Griinde fiir die Umstellung auf Maschinenbetrieb und die Vor-
teile der Maschinenarbeit im Bauwesen . 1
a) Kulturelle Griinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
b) Wirtschaftliche Griinde . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1. Das VerhiUtnis des Lohnes des ungelernten Arbeiters zu dem des Fach-
arbeiters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Lohnsteigerung und Maschinenpreise ........ 3
3. Rohere Wirtschaftlichkeit des Maschinenbetriebes bei hohen Lohnen 4
4. Die Wirtschaftlichkeit des Maschinenbetriebes bei niedrigen Lohnen 6
5. Leistung des einzelnen Arbeiters . . . . . . 7
6. Massenleistungen und Verkiirzung der Bauzeit 7
7. Verringerung der Zahl der Arbeiter . 9
0) GleiohmaBige Giite der Masohi nenarbeit . . . 13
d) Anwaohsen der Bauaufgaben ........ 13
II. Die Schwierigkeiten bei der Umstellung und die Naohteile des
Maschinenbetriebes im Bauwesen 14
a) Wirtschaftliohe Griinde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14
1. Kapitalbedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14
2. Die Belastungen der produktiven Arbeiten duroh Auf- und Abbaukosten 16
3. Geringe Ausniitzung der Masohinen . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Mangelnde Gelegenheit zur Wiederverwendung . . . . . . . . . . . 19
b) Personal . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
0) Fehlen einer Baumasohmenindustrie und mangelnde Zusammenarbeit von
Bau- und Masohineningenieur. . . . . . . . . . . . . . 20
III. Die besonderen Anforderungen an die Baumasohinen 22
a) Vielseitige Verwendbarkeit . . . . . . . . . . . . . 22
b) Einfaohheit im Bau, Montage, Betrieb und Reparatur. . . 23
0) Ortsveranderlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
d) EinfluB von Wind und Wetter . . . . . . . . . . . . . 24
B. Die fUr den Entwurf einer Baustelleneinrichtung erforderlichen Unterlagen
und die zu beriicksichtigenden Gesichtspunkte .............. 24
IV. Die zur Bearbeitung eines Entwurfes fiir eine Baustelleneinrioh-
tung notwendigen Unterlagen und Vorarbeiten . 24
a) Projektzeichnungen. . . . . . . . . . . . . 24
b) Massenermittlungen. . . . . . . . . . . . . 27
0) Die Bestimmung des Bauvorganges . . . . . 28
d) Die Aufstellung des Bauprogrammes . . . . . 30
e) Verteilungsplan fiir die zu leistenden Massen . .. 36
f) Festlegung des Verhaltnisses von Spitzenleistung zur Durohschnittsleistung 42
g) Dimensionierung der masohinellen Einriohtung, der Lager usw.. . . . . 43
V. Der EinfluB der vorliegenden Verhaltnisse auf die Baustellen-
einriohtung . . . . . . . . 44
a) Ortliche Verhaltnisse . . . . . . . . . . . . . . 44
1. Klimatische Verhaltnisse. . . . . . . . . . . . 44
2. Entfernung der Baustelle yom Stammhaus des Unternehmers 45
3. Stand der Industrie des Landes . 45
4. Gelandegestaltung an der Baustelle 45
5. Untergrundverhiiltnisse 46
6. Anfuhrverhaltnisse ....... 46
VI Inhalt&verzeichnis,
Selte
7. Vorhandene Baustoffe 47
8. AbfluBverhiiltnisse . . 48
9. Eisgang .. . . . . 48
10. Grundwasser . . . . 49
11. Bau- und Trinkwasser 49
b) Arbeiterverhiiltnisse . . . 49
c) Wirlschaftliche Verhiiltnisse 50
VI. Allgemeine Gesichtspunkte' fur die Einrichtung von Baustellen 50
a) .Art der Bauarbeiten . . . . . . 50
1. Erdarbeiten . . . . . . . . . 50
2. Felsarbeiten . . . . . . . . . 50
3. Griindungs- und Wasserhaltungsarbeiten 51
4. Betonarbeiten . . . . . . 51
5. Tunnel- und Stollenbauten 52
6. StraBenbau . . . . . . . 52
7. Hochbau . . . . . . . . 52
b) Auswahl der einzelnen Maschinen und Bestimmung der GroBe derselben 53
1. EinfluB der GroBe des Baues und Zeitdauer desselben 53
2. GroBe der Maschinen. . . . . . . . 54
3. Wiederverwendbarkeit der Maschinen 55
c) Zusammenarbeit der einzelnen Maschinen 55
1. Aufstellung der einzelnen Gruppen 55
2. Verbindung zwischen den einzelnen Maschinen 56
d) Reserven und Instandhaltung der Maschinen . . 56
1. Reservemaschinen . . . . . . . . . . . . . 56
2. Instandhaltung und Betriebssicherheit . . . . 57
e) Notwendigkeit von provisorischen Baustelleneinrichtungen 57
1. FUr die Baustelleneinrichtung selbst . . . 57
2. FUr die ersten produktiven Arbeiten . . . . 58
C. Die einzelnen Teile einer Baustelleneinrlcbtung . 58
VII. Die Anfuhr zur Baustelle, die Umlade- und Transporteinrich-
tungen .. . . . . . . . 58
a) Die Anfuhr zur Baustelle . . . . . . . . . . 58
b) Die Umladeeinrichtungen . . . . . . . . . . 59
c) Die Transportanlagen und das rollende Material 61
1. Transportmittel uber groBe Entfernungen. . 62
2. Forderanlagen uber kleinere Entfernungen 72
VIII. Die Lager, Schuppen, Silos fur Baustoffe . 83
a) Die Gesichtspunkte fur die Wahl der verscbiedenen Lagermoglicbkeiten 83
b) Die GroBe der Vorratsraume 83
c) Konstruktive Einzelheiten 85
1. Lager. . . . . . . . . . . . . . . 85
2. Schuppen . . . . . . . . . . . . . 85
3. Silos ........ . . . . . . . 87
IX. Die verschiedenen Arbeitsmaschinen . 90
a) Griindungs- und Wasserhaltungsarbeiten 90
b) Maschinen fur Erd- und Felsaushub . . 92
1. Erdaushub. . . . . . . . . . . . . 92
2. Felsaushub ............. 101
c) Zerkleinerungs-, Wasch- und Sortieranlagen 110
1. Allgemeines .. . . . . . 110
2. Steinzerkleinerungsanlagen 115
3. Sortieranlagen . . . . . . 118
4. Waschanlagen . . . . . . 119
5. Staubentfernung . . . . . 120
d) Betonerzeugungsanlagen . . . 120
1. AbmeB- und Mischanlagen .. .. 120
2. Beispiele von Betonerzeugungsanlagen . 123
e) Anlagen fUr den Transport und das Einbringen sowie fur die Bearbeitung von
Beton. . . . . . . . . . 128
1. Stampfbeton. . . . . . 128
2. GuBbeton . • . . . . . 129
3. Bearbeitung des Betons . 134
Inhaltsverzeichnis. VII
Selte
X. Werkstatten und sonstige Nebenanlagen 134
a) Werkstatten . . . . . . 135
b) Holzbearbeitungsanlagllll. . . . . . . . 137
c) Materialpriifungsanlagen. . . . . . . . 139
XI. Energieversorgung und Beleuchtung 139
a) Energiebedarf . . . . . . 139
b) Energieerzeugung . . . . . 140
c) Energieverteilung . . . . . 141
d) Beleuchtung der Baustelle . 141
e) Telephonverbindung. 142
XII. Siedlungen . . . . . . . 142
a) Beamtensiedlungen . . . 142
b) Arbeitersiedlungen . . . 143
c) Gemeinniitzige Gebaude . 144
d) Baubiiro . . . . 144
e) Heizungsanlagen 144
f) Kanalisation . . . . . . 145
g) Feuerschutz . . . . . . 145
D. Die Arbeit des Unternehmers von der Ausschreibung bis zur Abgabe des An-
gebotes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
XliI. Die Priifung der Unterlagen und Vertragsbedingungen. . . 147
XIV. Die Arbeiten fiir den Entwurf einer Baustelleneinrichtung 148
a) Vorarbeiten . . . . . . . . . . . 148
b) Entwurf einer Baustelleneinrichtung 150
c) Bauprogramm. . . . . 151
XV. Die Kostenberechnung . . . . . . 153
a) Vorarbeiten . . . . . . . . . . . 153
b) Kostenberechnung fiir die Baustelleneinrichtung 153
1. Die Kosten fiir das Gerat . . . . . . . . 154
2. Die Frachten und Zolle. . . . . . . . . . 155
3. Die Auf- und Abbaukosten . . . . . . . . . 155
4. Die Kosten der Erd- und Felsarbeiten fiir die Baustelleneinrichtung 156
5. Die Kosten fiir die Gebaude der Baustelleneinrichtung 156
6. Die Unterhaltungskosten fiir die Gerate . 156
7. Die Betriebskosten . . . . . . . . . . . . 157
8. Zusammenstellung . . . . . . . . . . . . 157
c) Kostenberechnung fiir die Leistungspositionen . 157
XVI. Das Finanzprogramm. . . . . . . . 157
XVII. Die abzugebenden Unterlagen und die Form derselben 159
E. Die Bauausfiihrung ........ . . . . . . . . . 160
XVIII. Die vorbereitenden Arbeiten fiir die Ausfiihrung, soweit der
maschinelle Betrieb in Frage kommt. 160
a) Verhandlungen iiber den Vertrag ..... 160
b) Verhandlungen mit den Maschinenfabriken 161
c) Vorbereitung des Gerates . . . . . . 161
d) Absendung des Gerates . . . . . . . 161
XIX. Die durch den Maschinenbetrieb erforderlich werdenden be-
sonderen Organisationen .... 162
a) Die Bauleit)lng des Bauherm .. 162
b) Das Stammhaus . . . . . . . . 162
c) Die Bauleitung des Untemehmers 163
d) Die maschinentechnische Leitung 163
e) Das Unterpersonal . 163
£) Die Arbeiter . . . .. . . 163
g) Das Lagerwesen . . . . . . . . 164
h) Die Baubuchhaltung . . . . . . 164
i) Das Kontrollwesen ...... . 164
XX. Beispiele von groBeren Baustelleneinrichtungen ... 164
a) Allgemeines . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
b) Baustelleneinrichtung fiir den Bau einer Talsperre im Hochgebirge 164
VIII Inhaltsverzeichnis.
Selte
c) Bau eines Speichers im Seehafen Stettin . . . . . . . . . . . . . . . 172
d) Die Baustelleneinrichtung fiir den Bau der Staustufe Ladenburg des Neckar-
Kanales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
e) Die Baustelleneinrichtung fiir die Erdarbeiten des Loses II Weser-Elbe-
Kanal ............•.................. 174
f) Die Baustelleneinrichtung fiir den Bau des Wehres der Wasserkraftanlage
Ryburg-Schworstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Literaturverzeicbnis . . r • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 182
Zweiter Teil.
Die Verwaltung uDd InstaDdhaltung der Geriite und Baustoffe.
Von Prof. Dr. G. Garbotz, Berlin.
A. Die Anwendung der Mascbine 1m Baubetrieb als Funktion des organisato-
riscbeD Aufbaues der Unternehmung . . . . . . . . . .. ...... 185
I. Der Umfang des Gerateparks .................... 185
II. Die Abhangigkeit des Maschineneinsatzes von der BetriebsgroBe 186
III. Hohere Organisationsformen als Voraussetzung fiir die Mechani-
sierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
IV. Die notwendige Erganzung der Mechanisierung durch hochwertige
Kalkulationsmethoden und sorgfiiltige Betriebsaufschreibungen .. 188
B. Die Gerllteverwaltung .......................... 189
I. Die Zusammenhange zwischen Gerateverwaltung und organisatori-
schem Aufbau der Unternehmung . . . . . . . . . . . . . . . 189
II. Einordnung und GroBe der Gerate- und Baustoffverwaltung. 192
III. Die Aufgaben der Gerateverwaltung . 193
C. Die Arbeitsteilung in der Geril.teverwaltung. . . . . 195
I. Das maschinentechnische Biiro . . . . . . . . 196
a) Mitarbeit bei der Aufstellung der Kostenanschlage 196
b) Die Absendung der Gerate . . . . . . . . . . . . . . . 199
0) Die Geratebeschaffung und -verteilung (evtl. durch Mietung) 202
d) Der Einflu/l der Normung auf die Gerateeinkaufspolitik . . . 208
e) Die Geratekartei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 211
f) Der Aufbau und die Vberwachung der Baustelleneinrichtung. . . . . . . 230
g) Die Durchfiihrung einer laufenden Betriebskontrolle und die Schaffung einer
Betriebsstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
h) Die Beobachtung der staatlichen und sonstigen Bestimmungen fiir den Betrieb 236
i) Die Heranziehung von Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
II. Das kaufmannische Biiro ....................... 238
a) Der Einkauf, die Verteilung undLagerung der Bau- und Betriebsstoffe sowie
Werkzeuge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
b) Der Versand und die Versicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
c) Die Buchhaltung und Statistik, die Verrechnung der Gerate und Baustoffe
Bowie Werkstattenarbeiten ................ . 269
III. Die Lagerplatze, Werkstatten und Magazine . . . . . . 278
a) Die laufenden Reparaturen und die Schlu/linstandsetzung . . 278
b) Die Bauwerkstatten fiir kleinere, mittlere und Gro/lbaustellen 279
1. Die Metallbearbeitungswerkstatten . 279
2. Die Holzbearbeitungswerkstatten . 295
3. Die Priif- und MeBeinrichtungen . 297
c) Die Hauptwerkstatten . . . . . . . 303
L Die Anordnung . . . . . . . . . 304
2. Beispiele ausgefiihrter Werkstatten . . . . . . . . . . 307
I. Bauwerkstatten S. 308. - II. Hauptwerkstatten S. 315.
3. Die Werkzeugmaschinen ...................... 321
a) Metallbearbeitungsmaschinen S.324. - b) Holzbearbeitungsmaschinen
S.361. - c) Sonstige Werkstattengerate S. 381.
d) Die Lagerplatze . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
1. Die Anordnung ........ . 389
2. Beispiele ausgefiihrter Lagerplatze . 394
3. Die Gerate- und Magazingebaude 402
Mietwerttabelle . 403 -444
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . .. .445
Erster Teil.
Die Einrichtung und der Betrieb maschinell
arbeitender Baustellen.
Von Dr.-Ing. O. Walch, Berlin.
A. Der Maschinenbetrieb im Banwesen.
I. Die Griinde fUr die Umstellung auf Maschinenbetrieb
und die Vorteile der Maschinenarbeit im Bauwesen.
In allen Industrien ist man in den letzten Jahrzehnten bestrebt gewesen,
Handarbeit soweit als irgend moglich auszuschalten und an ihre Stelle Maschinen
arbeit zu setzen. Man begniigte sich jedoch nicht mit der Anwendung von Ma
schinen allein, sondern versuchte durch ein sorgfaltiges Studium der einzelnen
Arbeitsvorgange diese moglichst methodisch zu gestalten und zweckmaBig
aneinanderzureihen, um so unniitze Handgriffe und Transporte bei und zwischen
den einzelnen Bearbeitungsabschnitten soweit als moglich auszuschalten. Diese
Bemiihungen haben groBe Erfolge gezeitigt, besonders bei der Massenfabrikation,
wo man zur Einfiihrung der sogenannten FlieBarbeit kam.
1m Baubetrieb kann man niemals so weit kommen, da es sich hier nie in
dem Sinne urn Massenherstellung handelt wie in anderen Industrien. Wohl
kommen gerade im Baubetrieb Massenleistungen vor, wie kaum irgendwo anders,
aber unter sich standig andernden Bedingungen, so daB man nicht ohne wei teres
die Grundsatze und Erfahrungen aus anderen Industrien auf den Baubetrieb
iibertragen kann.
Trotzdem ist es aber moglich, auch im Bauwesen die Wirtschaftlichkeit
zu heben sowohl durch Anwendung von Maschinen, d. h. durch den Ersatz
von Handarbeit durch Maschinenarbeit, als auch durch Verbesserung der ein
zelnen Arbeitsvorgange, sowie durch Zusammenfassung einzelner, sich stets
gleichbleibender Arbeitsabschnitte. In den letzten Jahren hat man dieses Ziel
mehr und mehr erkannt und ist dank der Mitarbeit zahlreicher Ingenieure auch
schon ein ziemliches Stiick vorangekommen. Verschiedene Griinde haben diese
Umstellung begiinstigt und beschleunigt, so daB heute schon die Vorteile des
Maschinenbetriebes und einer methodischen Arbeitsweise in einem groBeren
Kreis bekannt und anerkannt sind.
Allerdings wird man nie so weit kommen, daB man letzten Endes fast auf
jede Handarbeit verzichten kann und nur noch Maschinen verwendet. 1m Bau
betriebe handelt es sich oft nur um Arbeiten kleineren Umfanges oder um kleinere
Teilarbeiten; es wird sich dann nicht lohnen, Maschinen zu wahlen, abgesehen
davon, daB fiir manche Arbeiten auch heute noch nur Handarbeit in Frage kommt.
Fiir die Umstellung im Baubetrieb von der Handarbeit zum Maschinen
betrieb und von den einfachsten Arbeitsweisen zu den neuzeitlichen Methoden
sprechen Griinde verschiedenster Art - kulturelle und wirtschaftliche Griinde;
dann aber auch noch andere Vorteile, die mit dieser Umstellung erreicht werden,
wie die gleichmaBige Qualitat der Maschinenarbeit und die Moglichkeit, groBe
und groBte Aufgaben in kurzer Zeit zu bewaltigen.
Garbotz, Handbuch I. I
2 Der Maschinenbetrieb im Bauwesen.
a) Kulturelle Grunde.
Gerade im Bauwesen sind schwere korperliche Arbeiten, wie Boden- und
Felsaushub, Steinzerkleinerung usw. zu verrichten, vielfach unter ungiinstigen
Umstanden, wie z. B. beim Stollenbau usw. Hier die Handarbeit soweit nur
irgend angangig auszuschalten und an ihre Stelle Maschinenarbeit zu setzen,
ist sicherlich vom kulturellen und sozialen Standpunkt aus zu begriiBen, da
dadurch die Menschenkraft geschont wird, auBerdem menschliche Krafte, die
sich bisher mit den einfachsten Arbeiten abplagen muBten, fiir hohere Auf
gaben frei wer~en und so eine Hebung des kulturellen Niveaus moglich ist.
Vielfach hat man Bedenken gehort, daB durch die gleichmaBige, abstumpfende
Arbeit bei der Bedienung der Maschinen erst recht eine Schadigung der Arbeiter
entstehen wiirde. Aile Erfahrungen in den verschiedenartigsten Betrieben
sprechen dagegen. Um so weniger ist daher im Bauwesen diese Befiirchtung
am Platze, da man hier infolge der Eigenart der Bauarbeiten nie von einem
ermiidenden Einerlei sprechen kann, sondern durch die stets sich andernden
Umstande immer eine Abwechslung und damit eine Anregung gegeben ist.
AuBerdem kommt hinzu, daB an einer Baustelle weitaus die meisten Arbeiten
sich im Freien vollziehen und schon allein dadurch gesiindere Thldingungen
fiir die Arbeit gegeben sind als in einem Fabrikbetrieb. In allen Fallen, wo die
Arbeit nicht unter freiem Himmel ausgefiihrt werden kann, wie z. B. im Tunnel
und Stollenbau, stellt aber die Einfiihrung der Maschinen eine so groBe Er
leichterung fiir die Arbeiter dar, daB von einer schadlichen Wirkung keine
Rede sein kann.
Ahnlich wie in der Landwirtschaft kommen auch im Baubetrieb viele Leute
mit Maschinen in nahere Beriihrung, die vor wenigen Jahren noch nicht viel
Ahnung davon hatten, was eine Maschine ist und wie sie arbeitet. Ihnen allen
ist heute, wo Baumaschinen in groBer Zahl in Betrieb sind, Gelegenheit gegeben,
ihre Kenntnisse zu erweitern und Neues zu sehen. Durch die Anwendung von
Maschinen im Bauwesen wird sicherlich das Verstandnis fiir die Maschinen in
die breite Masse herausgetragen und dient dazu, eine hohere Bildung zu ver
breiten.
So hoch aber auch die kulturellen Vorteile einzuschatzen sind, die mit der
Umstellung auf Maschinenbetrieb im Bauwesen verbunden sind, so ist doch
nicht zu verkennen, daB sie allein nie dafiir hatten maBgebend sein konnen.
Hier sprechen in erster Linie wirtschaftliche Griinde mit.
b) Wirtschaftliche Grftnde.
Es ist hier nicht erforderlich, die hohere Wirtschaftlichkeit von Maschinen
arbeit gegeniiber Handarbeit im allgemeinen zu beweisen; es geniigt vielmehr,
auf einzelne Umstande hinzuweisen, denen im Baubetrieb besondere Bedeutung
zukommt.
1. Das Verhaltnis des Lohnes des ungelernten Arbeiters zu dem
des Facharbeiters.
Es ist ohne weiteres einleuchtend, daB bei auBergewohnlich niedrigen Lohnen
fiir den ungelernten Arbeiter, aber hohen Lohnen fiir den gelernten Arbeiter
die Wirtschaftlichkeit des Maschinenbetriebes in Frage gestellt wird. Bei niedrigen
Lohnen fiir den ungelernten Arbeiter konnen Arbeiten, die keine besonderen
Kenntnisse erfordern, billig von Hand ausgefiihrt werden, wahrend die Ge
stehungskosten der Maschinen sowohl als auch der Betrieb derselben in wesent
lichem MaBe von der Hohe des Lohnes fiir die Facharbeiter abhangig sind, und
demgemaB Maschinenarbeit sich verhaltnismaBig teuer stellt. Steigt nun der