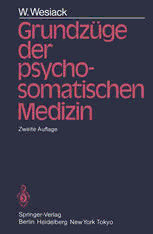Table Of ContentWesiack . Grundziige der Psychosomatischen Medizin
Wolfgang Wesiack
Grundziige der
Psychosomatischen Medizin
Zweite Auflage
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York Tokyo
1984
Professor Dr. Wolfgang Wesiack
LudwigstraBe 10
7080 Aalen
1. Auflage erschienen 1974 © C.H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck) Miinchen
CIP·Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Wesiack, Wolfgang: Grundziige der psychosomatischen Medizin / Wolfgang
Wesiack. - 2. Aufl. - Berlin; Heidelberg; New
York; Tokyo: Springer, 1984.
1. Aufl. im VerI. Beck, Miinchen
ISBN-13: 978-3-540-13684-2 e-ISBN-13: 978-3-642-69935-1
DOl: 10.1007/978-3-642-69935-1
Das Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der
Ubersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe
aufphotomechanischem oder ahnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Vergiitungsanspriiche des § 54,
Abs.2 UrhG werden durch die "Verwertungsgesellschaft Wort", Miinchen, wahrgenommen.
©Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1984
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB solche N amen im Sinne
der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von je-
derrnann benutzt werden diirften.
Gesamtherstellung: Appl
2119/3140-5 4 3 2 1 0
Fiir
Margit,
Wolfgang, Ulrike,
Konstanze und Bettina
Inhalt
Vorwort . 11
Einleitung 13
I. Die historischen Determinanten der
psychosomatischen Medizin
1. Allgemeine Vorbemerkungen. . . . . . . . . . 22
2. Die magische Erlebnisstufe und die magisch-animistische
Heilkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24
3. Altsemitischer Personalismus . 28
4. Griechischer Naturalismus, Psychokatharsis und die Heil
wirkung des Dialogs . . . . . . 31
I. • • • • • • • • • • • • ••
5. Der Einflu~ des Christentums auf die weitere Entwicklung
der Heilkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6. Die Medizin als angewandte Naturwissenschaft 42
7. Sigmund Freud und die Psychoanalyse .. 46
II. Kranke Menschen
1. Die Krankengeschichte der Frau Albert 58 .
2. Erleben und Befund . . . . . . . . . . 61
3. Die »Krankheiten" unserer Patientin 64
8 Inhalt
4. Die Lebensgeschichte und die Psychodynamik von Frau
Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. Herr Bollieidet an Bluthochdruck . . . . . . . . . . . .. 74
6. Patienten mit Zwolffingerdarmgeschwiiren in psycho-
somatischer Sicht . . . . ... . . . . . . . . . 79
7. Herr Cebus kann nicht selbstandig werden. 86
8. Frau Danielleidet an "vegetativer Dystonie" . . . . . .. d8
9. Zwei mifSverstandene Patienten . . . . . . . . . . . . .. 95
III. Versuch einer theoretischen Systematisierung
1. Der diagnostisch-therapeutische Zirkel 100
2. Yom Kranken zur Diagnose . . . . . . 104
3. Die Bedeutung der Information und Informationsverar
beitung fur die Theorie der psychosomatischen Medizin. 110
4. Die "Handlung" als psychosomatisches Grundmodell .. 117
IV. Die Konsequenzen des psychosomatischen Ansatzes
1. Konsequenzen fUr die iirztliche Tiitigkeit . . 122
2. Konsequenzen fUr-die Forschung und Lehre . 126
3. Konsequenzen fur die Gesundheitspolitik ..., . . . . .. 129
Inhalt 9
Anmerkungen . . . 132
Literaturverzeichnis 144
Namenregister . . 150
Stichwortregister . 152
Vorwort
Die Aufgabe der Heilkunde, kranken Menschen bei der Oberwin
dung ihres Leidens und ihrer Krankheiten zu heIfen, ist seit Jahrtau
senden unveriindert geblieben. Die Mittel und Wege zur Erreichung
dieses Zieles andern sich jedoch standig. Sie sind abhangig vom
jeweiligen Stand unseres Wissens und Konnens, aber ebenso von
den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen unserer
Zivilisation und nicht zuletzt vom Menschenbild, einer anthropolo
gischen Vorentscheidung gewissermaiSen, die uns leitet.
Die gegenwartige Situation der Medizin ist durch eine hochgra
dige Perfektion unseres naturwissenschaftlich-technischen Wissens
und Konnens und durch ein hochgeziichtetes Spezialistentum ge
kennzeichnet. Die personlichen Bediirfnisse unserer Patienten, so
wie die psychischen und psychosozialen Bedingungen ihres Krank
seins sind jedoch lange Zeit vernachlassigt worden. Durch
Forderung von Psychotherapie, Psychoanalyse, medizinischer Psy
chologie und medizinischer Soziologie, die da und dort einzusetzen
beginnt, versucht man diesen Mangel auszugleichen. Diese Bestre
bungen sind erfreulich und soIIten weitere Unterstiitzung finden,
denn sie konnten zu einer Verringerung der Kluft zwischen dem
naturwissenschaftlich-technischen und dem psychologischen Wis
sen und Konnen fiihren. Das Problem des Spezialistentums losen
sie jedoch nicht. 1m GegenteiI. Die Gefahr, daiS die Patienten in
korperlich und seelisch Kranke geschieden werden und daiS an ihnen
"vorbeidiagnostiziert" und "vorbeibehandelt" wird, ist eher groiSer
geworden.
Hier setzen die Bestrebungen der psychosomatischen Medizin
ein. Sie steHt den leidenden Me~schen in den Mittelpunkt ihrer
Betrachtung und versucht die psychischen, psychosozialen und
physikalisch-chemischep. Faktoren seines Krankseins zu beriick
sichtigen. Dazu benotigt sie jedoch eine neue Theorie, die erst Schritt
fiir Schritt erarbeitet werden kann. Obwohl ihre Konturen aIImah
lich sichtbar werden, ist hier noch aIIes unabgeschlossen und vi~les
12 Vorwort
kontrovers. Der Leser kann also nicht erwarten, dag ihm hier ein
abgeschlossenes und allgemein akzeptiertes Wissensgut vermittelt
wird, sondern in erster Linie Anregungen zu eigenem Nachdenken
und zur Kritik. Dementsprechend wird er vieles vermissen und
manches anders sehen. Er wird auch dariiber zu urteilen haben,
ob es mir gelungen ist, die Probleme nicht nur fiir den Fachmann,
sondern auch £iir den interessierten Laien verstandlich dargestellt
zu haben.
Abschliegend ist es mir ein Bediirfnis all jenen zu danken, von
denen ich lernen konnte. Ich kann sie unmoglich einzeln namentlich
erwahnen. 1m Literaturverzeichnis sind viele von ihnen,wenn auch
nicht aile, aufgefiihrt. Vier Autoren bin ich jedoch zu ganz besonde
rem Dank verpfiichtet. Es sind dies Sigmund Freud, Viktor v. Weiz
sacker, Michael Balint und Thure v. Uexkiill. Dem letzteren ver-
I
danke ich nicht nur als Autor sehr viel, sondern auch als Leiter
eines Arbeitskreises, dem anzugehoren mir viel bedeutet. Mein
Dank gilt aber auch allen meinen Patienten. Sie sind eine uner
schopfliche Wissensquelle und haben das unersetzliche Verdienst,
theoretische Hohenfiiige rasch wieder auf den Boden der Realitaten
zuriickzufiihren. Meiner Mitarbeiterin Fraulein Gisela Kohnle
danke ich £iir die Anfertigung des Manuskriptes.
Einleitung
Wer es unternimmt, den Leser in die Probleme eines bestimmten
Fachgebietes einzufiihren, ist, so glaube ich, verpflichtet, von
Anfang an zweierlei deutlich zum Ausdruck zu bringen: Er muB
zunachst sagen in was er einfuhren will, muB also seinen Gegenstand
klar bezeichnen und umgrenzen, urn dann dem Leser mitzuteilen
wie er diese Aufgabe zu losen gedenkt.
Sornit ware also der Autor einer Einfuhrung in die Grundpro
bleme der psychosomatischen Medizin vereflichtet, zunachst zu sa
gen, was er und andere Autoren unter psychosomatischer Medizin
verstehen. Hier beginnen aber bereits die Schwierigkeiten, denn die
Definitionen, die die verschiedenen Autoren vom Begriff "psycho
somatisch" geben, decken sid~ keineswegs. So schreiben zum Bei
spiel F. C. Redlich und D. X. Freedman: "Der Begriff ,psychosoma
tisch' hat viele, vielleicht aIlzuviele Bedeutungen. Psychosomatische
Krankheiten lassen sich in etwa definieren als eine Gruppe von so
matischen Krankheiten unbekannter Atiologie, bei denen psychi
sche Faktoren eine mehr oder weniger erhebliche Rolle spielen, je
denfalls eine groBere Rolle als bei anderen Korperkrankhei
ten."l
Dieser vorsichtigen Umschreibung, die ausdriicklich von "unbe
kannter Atiologie" und etwas unverbindlich von "psychischen Fak
toren" spricht, die "eine mehr oder weniger erhebliche Rolle spie
len" und die deshalb von sehr vielen, vielleicht sogar von den
meisten Arzten akzeptiert werden kann, wollen wir nun eine andere
Definition gegeniiberstellen, die wir F. G. Alexander und S. T. Seles
nick entnehmen. Sie lautet: "AIle solche Prozesse, in denen die ersten
Glieder einer Kette von Ereignissen subjektiv als Emotionen wahr
genommen und die nachfolgenden Glieder ob;ektiv als Veriinde
rungen der Korperfunktionen beobachtet werden, nennt man psy
chosomatische Phanomene. "2 Hier ist also bereits von einer "Kette
von Ereignissen" also von einer Reihenfolge die Rede, deren erste
Glieder "subjektiv als Emotionen" und die nachfolgenden "objektiv