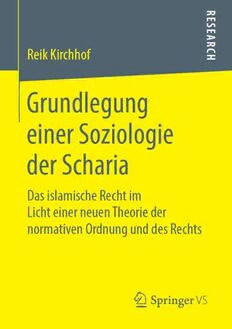Table Of ContentReik Kirchhof
Grundlegung
einer Soziologie
der Scharia
Das islamische Recht im
Licht einer neuen Theorie der
normativen Ordnung und des Rechts
Grundlegung einer Soziologie der Scharia
Reik Kirchhof
Grundlegung
einer Soziologie
der Scharia
Das islamische Recht im
Licht einer neuen Theorie der
normativen Ordnung und des Rechts
Reik Kirchhof
Berlin, Deutschland
Dissertation Universität Erfurt / 2018
ISBN 978-3-658-24533-7 ISBN 978-3-658-24534-4 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24534-4
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Vorwort
Die Entstehung dieser Arbeit war ein wenig wahrscheinliches Ereignis. Es war so
unwahrscheinlich wie die Evolution heute existierender Wissensbestände. Der
Beginn der Zeit vor ca. 14 Milliarden Jahren markierte das vorläufige Ende der
Supersymmetrie. Seither entladen sich die Dimensionen ins Chaos der Möglich-
keiten, in dem sich der Mensch seit seiner Existenz an ganz unterschiedlichen
Orten Wissensformationen stabilisiert, damit er den Kopf frei hat, um sich einen
Topf Reis zu kochen. Im Angesicht der Entropie kann er Irritationen und Varia-
tionen nur nach der Wiederverwendbarkeit für eigene Wissensbestände selektie-
ren. Der Rest muss vergessen werden. Das heutige Wissen entstand nicht nach
einem teleologischen Prozess, der einem Optimierungsplan folgt. Es ist reiner
Zufall, dass wir wissen, dass Reis mit Chili besser schmeckt oder Gott der Schöp-
fer dieser Welt ist und dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Es hätte auch
ganz anders kommen können. Im Gegensatz zur Entstehung des Menschen,
kann unabhängig aller Geltungsansprüche die Existenz heutiger Wissensbestän-
de nicht mit einer besonders guten Anpassung an die Realität begründet werden.
Dies schon deshalb nicht, weil Wissen keine Ressourcenknappheit kennt, es sei
denn man wollte die Existenz unserer Wissensbestände allein mit den Realitäten
akademischer Karrierestrukturen begründen. Natürlich braucht auch der Wis-
senschaftler ein Abendessen, dies aber nicht, um das Chaos zu bewältigen, son-
dern weil er sich besonders weit über den schmalen Grat hinauslehnen muss, um
das Chaos aller Möglichkeiten sichtbar zu machen. Wenn diese Arbeit jemanden
zugeeignet ist, dann sind es die Unbekannten, deren Wissen wir vergessen muss-
ten, obwohl ihr Wissen nicht weniger unwahrscheinlich war als das Ereignis
dieser Arbeit. Ich danke meinem Lehrer Martin Morlok. Ich danke Lynn
Welchman, mit der ich während meines Studiums an der School of Oriental and
African Studies in London erste Ideen zu dieser Arbeit diskutieren konnte. Ein-
gehende Diskussionen des Manuskripts mit Teilnehmern des Kolloquiums der
Islamwissenschaft an der Universität Erfurt haben mir viele Anregungen gege-
ben. Ihnen allen gilt mein Dank. Ganz besonders danke ich Jamal Malik für seine
Neugier an allen unwahrscheinlichen Ereignissen. Ich verdanke ihm die Annah-
me dieser Arbeit als Dissertation am Seminar für Religionswissenschaft der phi-
losophischen Fakultät der Universität Erfurt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ............................................................................................................. 1
Kapitel I: Gegenstand und Methode der Untersuchung .................................... 9
1. Der Rechtsbegriff in der Islamwissenschaft ............................................... 10
1.1 Das Argument Scharia ist islamisches Recht ............................................. 10
1.2 Kritik am Argument Scharia ist islamisches Recht ................................... 20
1.3 Erörterung und Ausgangslage ..................................................................... 32
2. Interkulturalität der Begriffe Recht und Scharia ....................................... 35
2.1 Erkenntnistheoretischer Hintergrund ........................................................ 36
2.2 Sprachbarriere ................................................................................................ 41
2.3 Konfessionsbarriere ....................................................................................... 46
2.4 Kulturbarriere, Orientalismus ..................................................................... 49
2.5 Erörterung und Ergebnis .............................................................................. 54
3. Methode der Argumentation ....................................................................... 58
3.1 Merkmale des Rechts .................................................................................... 58
3.2 Merkmale der Scharia ................................................................................... 63
3.3 Rechtsvergleichung als Methode? ............................................................... 68
Kapitel II: Die Merkmale des Rechts ................................................................ 73
1. Ort einer Theorie des Rechts ....................................................................... 75
2. Die Entwicklung des Rechtsbegriffs ............................................................ 79
2.1 Die Ausgangslage ........................................................................................... 79
2.2 Grundpositionen des Rechtsbegriffs ........................................................... 83
2.3 Zwischenerörterung ...................................................................................... 91
2.4 Herausforderungen an den Rechtsbegriff .................................................. 94
2.4.1 Die Emergenz des Völkerrechts ................................................. 95
2.4.2 Die Emergenz der Rechtsethik .................................................. 99
2.4.3 Rechtspluralismus und transnationales Recht ......................... 106
2.5 Erörterung und Anforderungen an eine Theorie des Rechts ................ 113
3. Eine Rahmentheorie des Rechts ................................................................ 120
3.1 Die normativen Strukturen der Gesellschaft ........................................... 121
3.1.1 Doppelte Kontingenz als Grundproblem sozialer Ordnung .... 122
VIII Inhaltsverzeichnis
3.1.2 Normative Erwartungen als Voraussetzung normativer
Ordnung .................................................................................. 125
3.1.3 Entscheidung und Praxis als Voraussetzung normativer
Ordnung .................................................................................. 126
3.1.4 Institutionalisierung als Voraussetzung normativer
Ordnung .................................................................................. 129
3.2 Die Unterscheidung von Rechtsnormen und anderen sozialen
Normen ......................................................................................................... 137
3.2.1 Klassische Ansätze der Rechtssoziologie ................................. 138
3.2.2 Luhmann: Unterscheidung durch einen Code? ....................... 142
3.2.3 Konkurrenzlose Entscheidung als Voraussetzung des
Rechts ...................................................................................... 146
3.3 Gesellschaftsbegriff: Die Integration und Desintegration der
Weltgesellschaft ........................................................................................... 151
3.4 Eine Revision klassischer Probleme des Rechtsbegriffs ......................... 160
3.4.1 Recht und die Geltung des Rechts ........................................... 160
3.4.2 Recht und die Legitimation des Rechts .................................... 165
3.4.3 Recht und Moral ...................................................................... 167
3.5 Die Begründung des Rechts ....................................................................... 174
3.6 Ergebnis: Ein Rechtsbegriff ........................................................................ 178
Kapitel III: Die Merkmale der Scharia ........................................................... 179
1. Die Göttliche Offenbarung ........................................................................ 183
2. Fiqh ............................................................................................................. 186
2.1 Formation der Fiqh ..................................................................................... 188
2.1.1 Lebzeiten des Propheten .......................................................... 188
2.1.2 Nach dem Tod des Propheten ................................................. 191
2.1.3 Entstehung der Rechtsschulen ................................................. 195
2.2 Methoden der Fiqh, Usul al-Fiqh .............................................................. 202
2.2.1 Der Koran als Rechtsquelle ...................................................... 204
2.2.2 Idschtihad und Taqlid ............................................................. 205
2.2.3 Abrogation und Qiyas ............................................................. 208
2.2.4 Die Sunna des Propheten ........................................................ 213
2.2.5 Methoden des Qiyas und weitere Prinzipien ........................... 219
2.2.6 Idschma ................................................................................... 222
2.2.7 Gewohnheitsrecht .................................................................... 226
Inhaltsverzeichnis IX
3. Fiqh und Gesellschaft ................................................................................ 228
4. Fiqh und Moderne ..................................................................................... 235
Kapitel IV: Eine Rekonstruktion der Scharia ................................................. 245
1. Göttliche Offenbarung als normative Erwartung .................................... 246
1.1 Die Offenbarung als normative Erwartungen Gottes ............................. 249
1.2 Die Offenbarung als normative Erwartungen der Gesellschaft ............ 250
2. Fiqh und die Institutionalisierung normativer Erwartungen ................. 258
2.1 Usul al-Fiqh als Prozesse des Entscheidens ............................................. 259
2.1.1 Erkenntnistheoretische Positionen zum Verstehen ................. 259
2.1.2 Verstehen als Prozesse des Entscheidens ................................. 265
2.1.3 Rechtsquellen und Methoden der Fiqh im
Entscheidungsprozess .............................................................. 269
2.2 Fiqh und gesellschaftliche Strukturen des Entscheidungsprozesses .... 278
2.2.1 Der Prophet als Institution rechtlicher Normativität .............. 278
2.2.2 Nach dem Tod des Propheten: Das Ringen um das göttliche
Recht ........................................................................................ 292
2.2.2.1 Ausgangslage und Untergang des islamischen
Rechts ................................................................................ 292
2.2.2.2 Die Fiqh und das Ringen um ein islamisches
Recht .................................................................................. 301
2.2.2.3 Manifestierung der Madhhabs als
Integrationsstopp ............................................................. 313
2.2.2.4 Idschma als untauglicher Versuch der Integration .... 318
2.2.2.5 Taqlid als Integrationshindernis ................................... 321
2.2.3 Rechtspluralität als Antwort der Literatur ............................... 326
3. Rechtspluralität als Spiegel sozialer Integration und Desintegration ..... 333
4. Scharia und ihre Institutionalisierung in der Moderne ........................... 343
Zusammenfassung und Ausblick: Scharia in der globalen Kollision
normativer Ordnungen ................................................................................... 365
Literaturverzeichnis ........................................................................................ 375
Sachregister ...................................................................................................... 401
Einleitung
Die Islamwissenschaft versteht und übersetzt den Begriff der Scharia (šarīʿa)
gewöhnlich als das islamische Recht, in dessen Bedeutung der Begriff auch
seinen Weg in die öffentlichen Debatten gefunden hat. Weil der Scharia be-
scheinigt wird, „der Innbegriff des echt islamischen Geistes, die entscheidends-
te Ausprägung des islamischen Denkens, der Wesenskern des Islams über-
haupt“ zu sein, besitzt der Begriff eine zentrale Bedeutung für die Erforschung
des Islams und der islamischen Welt.1 Die diesem Argument zugrunde liegen-
den theoretischen Vorannahmen beeinflussen daher einen Großteil der For-
schung, den Gang vieler empirischer Untersuchungen und nicht zuletzt auch
die so gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Gleichzeitig ist jedoch zu
beobachten, dass dem Argument mit allgemeiner Skepsis und Kritik begegnet
wird, ohne dass damit aber seine Verwendung in Frage gestellt werden würde.
Wann immer der Begriff Scharia die Gedankengänge der Islamwissenschaft
durchkreuzt, was auf Grund seiner Bedeutung für den Islam sehr häufig der
Fall ist, wird in Klammern, Fußnoten oder kurzen Bemerkungen darauf hinge-
wiesen, dass der Begriffszusammenhang problematisch sei. Auch die wenigen
Erörterungen dieser Kritik, welche über drei Zeilen hinausreichen, beschrän-
ken sich zumeist auf einleitende Ausführungen oder situative Randbemerkun-
gen. Die dort gewechselten Argumente haben sich über die Zeit zu einem ein-
heitlichen Narrativ geformt. Das herrschende Argument ist der Unterschied
zwischen dem Islam und dem Westen. Weil die Scharia islamisch sei und der
Westen nicht, sei es problematisch, die Scharia mit dem Recht des Westens zu
vergleichen oder zu erforschen. Das islamische Recht gelte nämlich auch im
Jenseits, zudem komme es ohne Sanktionen aus, operiere außerhalb des Staates
und enthalte darüber hinaus Normen der Moral, nicht zuletzt auch religiöse
Normen, ganz im Gegensatz zum Recht des Westens. Philologisch geschulte
Autoren2 weisen zudem gern darauf hin, dass mit dem arabischen Wort Scharia
der Weg zu einer Wasserstelle gemeint sei, und es schon deshalb schwierig sei,
den Begriff mit Recht in Verbindung zu bringen. Daneben gibt es aber auch
eindeutige Einlassungen. So argumentiert z.B. Wael Hallaq, dass es sich bei
dem Wissen über das islamische Recht um eine „Erfindung Europas“ handele
1 Gotthelf Bergsträsser, Grundzüge des islamischen Rechts, Joseph Schacht (Hrsg.), 1935 (2016),
S. 1.
2 In dieser Untersuchung benutze ich meist, vor allem aus Gründen der besseren Lesbarkeit, die
männliche Form für Personen, gemeint sind dann gleichwohl wie gewöhnlich beide Ge-
schlechter.
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
R. Kirchhof, Grundlegung einer Soziologie der Scharia,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24534-4_1
2 Einleitung
und der Begriff deshalb abzulehnen sei.3 Auch Abdullahi An-Naʿim wendet
sich gegen die Verwendung des Begriffes „islamisches Recht“ und meint, dass
Scharia kein rechtliches, sondern ein „religiöses normatives System“ sei, und
suggeriert damit, dass Scharia mit Recht nicht viel zu tun hätte.4
Die in dieser Auseinandersetzung geäußerten theoretischen Annahmen
zum Recht erinnern dabei überwiegend an einen Rechtsbegriff, wie er sich im
19. Jahrhundert in Europa herauszubilden begann, nach dem das Recht vor-
nehmlich als eine Zwangsordnung eines staatlichen Sovereins erklärt wird,
welches im stetigen Konflikt mit der Moral steht. Dies ist insoweit nicht über-
raschend, waren es doch die Pioniere der Disziplin, die zu jener Zeit aus dem
Horizont ihres zumeist europäischen Welt- und Selbstbildes den neuen For-
schungsgegenstand sinnvoll und systematisch in einen ebenfalls noch neuen
Diskurs einbetten mussten. Die auf diesen Grundlagen gewonnenen Schluss-
folgerungen wären nun nicht unbedingt zu beanstanden, soweit der Gegen-
stand mit Verweis auf die eigene Wissenschaftsgeschichte lediglich als ein his-
torisches Phänomen diskutiert werden würde. In diesem Fall ließe sich aus der
Gegenwart feststellen, dass man sich die Welt eben früher so vorstellte. Ein
Problem entsteht aber dann, wenn die Scharia als ein Phänomen der Gegen-
wart erörtert wird, was aus vielen und naheliegenden Gründe heute sehr häufig
der Fall ist, und dabei die historischen Weltbilder und Theorien mitgeführt
werden. Vor dem Hintergrund, dass Imperativtheorien des Rechts seit langem
als überholt gelten, ist es bemerkenswert, dass eine Anpassung dieser histori-
schen theoretischen Vorannahmen an den Forschungsstand zum Rechtsbegriff
bis heute nicht stattgefunden hat.
Stattdessen verlegte sich die Disziplin im Milieu ihrer Selbstbezogenheit auf
das theoretische Axiom einer Islam-Westen Differenz und verwechselte damit
ihren Gegenstand mit den theoretischen Grundlagen seiner Erforschung,
wodurch die Theorie zu einer geschlossenen Ideologie degenerierte. Obwohl
die durch die Disziplin selbst geäußerte Kritik am Begriffszusammenhang von
Scharia und Recht die Grundlagen der Islamwissenschaft betreffen und obwohl
Beschwörungen der Notwendigkeit nach mehr Interdisziplinarität stetig zu-
nehmen, hat es die Disziplin bisher versäumt, ihre theoretischen Vorannahmen
und Methoden grundlegend zu überprüfen und ihr Verständnis der Scharia vor
3 Wael Hallaq, Shariʿa, Theory, Practice, Transformation, S. 6, obwohl er den Begriff aber weiter
verwenden müsse, weil ihm das „Gefängnis der Sprache“ keine Wahl ließe, vgl. ebenda, S. 12.
4 Abdullahi An-Naʿim, Shariʿa and Positive Legislation: Is an Islamic State Possible or Viable?,
in: Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, 2000, S. 29–41, S. 29, Fn. 1.