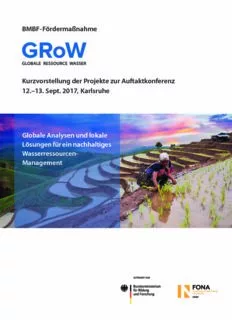Table Of ContentBMBF-Fördermaßnahme
Kurzvorstellung der Projekte zur Auftaktkonferenz
12.–13. Sept. 2017, Karlsruhe
Globale Analysen und lokale
Lösungen für ein nachhaltiges
Wasserressourcen-
Management
Inhaltsverzeichnis
5 Die BMBF-Fördermaßnahme GRoW
5 Hintergrund und Ziele
5 Struktur der Fördermaßnahme
IMPRESSUM
6 GRoW Verbundprojekte
Herausgeber:
adelphi research gemeinnützige GmbH
7 Geografische Bezüge der GRoW-Verbundprojekte
Alt-Moabit 91, 10559 Berlin
Geschäftsführer: Alexander Carius, Walter Kahlenborn, Mikael P. Henzler
THEMENFELD: GLOBALE WASSERRESSOURCEN
Sitz: Berlin, AG Charlottenburg HRB 81753; UST ID: DE 813281567
8 ViWA – VirtualWaterValues – Multiskaliges Monitoring globaler Wasserressourcen und Optionen für
Ansprechpartner für die BMBF-Fördermaßannahme
deren effiziente und nachhaltige Nutzung
„Globale Ressource Wasser“ (GRoW):
Beim BMBF: 12 SaWaM – Saisonales Wasserressourcen-Managment in Trockenregionen: Praxistransfer regionalisierter
Dr. Christian Alecke globaler Informationen
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat 724 – Ressourcen und Nachhaltigkeit 16 GlobeDrought – ein globalskaliges Werkzeug zur Charakterisierung von Dürren und Quantifizierung
53170 Bonn ihrer Wirkungen auf Wasserressourcen, die Produktivität im Pflanzenbau, den Handel mit Nahrungsmitteln
Email: [email protected] sowie den Bedarf an internationaler Nahrungsmittelhilfe
Beim Projektträger:
20 MuDaK-WRM – Multidisziplinäre Datenakquisition als Schlüssel für ein global anwendbares Wasserres-
Dr. Leif Wolf
Projektträger Karlsruhe (PTKA) ourcenmanagement
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
24 MedWater – Nachhaltige Bewirtschaftung politisch und ökonomisch relevanter Wasserressourcen
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
in hydraulisch, klimatisch und ökologisch hoch-dynamischen Festgesteinsgrundwasserleitern des
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
E-Mail: [email protected] Mittelmeerraumes
Redaktion: THEMENFELD: GLOBALER WASSERBEDARF
Vernetzungs- und Transfervorhaben der BMBF-Fördermaßnahme 28 InoCottonGRoW – Innovative Impulse zur Verringerung des Wasser-Fußabdrucks der globalen Baumwoll-
„Globale Ressource Wasser“ (GRoW)
Textilindustrie in Richtung UN-Nachhaltigkeitsziele
Annika Kramer, Elsa Semmling und Dr. Sabine Blumstein
adelphi reseach gGmbH 32 WELLE – Wasserfußabdruck für Unternehmen - Lokale Maßnahmen in Globalen Wertschöpfungsketten
Email: [email protected]
36 WANDEL – Wasserressourcen als bedeutende Faktoren der Energiewende auf lokaler und globaler Ebene
Tel: +49 (30) 8900068 – 0
Fax: +49 (30) 89 000 68 - 10
THEMENFELD: STEUERUNGSKOMPETENZ IM WASSERSEKTOR
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Trust – Trinkwasserversorgung in prosperirenden Wassermangelregionen nachhaltig, gerecht und öko-
Förderkennzeichen: 02WGR1420
40 logisch verträglich – Entwicklung von Lösungs- und Planungswerkzeugen zur Erreichung der nachaltigen
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt Entwicklungsziele am Beispiel der Region Lima/Peru
bei den Autoren der einzelnen Beiträge.
44 STEER – Erhöhung der Steuerungskompetenz zur Erreichung der Ziele eines integrierten Wassermanagements
Die Broschüre ist nicht für den gewerblichen Vertrieb bestimmt.
48 iWaGSS – Entwicklung und Erprobung eines innovativen Wassergovernancesystems
Erschienen im September 2017 zur Auftaktveranstaltung der
BMBF-Fördermaßnahme GRoW. 52 go-CAM – Implementierung strategischer Entwicklungsziele im Küstenzonenmanagement
Graphisches Konzept und Layout:
Marina Piselli, Studio Grafico
Druck:
Druckhaus Berlin-Mitte 56 Kontaktdaten der Verbundpartner
Foto Titelseite: ©Suriya99/Shutterstock
3
Die BMBF-Fördermaßnahme GRoW
Hintergrund und Ziele Wasser sind lokale und regionale Wasserressourcen und
Wassersysteme heute global vernetzt. Die verschiedenen
Bevölkerungswachstum, Klimawandel und Trinkwasser- Verbundvorhaben forschen daher nicht nur an lokalen und
mangel machen den nachhaltigen Umgang mit der regionalen Lösungen, sondern erarbeiten dazu auch verbes-
Ressource Wasser weltweit zu einer der größten Herausfor- serte globale Informationen und Prognosen zu Wasserres-
derungen des 21. Jahrhunderts. Als Beitrag zur Lösung der sourcen und Wasserbedarf.
entstehenden Konflikte rund um das „blaue Gold“ hat das
BMBF auf Basis der Agenda 2030 die Fördermaßnahme
„Globale Ressource Wasser (GRoW)“ ins Leben gerufen. Struktur der Fördermaßnahme
Im Jahr 2016 wurden die Unsicherheiten im Wassersektor von Das BMBF fördert im Rahmen von GRoW 12 Verbundprojekte
führenden Wirtschaftsvertretern als das größte globale Risiko und ein Vernetzungs- und Transfervorhaben, die sich in dieser
der kommenden 10 Jahre eingestuft. Zwei Drittel der Weltbe- Broschüre vorstellen.
völkerung leben schon heute in Gebieten, in denen sie
mindestens in einem Monat pro Jahr Wasserknappheit erfah- Jedes Verbundprojekt besteht aus mehreren Teilprojekten
ren. Denn die natürlichen Vorräte an sauberem Wasser und Arbeitspaketen, in denen die Verbundpartner aus Wissen-
erschöpfen sich schneller als sie erneuert werden können. schaft, Wirtschaft und Praxis miteinander die Projektaktivitä-
Diese Übernutzung der globalen Wasserressourcen führt zu ten umsetzen und zu den übergeordneten Zielsetzungen der
Konflikten, die nur durch eine effiziente Nutzung gelöst Fördermaßnahme beitragen. Die inhaltlichen Schwerpunkte
werden können, mit der sich die Lebensbedingungen in den der Verbundprojekte können den drei folgenden Themenfel-
betroffenen Regionen verbessern. dern zugeordnet werden:
Die Vereinten Nationen haben der globalen Bedeutung der 1. Globale Wasserressourcen
Ressource Wasser in der Agenda 2030 für Nachhaltige
2. Globaler Wasserbedarf
Entwicklung Rechnung getragen und eigens das Nachhaltig-
keitsziel 6 (SDG 6) formuliert: „Verfügbarkeit und nachhaltige 3. Steuerungskompetenz im Wassersektor
Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle
gewährleisten“. Das SDG 6 sieht vor, dass bis 2030 alle Das Vernetzungs- und Transfervorhaben „GRoWnet“, umge-
Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bzw. geeigneten setzt von adelphi, begleitet die GRoW Forschungsaktivitäten.
Sanitärsystemen erhalten und wassergebundene Ökosyste- GRoWnet zielt darauf ab, Synergien zwischen den Forschungs-
me gleichzeitig als natürliche Lebensgrundlagen erhalten projekten nutzbar zu machen, die Umsetzung der entwickel-
oder aufgewertet werden. ten Ansätze zu befördern und die Gesamtwirkung der Förder-
maßnahme zu verstärken.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) leis-
tet mit der Fördermaßnahme „Globale Ressource Wasser Darüber hinaus wird ein Lenkungskreis aus den Verbundkoor-
(GRoW)“ als Teil des BMBF-Rahmenprogramms „Forschung für dinator/innen sowie externen Vertreter/innen aus Wirtschaft
nachhaltige Entwicklung (FONA)“ einen Beitrag zum Erreichen und Praxis eingerichtet, der als Schnittstelle zwischen For-
des SDG 6. Mehr als 90 Institutionen aus Wissenschaft, Wirt- schung und Praxis fungiert und dem direkten Wissensaus-
schaft und Praxis sind in der Maßnahme mit verschiedenen tausch dient. Gemeinsam mit dem Lenkungskreis wird
Verbundprojekten beteiligt und entwickeln neue Ansätze für GRoWnet Empfehlungen erarbeiten, wie die Relevanz der
eine Steigerung der Steuerungskompetenz im Wassersektor. Forschungsprojekte für die Umsetzung der SDGs und für die
Flüsse sollen auch in Zukunft ausreichend Wasser für Kennzeichnend für die Fördermaßnahme ist die Verknüpfung Anwendungspraxis gestärkt werden kann.
Mensch und Natur führen: Beispiel Victoria Falls des von lokalem und globalem Handeln. Denn in Zeiten des welt-
Sambesi an der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe; weiten Wirtschaftsaustausches kommen zu den Bedürfnissen
Foto: Vadim Petrakov / Shutterstock der Menschen vor Ort auch die Bedürfnisse der Menschen am
anderen Ende der Welt: Durch den Handel mit virtuellem
4 5
GRoW Verbundprojekte
Geographische Bezüge der GRoW-Verbundprojekte
(cid:26)
THEMENFELD: MedWater THEMENFELD:
GLOBALE Nachhaltige Bewirtschaftung poli- STEUERUNGSKOMPETENZ
FRANKREICH DEUTSCHLAND MONGOLEI
WASSERRESSOURCEN tisch und ökonomisch relevanter IM WASSERSEKTOR
(cid:26) (cid:31) (cid:28) (cid:24) (cid:23) (cid:22) (cid:21) (cid:19) (cid:21)
Wasserressourcen in hydraulisch,
klimatisch und ökologisch hochdyna-
(cid:31) (cid:22)
ViWA mischen Festgesteinsgrundwasser- Trust
VirtualWaterValues – Multiskaliges leitern des Mittelmeerraumes Trinkwasserversorgung in prosper- USA PORTUGAL SPANIEN ITALIEN CHINA
Monitoring globaler Wasserressourcen Verbundkoordination: irenden Wassermangelregionen (cid:24) (cid:24) (cid:21) (cid:26) (cid:24) (cid:24)
und Optionen für deren effiziente Prof. Dr. Irina Engelhardt, nachhaltig, gerecht und ökologisch
und nachhaltige Nutzung TU Berlin verträglich – EntwicKlung von
Verbundkoordination: Lösungs- und Planungswerkzeugen
Prof. Dr. Wolfram Mauser, zur Erreichung der nachaltigen
LMU, München THEMENFELD: Entwicklungsziele am Beispiel der
GLOBALE Region Lima/Peru
WASSERBEDARF Verbundkoordination:
(cid:30)
SaWaM Christian León,
Saisonales Wasserressourcen- Universität Stuttgart
(cid:25)
Management in Trockenregionen: InoCottonGRoW
Praxistransfer regionalisierter globa- Innovative Impulse zur Verringerung
(cid:21)
ler Informationen des Wasser-Fußabdrucks der globalen STEER
Verbundkoordination: Baumwoll-Textilindustrie in Richtung Erhöhung der Steuerungskompetenz
Prof. Dr. Harald Kunstmann, UN-Nachhaltigkeitsziele zur Erreichung der Ziele eines
KIT, Garmisch-Partenkirchen Verbundkoordination: integrierten Wassermanagements
Dr. Frank-Andreas Weber, Verbundkoordination:
RWTH Aachen Prof. Dr. Claudia Pahl-Wostl,
(cid:29)
GlobeDrought Universität Osnabrück
ein globalskaliges Werkzeug zur
(cid:24)
Charakterisierung von Dürren und WELLE
(cid:20)
Quantifizierung ihrer Wirkungen auf Wasserfußabdruck für Unternehmen iWaGSS
Wasserressourcen, die Produktivität - Lokale Maßnahmen in Globalen Entwicklung und Erprobung eines
WESTAFRIKA IRAN
im Pflanzenbau, den Handel mit Nah- Wertschöpfungsketten innovativen Wassergovernance-
(cid:30) (cid:30)
rungsmitteln sowie den Bedarf an Verbundkoordination: systems
internationaler Nahrungsmittelhilfe Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, Verbundkoordination:
Verbundkoordination: TU Berlin Prof. Dr. Karl-Ulrich Rudolph,
PD Dr. Stefan Siebert, IEEM gGmbH, Witten
Universität Bonn PALÄSTINENSISCHE
(cid:23)
WANDEL
PERU MAROKKO SIMBABWE TÜRKEI PAKISTAN GEBIETE
(cid:19)
Wasserressourcen als bedeutende go-CAM (cid:22) (cid:23) (cid:29) (cid:25) (cid:19) (cid:25) (cid:26)
(cid:28)
MuDak-WRM Faktoren der Energiewende auf loka- Implementierung strategischer
Multidisziplinäre Datenakquisition als ler und globaler Ebene Entwicklungsziele im Küstenzonen-
Schlüssel für ein global anwendbares Verbundkoordination: management
ECUADOR CHILE BRASILIEN SÜDAFRIKA SUDAN ISRAEL INDIEN
Wasserressourcenmanagement Prof. Dr. Joseph Alcamo, Verbundkoordination: Prof. Dr.
(cid:18) (cid:24) (cid:30) (cid:28) (cid:23) (cid:19) (cid:29) (cid:24) (cid:21) (cid:20) (cid:19) (cid:18) (cid:26) (cid:24)
Verbundkoordination: Universität Kassel Hans Matthias Schöniger, TU
Dr. Ing. Stephan Fuchs, Braunschweig
KIT, Karlsruhe
(Stand: August 2017)
6 7
ViWA
ViWA
– Virtualwatervalues – Multiskaliges Monitoring Globa-
ler Wasserresourcen und Optionen für deren Effiziente und
Nachhaltige Nutzung mitteln zu berücksichtigen. ViWA will dazu beitragen dies zu Wirtschaft und Gesellschaft mit den Projektwissenschaftlern
ändern, indem lokale Knappheit und (In-)Effizienz einberech- forciert. Dies erfolgt durch: 1) Co-Design: Projekt-Entwicklung,
net werden und so Hot-Spots identifiziert und Handelsanreize Tool-Entwicklung; 2) Co-Creation: Szenario-Entwicklung und
geschaffen werden können, um diese zu reduzieren. 3) Co-Dissemination: Anwendung, Auswertung, Nutzung.
Kurzfassung:
Kernziel von ViWA ist die Entwicklung innovativer Instrumente Arbeitsschwerpunkte: AP2: Globale Beobachtung und Simulation
zur effizienten und nachhaltigen Nutzung der globalen der Wasserflüsse, Erträge und Wassernut-
• Aufbau und Fortschreibung einer globalen Datenbasis
Wasserressourcen in der Landwirtschaft. Über ein hochaufge- zungseffizienzen
für agro-hydrologische Simulationen
löstes Monitoring- und Managementsystem auf Basis von
Ansprechpartner:
• Anpassung des agro-hydrologischen Simulationsmo-
Satelliten-Fernerkundungsdaten werden aktuelle Wassernut-
Prof. Dr. Wolfram Mauser (LMU)
dells PROMET für die Nutzung auf High Performance
zungseffizienzen, Erträge und virtuellen Wasserflüsse der
Computing Infrastrukturen Beteiligte Projektpartner:
wichtigsten gehandelten Agrargüter global und in Pilotregio-
HZG-GERICS, UFZ, VISTA, LRZ
• Aufbereitung und Nutzung der aktuellen Sentinel-2 Zeit-
nen simuliert. Die Ergebnisse dienen dazu, mit einem „compu-
serien für 150 globale landwirtschaftliche Testgebiete Kurzbeschreibung:
table general equilibrium“ (CGE) Modell den Weltagrarhandel
AP 2 umfasst die globale Simulation von Wasserflüssen, dem
zu simulieren, die Auswirkungen nachhaltiger Wassernutzung • Ensemble-Simulationsrechnungen mit PROMET und
ViWA
Ertrag und der Wassernutzungseffizienz durch Kombination
auf die Wohlfahrt wasserarmer und wasserreicher Regionen MODFLOW für globale Wasserflüsse, Ernteerträge und
von satellitengestützter Beobachtung mit Simulationen des
mit Szenarien abzubilden und die Vulnerabilität von Landwirt- Wassernutzungseffizienz unter Nutzung von Zeitserien von
Laufzeit: hydrologischen Landoberflächenprozessmodells PROMET auf
schaft und Ökosystemen gegenüber Klimavariabilität zu Fernerkundungsdaten und meteorologischer Antriebe
01.05.2017 – 30.04.2020 der lokalen (Verifikationsskala), regionalen (Beobachtungsska-
bewerten. An identifizierten „Hot-spots“ werden Trade-offs
• Wasserbilanzsimulationen in ausgewählten Flussein-
la) und globalen Skala (Modellskala). Des Weiteren werden
zwischen der Nutzung von Wasserressourcen für wirtschaftli-
zugsgebieten
Koordinator: Simulationen von Pilotenzugsgebieten (u.a. Donau, Sambesi)
che Zwecke und dem Schutz von Ökosystemleistungen
• Kopplung der Simulation der virtuellen Wasserflüsse,
Prof. Dr. Wolfram Mauser mit PROMET und MODFLOW sowie eine großskalige Validie-
erfasst und Nachhaltigkeitsszenarien untersucht. ViWA basiert
Wassernutzungseffizienzen und landwirtschaftlicher
Lehrstuhl für Geographie und geographische rung mit MhM vorgenommen.
auf einem transdisziplinären Forschungsansatz, bei dem nati-
Erträge mit dem Angewandten CGE Modell DART-WATER
Fernerkundung, Department für Geographie,
onale und internationale Stakeholder in einem Co-Design
Fakultät für Geowissenschaften • Modellierung der Wasserknappheit AP3: Gekoppelte Modellierung von realen
Prozess eingebunden sind.
Ludwig-Maximilians-Universität München / LMU und virtuellen Wasserflüssen
• Identifikation von Hot- und Cold-Spots der Wassernutzung
Tel.: +49 89 2180 – 6674 Relevanz: Ansprechpartnerin:
• Untersuchung von Szenarien für Handelsanreize zur
E-Mail: [email protected]
Dr. Ruth Delzeit (IfW)
lokalen Steigerung der Wassernutzungseffizienz in der
Eine wachsende Weltbevölkerung lebt mit im Wesentlichen
Landwirtschaft Beteiligte Projektpartner:
konstanten und damit zunehmend knappen Wasserressour-
Partnerinstitutionen:
LMU, UFZ
cen. Dabei wird ein Großteil des grünen und blauen Wassers • Bewertung der Nachhaltigkeit der globalen landwirt-
· Institut für Weltwirtschaft (Kiel) / IfW
(92-99%) von der Landwirtschaft genutzt. Die globalisierte schaftlichen Wassernutzung Kurzbeschreibung:
· Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
Wirtschaft bewegt daher durch den internationalen Handel Virtuelle Wasserflüsse stellen das Informationsinstrument dar,
Leipzig / UFZ • Simulation von natürlicher Variabilität von Wasserflüs-
mit Nahrungsmitteln große Mengen an virtuellem Wasser – auf dessen Basis die Nachhaltigkeit und Effizienz der globalen
· Leibnitz Universität Hannover / LUH sen, Ertrag und Wassernutzungseffizienz
dem Wasser, das benötigt wird, um Nahrungsmittel zu produ- Wassernutzung beobachtet und bewertet wird. Die Modellie-
· Helmholtz-Zentrum Geesthacht / HZG – GERICS
· Bayerische Akademie der Wissenschaften, zieren. Grundsätzlich kann der globale Handel von Nahrungs- Arbeitspakete und Projektstruktur: rung virtueller Wasserflüsse erfolgt in drei Schritten: 1) Weiter-
mitteln regionale Auswirkungen auf die Umwelt mindern, entwicklung und Kalibrierung des CGE-Models DART zu
Leibniz Rechenzentrum (München) / LRZ
· VISTA Geoscience Remote Sensing GmbH indem er wassereffiziente und wassernachhaltige Nahrungs- AP1: Stakeholderdialog und Koordination: DART-WATER; 2) Identifikation und Quantifizierung von inter-
(München) / VISTA mittelproduktion fördert. Bisher fehlt jedoch ein globales Co-Design – Co-Production – Co-Dissemination nationalem Handel mit virtuellem Wasser und 3) Modellie-
System, das in der Lage ist die aktuelle nachhaltige und effizi- rung von KnAPpheitsmaßen für regionale Wasserressourcen.
· FLOW gGmbH Meerbusch / FLOW
Ansprechpartner:
ente Nutzung der Wasserressourcen auf regionaler und loka-
Prof. Dr. Wolfram Mauser (LMU) AP4: Governance von Wasserressourcen und
ler Ebene zu quantifizieren und diese Informationen in die
Webseite:
Beteiligte Projektpartner: SDGs, Hot-Spots nicht-nachhaltiger Wasser-
Modelle von virtuellen Wasserströmen zu integrieren. Damit
http://ViWA.geographie-muenchen.de/de/
UFZ, HZG-GERICS LRZ, FLOW nutzung
ist es derzeit nicht möglich, die lokale Knappheit und die (In-)
Effizienz, mit der Wasser zur Herstellung von Agrargütern Kurzbeschreibung: Ansprechpartnerin:
verwendet wird, beim internationalen Handel mit Nahrungs- In AP1 wird die Zusammenarbeit der Stakeholder aus Politik, Prof. Dr. Christina von Haaren (LUH)
8 8 9
ViWA
Beteiligte Projektpartner:
lungsoptionen für eine zukünftig nachhaltigere Nutzung
LMU, VISTA, IfW der Wasserressourcen systematisch zu untersuchen. Diese Teilprojekte Arbeitsschwerpunkte
Kurzbeschreibung: Arbeitspakte umfassen: 1) Untersuchung der Vulnerabilität
In AP4 werden die realen und virtuellen Wasserflüsse und von Wassernutzung; 2) Simulation von Optionen für ein global
Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Geographie Projektkoordination
deren Governance vor dem Hintergrund der wasserbezoge- effizientes und nachhaltiges Wassermanagement und 3) Be- und geographische Fernerkundung, Department für Geographie,
Ensemblemodellierung, Szenarien
nen SDGs untersucht. Mit den Daten aus AP2 werden unter wertung der Ergebnisse. Fakultät für Geowissenschaften
Simulation Wasserhaushalt in den Pilot-
Nutzung der von der UN vorgeschlagenen SDG-Indikatoren Prof. Dr. Wolfram Mauser, PD Dr. Tobias Hank, regionen, Szenarien
Zielkonflikte bei der Erreichung der SDGs Ernährungssicher- Dr. Christoph Heinzeller
Assimilation von Satellitendaten in die
heit (SDG 2), Wasser (SDG 6), Bioenergie (SDG 7), Klimaschutz Modellierung
Fallstudien:
(SDG 13) und Schutz von Ökosystemen (SDG 15) identifiziert
Identifikation von Hot- und Cold-Spots
und unter Einbeziehung der Stakeholder bewertet. Dies Die Auswahl der Pilot-Einzugsgebiete/-Regionen
erfolgt durch: 1) Nachhaltigkeitsbewertung; 2) Räumliche erfolgt derzeit gemeinsam mit den Projektpart-
FLOW gGmbH Meerbusch Planung, Koordination und Durchführung
Identifikation von Hot-Spots und Cold-Spots und 3) Identifika- nern und Stakeholdern. Die Pilot-Einzugsgebiete des Stakeholderprozesses
Stefanie Jörgens, Fritz Barth
tion von institutionellen Hindernissen. werden auf Basis der Kriterien Ausdehnung (104-
107 km²), Wasserkonflikte, Diversität und Daten-
AP5: Entwicklung, Simulation und Analysen grundlage in der ersten Projektphase vorselektiert. Institut für Weltwirtschaft (IFW) Kiel Entwicklung und Umsetzung von Kopp-
lungsansätzen der Modelle DART-WATER
von Szenarien zu nachhaltiger Wassernut- Die zur Auswahl stehenden Fallstudien umfassen Prof. Dr Gernot Klepper, Dr. Ruth Delzeit
und PROMET
zung die Flusseinzugsgebiete Sambesi, Omo, Donau,
Szenarien
Missouri, Fraser, Volta, Weißer Nil, Gelber Fluss,
Ansprechpartner:
Yangtse, Murray-Darling, Oranje sowie Parana. Die
Prof. Dr. Wolfram Mauser (LMU) Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ Simulation der Wasserbilanzen für ausge-
Einzugsgebiete der Donau und des Sambesi sind
Leipzig wählte globale Einzugsgebiete Kopplung
Beteiligte Projektpartner:
bereits gesetzt, eine weitere Testregion vor allem von PROMET und MODFLOW
IfW, LUH, HZG-GERICS Prof. Dr. Sabine Attinger
für die Validierung der Erträge, bildet der Freistaat
Kurzbeschreibung:
Sachsen.
AP5 besteht aus drei Unterarbeitspaketen, welche darauf Leibnitz Universität Hannover, Institut für Umwelt- Bewertung der Nachhaltigkeit und Bestim-
planung mung von hot-spots
abzielen die Trade-offs unterschiedlicher realistischer Hand-
Prof. Dr. Christina von Haaren
Helmholtz-Zentrum Geesthacht - Zentrum für Entwicklung und Nutzung downgescaleter
Material- und Küstenforschung, Climate Service Center Germany meteorologischer Inputs
(GERICS)
Prof. Dr. Daniela Jacob, Dr. Andreas Hänsler
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Leibniz Supercomputing Parallelisierung von PROMET für einen
Center (LRZ) Einsatz auf SuperMUC,
Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller, Dr. Anton Frank Durchführung der Ensemble-Simulationen
am LRZ
Definition von Datenhaltungsstrukturen
VISTA Geoscience Remote Sensing GmbH, München Prozessierung von Fernerkundungsdaten
und Ableitung landwirtschaftlicher und
Dr. Heike Bach
nicht landwirtschaftlicher Umweltparameter
Assimilation von Fernerkundungsdaten in
PROMET als Grundlage für den Aufbau eines
globalen Monitoring-Systems für die Wasser-
nutzungseffizienz
10 11
SaWaM
SaWaM
– Saisonales Wasserressourcen-Management in
Trockenregionen: Praxistransfer regionalisierter globaler Infor-
mationen
nagement eingesetzt werden können. Zudem steht die saiso- WP2 – Globale und regionale Ökosystem-
nale Vorhersage der Wasserverfügbarkeit im Vordergrund. modellierung: Zustandserfassung und
Denn während die Klimaforschung seit vielen Jahren versucht, Funktionalität
Kurzfassung: Aussagen für Klimabedingungen und das langfristige mittlere
Ansprechpartnerin:
Wasserdargebot abzuleiten (z.B. RCP Szenarien bis 2100), ist
Dr. Anita Bayer (KIT)
Ziel von SaWaM ist die Entwicklung von Methoden und Werk-
bei der praktischen Steuerung von Stauseen oder in der
zeugen, mit denen regionalisierte globale Informationen Beteiligte Projektpartner:
Bewässerungslandwirtschaft die Kenntnis der kommenden
praxisorientiert für das Wasserressourcenmanagement nutz- GFZ, TUB
Saison von weit größerer Bedeutung.
bar gemacht werden. Als zentrales Produkt wird in enger
Kurzbeschreibung WP2:
Kooperation mit deutschen Wirtschaftspartnern und lokalen
Arbeitsschwerpunkte: In WP2 werden die verfeinerten hydrometeorologischen
Stakeholdern ein Prototyp eines Online-Tools zur Entschei-
Daten zur Ökosystemmodellierung genutzt. Hieraus können
dungsunterstützung für das regionale Wassermanagement • Räumliche Verfeinerung der globalen saisonalen
Größen wie beispielsweise der Wasserbedarf eines Ökosys-
entwickelt. Der Fokus liegt hierbei auf semi-ariden Zielregio- Vorhersagen und globalen retrospektiven Vorhersagen
tems, aber auch Ernteerträge ermittelt werden, die sich insge-
nen, die aufgrund von begrenzter Wasserverfügbarkeit, durch dynamische und statistische Verfahren
samt unter dem Begriff Ökosystemleistungen zusammenfas-
SaWaM zunehmender Sedimentation von Stauseen sowie Häufung • Ökosystem- und Hydrosystemmodellierung sen lassen. Durch die Berücksichtigung der Unsicherheits-
und Intensivierung von Dürreperioden auf ein nachhaltiges,
spannen aus WP1 sowie unterschiedlich aufgelösten Oberflä-
• Satellitenbasiertes Monitoring von wichtigen
effizientes und an regionale Bedürfnisse angepasstes Manage-
Laufzeit: cheninformationen aus der Satelliten-Erdbeobachtung soll
hydrologischen Kenngrößen in Nahe-Echtzeit
ment angewiesen sind. So wird SaWaM die Leistungsfähigkeit
1.3.2017 – 29.2.2020 der Einfluss von Unsicherheiten in Antriebsdaten auf die
• Entwicklung und Praxistransfer eines Online-Tools zur
der entwickelten Methoden in ausgewählten Einzugsgebie-
modellierten Größen untersucht werden.
Visualisierung und weitergehenden Analyse der Projek-
Koordinator: ten im Sudan, Iran, Brasilien, Ecuador und Westafrika untersu-
tergebnisse als Entscheidungsunterstützung für das
Prof. Dr. Harald Kunstmann chen. Durch dieses breite Spektrum an Testregionen wird eine
WP3 – Regionale Hydrosystemmodellierung
Wassermanagement
Karlsruher Institut für Technologie / KIT Übertragbarkeit auf weitere Gebiete nach der Projektlaufzeit
und Wassermanagement
Campus Alpin, Institut für Meteorologie und gewährleistet. Der zeitliche Horizont liegt für die wasserwirt-
Klimaforschung / IMK-IFU schaftliche Bemessung auf der Retrospektive (bis zur Gegen- Arbeitspakete (WPs) und Projektstruktur Ansprechpartner:
Abteilung Regionales Klima und Hydrologie wart), und für das operationelle Management auf den Prof. Dr. Axel Bronstert (UP)
WP1 – Globale und regionale Hydrometeoro-
Tel.: +49 8821 183 208 kommenden 1-12 Monaten. Dabei kommen Modelle im
Beteiligte Projektpartner:
logie: Modellsysteme, Regionalisierung und
Email: [email protected] Bereich der saisonalen Klimavorhersage, des Wasserhaushalts,
UFZ, US
fernerkundungsgestützte Methoden
des Sedimenteintrags und des Ökosystemzustands zum
Kurzbeschreibung WP3:
Partnerinstitutionen:
Einsatz, ergänzt durch satellitengestützte Methoden. Ansprechpartner:
WP3 befasst sich mit der Hydrosystemmodellierung, also der
· KIT, IMK-IFU, Abteilung Ökosystem-Atmosphäre-
Dr. Christof Lorenz (KIT)
weiteren hydrologischen Verfeinerung der in WP1 abgeleitet-
Interaktionen Relevanz:
Beteiligte Projektpartner:
en Vorhersagen. Im Rahmen einer mehrskaligen Simulations-
· Universität Potsdam / UP
UP, UM, US
Während in ariden Regionen zur Sicherung der Wasserversor- strategie werden zunächst die hydrologischen Komponenten
· Universität Stuttgart / US
gung vielfach auf Entsalzung von Meerwasser oder die Förde- Kurzbeschreibung WP1: aller Zielregionen mit Hilfe eines hydrologischen Modells ab-
· Univesität Marburg / UM
rung fossilen Grundwassers zurückgegriffen werden muss, In WP1 werden die globalen saisonalen Vorhersagen sowie geschätzt. Zur Informationsdetaillierung und Analyse region-
· Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
kann in semi-ariden Regionen mit nachhaltigem und wissen- retrospektive Vorhersagen von Datenzentren wie dem Europe- aler Hotspots wird ein mesoskaliges Modellsystem adaptiert,
Leipzig / UFZ
schaftlich fundiertem Wasserressourcen-Management meist an Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) mit das hydro- und sedimentologische Prozessansätze spezifisch
· Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches
viel erreicht werden. Die Abschätzung des aktuell und künftig verschiedenen dynamischen und statistischen Verfahren räum- für semi-aride Bedingungen implementiert hat. Diese mehr-
GeoForschungsZentrum / GFZ
verfügbaren Wasserdargebots ist hier aber mit besonders lich verfeinert. Durch eine umfassende Validierung soll die Leis- skalige Simulationsstrategie ermöglicht sowohl die flächen-
· Technische Universität Berlin / TUB
hohen Unsicherheiten verbunden. Die Notwendigkeit quali- tungsfähigkeit sowohl der globalen, als auch regional verfeiner- deckende Abbildung der zu erwartenden hydrologischen
· Lahmeyer International GmbH (Bad Vilbel) /
tativ hochwertiger Niederschlags- und Wasserressourcen-In- ten Vorhersagen untersucht werden. Im Vordergrund steht Bedingungen mit den saisonalen Vorhersagen als Randbedin-
Lahmeyer
formationen steht dabei im Gegensatz zum beobachteten hierbei natürlich auch die Ableitung von Unsicherheitsspan- gung in großen Regionen, als auch die managementrelevante
· Gesellschaft für Angewandte Fernerkundung AG
Rückgang von in-situ Messstationen weltweit. Planer und nen, was beispielsweise durch Ensemble-Analysen erfolgt. Des Analyse von Wasser-, Erosions- und Sedimentfragestellungen
(München) / GAF
Entscheidungsträger hoffen daher verstärkt, dass global Weiteren werden Verfahren entwickelt, um aus Satellitendaten und schließlich die Entwicklung eines anwendungsorienti-
Webseite: www.GRoW-sawam.org
verfügbare und regionalisierte Fernerkundungs- und modell- Niederschlag und Abfluss in Nahe-Echtzeit abzuleiten. erten Managementtools für die vorausschauende regionale
basierte Daten in der Zukunft für ein verbessertes Wasserma- Bewirtschaftung der Wasserressourcen.
12 13
SaWaM
WP4 – Anwenderdialog und Entwicklung
eines Online-Prototyps zur saisonalen Teilprojekte Arbeitsschwerpunkte
Fallstudien:
Vorhersage
Ansprechpartner:
Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Meteorologie und
Die Praxistauglichkeit aller Methoden wird in drei
Dipl.-Ing. Berhon Dibrani (Lahmeyer), Klimaforschung
Entwicklungsregionen (Iran, Sudan, Brasilien) im
Dipl.-Ing. Thomas Kukuk (GAF)
Detail getestet. In zwei Perspektivregionen (Ecua-
Beteiligte Projektpartner: dor, Westafrika) werden die generelle Anwendbar- Abteilung Regionales Klima und Hydrologie Projektkoordination & Klimavorhersagen
KIT
keit der Verfahren und ausgewählte Teilaspekte Prof. Dr. Harald Kunstmann, Dr. Christof Lorenz
Kurzbeschreibung WP4: evaluiert. Alle fünf Regionen sind durch eine
In WP4 soll die Praxistauglichkeit der erarbeiteten Methoden ausgedehnte Regenzeit geprägt, während das
in fünf ausgewählte Fallstudien untersucht und sichergestellt restliche Jahr über sehr trockene Bedingungen Abteilung Ökosystem-Atmosphäre-Interaktionen Ökosystemzustand und Leistungsindikato-
ren in Abhängigkeit vom Wasserangebot
werden. Dies erfolgt im Rahmen von Workshops und Schu- herrschen. Gerade in solchen semi-ariden Gebie- Prof. Dr. Almut Arneth, Dr. Anita Bayer
lungen mit Konsortialpartnern und regionalen Stakeholdern. ten ist es wichtig, Abschätzungen über die saiso-
Um die saisonalen Informationen den jeweiligen Nutzern zur nal verfügbaren Wasserressourcen zu machen, um
Universität Potsdam, Lehrstuhl für Hydrologie und Klimatologie Probabilistische Vorhersagen hydrologischer
Verfügung zu stellen, wird ein Prototyp eines Onlineinforma- Maßnahmen des Wassermanagements besser Extreme & hydro-sedimentologische
Prof. Dr. Axel Bronstert
tionssystems entwickelt. Dieser visualisiert relevante Parame- planen zu können. In allen Gebieten bestehen Ansätze
ter für das regionale Wasserressourcenmanagement und stellt bereits Kontakte zu lokalen Forschungseinrichtun-
die Verlässlichkeit der Informationen dar. gen, Firmen und staatlichen Einrichtungen, was
Universität Stuttgart, Geodätisches Institut Echtzeitnahe Ableitung von Abflüssen
sowohl den Austausch von Daten, als auch den und Gesamtwasserspeicher aus aktuellen
Prof. Dr. Nico Sneeuw
Transfer in die Praxis erheblich vereinfacht. Satellitendaten
Universität Marburg, Fachbereich Geographie Echtzeitnahe Ableitung von Niederschlägen
aus aktuellen Satellitendaten
Prof. Dr. Jörg Bendix
Deutsches GeoForschungsZentrum, Sektion Fernerkundung, Räumlich-zeitliche Vegetationsdynamik
Helmholtz-Zentrum Potsdam
Dr. Sigrid Rössner, Dr. Saskia Förster
Helmhotz-Zentrum für Umweltforschungs – UFZ Leipzig, Wasserhaushaltssimulation und saisonale
Department Hydrosystemmodellierung Vorhersage
Prof. Dr. Sabine Attinger, Dr. Luis Samaniego
Technische Universität Berlin, Arbeitsgruppe Ökohydrologie und Vorhersage des pflanzenbenötigten Wassers
Landschaftsbewertung und Geoinformation in der Umweltplanung und des Sedimentationsaufkommens für ein
vorausschauendes Stauseemanagement
Prof. Dr. Eva Paton
Lahmeyer International GmbH Dialog mit Wissenschaft, Partnern und
Stakeholdern / Datenakquise, Datenaufbe-
Berhon Dibrani
reitung und Praxistransfer
Gesellschaft für angewandte Fernerkundung Prototypische Umsetzung des Online-
informationssystems
Thomas Kukuk
Übersicht über die vier SaWaM-Arbeitspakete (WP1-4) und deren Interaktionen; Quelle: SaWaM-Konsortium
14 15
Globe Drought
GlobeDrought
– Ein globalskaliges Werkzeug zur Charak-
terisierung von Dürren und Quantifizierung ihrer Wirkungen
auf Wasserressourcen, die Produktivität im Pflanzenbau, den über Variablen und Dürreindikatoren hinweg. Insbesondere Modul 1: Analyse von Dürreereignissen,
werden Kausalzusammenhänge bei der Entstehung und Ableitung von Dürrerisiken auf globaler
Handel mit Nahrungsmitteln sowie den Bedarf an internatio-
Entwicklung von Dürren und Zusammenhänge zwischen den Skala und Identifizierung zusätzlicher regio-
unterschiedlichen Ausprägungen von Dürren (meteorologi- naler Dürreereignisse
naler Nahrungsmittelhilfe
sche, hydrologische und agronomische) sowie sozioökonomi-
Ansprechpartnerin:
sche Faktoren bislang unzureichend beschrieben. Diese Lücke
Prof. Dr. Petra Döll (GU)
will das Projekt durch die Entwicklung eines integrierten
Beteiligte Projektpartner:
Kurzfassung: Dürreinformationssystems schließen. Mit dem zu entwickeln-
UB-IGG, UB-INRES, UB-ZFL, UNU-EHS
den experimentellen Frühwarnsystem strebt das Projekt
Ziel von GlobeDrought ist die Entwicklung eines web-basier-
Kurzbeschreibung:
insbesondere an, die Zeitspanne zwischen satellitengestütz-
ten Informationssystems zur umfassenden Charakterisierung
In Modul 1 werden durch die Anwendung zweier globaler
ter Datenerhebung, dem Erkennen des Dürrerisikos und
von Dürreereignissen. Im Rahmen des Projektes soll eine
Modelle sowie durch Analyse relevanter globaler Fernerkun-
entsprechenden Gegenmaßnahmen politischer Entschei-
räumlich explizite Beschreibung von Dürrerisiken durch
dungsdatensätze Dürreereignisse auf globaler Skala im Zeit-
dungsträger sowie Akteuren der internationalen humanitären
Betrachtung der Komponenten Dürregefahr, Exposition und
raum 2003-2015 analysiert, die Verwundbarkeit mittels sozi-
Hilfe zu verkürzen.
Verwundbarkeit erfolgen. Dazu werden die Auswirkungen
oökonomischer Indikatoren räumlich explizit abgeschätzt
von Dürren auf Wasserressourcen, die Produktivität im Pflan-
Arbeitsschwerpunkte: und durch Integration dieser Informationen das Dürrerisiko
zenbau, den Handel mit Nahrungsmitteln, und den Bedarf an
ermittelt. Basierend auf diesen Erkenntnissen werden in
internationaler Nahrungsmittelhilfe untersucht. Methodisch • Analyse historischer Dürreereignisse sowie Ableitung
Zusammenarbeit mit Nutzern und Stakeholdern weitere
strebt das Projekt eine Verknüpfung von satelliten-gestützter von Dürrerisiken auf globaler Skala
GlobeDrought ausgeprägte regionale Dürreereignisse für die detaillierten
Fernerkundung und der Analyse von Niederschlagsdaten mit
• Detaillierte Analyse von Dürreereignissen und Dürrerisi- Untersuchungen in Modul 2 ausgewählt.
hydrologischer Modellierung und Ertragsmodellierung an.
ken für ausgewählte Regionen
Laufzeit:
Dadurch werden Indikatoren zur Charakterisierung von mete-
• Analyse von Dürrewirkungen für ausgewählte Regionen Modul 2: Detaillierte Analyse ausgewählter
1.8.2017 – 31.7.2020
orologischen, hydrologischen und agronomischen Dürren
sowie auf Handelsflüsse von Nahrungsmitteln regionaler Dürreereignisse
erstellt, die die Quantifizierung von Dürregefahren ermögli-
Koordinator: • Erstellung und Testen des integrierten Dürreinformati- Ansprechpartner:
chen. Die Analyse sozioökonomischer Daten ermöglicht die
PD Dr. Stefan Siebert onssystems Dr. Fabrice Renaud (UNU-EHS)
Quantifizierung von Exposition und Verwundbarkeit. Im
Universität Bonn, Institut für Nutzpflanzenwissen-
Rahmen eines Co-Designprozesses nehmen Nutzer und Beteiligte Projektpartner:
schaften und Ressourcenschutz / UB-INRES Arbeitspakete (Module) und Projektstruktur
Stakeholder Einfluss auf die inhaltliche sowie technische UB-IGG, UB-ZFL, GU, UB-INRES
Tel.: +49 228 73 2881
Gestaltung des Dürreinformationssystems. Die im Projekt Modul Z: Projektkoordination, Wissenstrans- Kurzbeschreibung:
Email: [email protected]
geplanten globalskaligen Analysen werden durch detaillierte- fer, Zielgruppenbindung, Öffentlichkeitsar- Modul 2 umfasst eine detaillierte Untersuchung ausgewählter
re Analysen für stark von Dürren betroffene Regionen, insbe- beit regionaler Dürreereignisse (ca. 4-6), durch Assimilierung von
Partnerinstitutionen:
sondere für die Region des Südlichen Afrika, ergänzt.
Fernerkundungsdaten in prozessbasierte Modelle und
Ansprechpartner:
· Universität Bonn, Institut für Geodäsie und
genaue Analyse der sozioökonomischen Folgen der Dürreer-
PD Dr. Stefan Siebert (UB-INRES)
Geoinformation / UB-IGG
Relevanz: eignisse. Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten liegt auf
· Universität Bonn, Zentrum Für Fernerkundung Beteiligte Projektpartner:
der Validierung der in die Dürreanalysen eingeflossenen
der Landoberfläche / UB-ZFL UNU-EHS
In Zeiten von Dürren stehen Wasserressourcen in nicht ausrei-
Ergebnisse auf globaler und regionaler Skala.
· Universität der Vereinten Nationen, Institut für
chender Menge zur Verfügung. Wassermangel hat dann oft Kurzbeschreibung:
Umwelt und menschliche Sicherheit (Bonn) /
negative Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produkti- Modul Z umfasst die Projektkoordination, die Kommunikation
Modul 3: Erstellung eines webbasierten
UNU-EHS
vität und damit verbundenen sozioökonomischen Faktoren - mit relevanten Stakeholdern (Entscheidungsträgern und
Dürreinformationssystems und Evaluierung
· Goethe-Universität Frankfurt am Main / GU
wie verringerten Einkommen und Nahrungsmittelknappheit, Nutzern des Informationssystems), den Wissenstransfer sowie
seiner Funktionalität
· Remote Sensing Solutions GmbH (Baierbrunn) /
bis hin zu Hungerkatastrophen. Operationelle Dürrefrühwarn- eine adäquate Öffentlichkeitsarbeit über die gesamte Projekt-
RSS Ansprechpartner:
systeme versuchen hier anzusetzen, beschränken sich aller- laufzeit hinweg. Darüber hinaus werden der Projektfortschritt,
· Deutsche Welthungerhilfe e.V. Bonn / WHH Dr. Jonas Franke (RSS)
dings zumeist auf eine Charakterisierung des Ist-Zustands die Organisation regelmäßiger Statusseminare der Projekt-
oder bieten begrenzte Prognosen für die Dürreentwicklung in partner, die Außendarstellung des Projektverbundes sowie Beteiligte Projektpartner (verantwortlich für einzelne Arbeits-
naher Zukunft, z.B. der nächsten 3-6 Monate. Es fehlt diesen die inhaltliche Vernetzung zwischen den einzelnen Projekt- pakete):
Frühwarnsystemen jedoch weitgehend an einer Integration partnern sichergestellt. UB-IGG, UNU-EHS
16 17
GlobeDrought
Kurzbeschreibung:
Zentrales Ziel von Modul 3 ist die Erstellung eines webbasier- Teilprojekte Arbeitsschwerpunkte
Fallstudien:
ten Dürreinformationssystems, das globalskalige Informatio-
nen zu Dürren sowie Informationen zu den untersuchten Eine bereits definierte Zielregion für detaillierte
regionalen Dürreereignissen zur Verfügung stellt. Damit die regionale Analysen ist die Region des Südlichen Universität Bonn Projektkoordination
Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz Ertragsmodellierung
im Projekt für ausgewählte Regionen und Dürreereignisse Afrika. Historische Dürreereignisse lassen sich hier
Auswirkungen agronomischer Dürren
PD Dr. Stefan Siebert
durchgeführten Analysen (Modul 2) von späteren Nutzern für basierend auf Daten des globalen hydrologischen
andere Regionen wiederholt werden können, wird eine dafür Modells WaterGAP, GRACE-Schwerefelddaten und
nötige Datenbasis durch Modellläufe des hydrologischen durch zurückliegende Maßnahmen der humanitä- Institut für Geodäsie und Geoinformation Meteorologische Dürren
Modells WaterGAP unter Assimilierung von Gesamtwasser- ren Nothilfe bereits identifizieren. Zudem beste- Datenassimilierung Hydrologie-Modell
Prof. Dr. Jürgen Kusche
(regional und global)
speicheränderungen aus GRACE-Schwerefelddaten mit nun hen gute Kontakte der Projektpartner zu Institutio-
globaler Abdeckung geschaffen. Des Weiteren wird die globa- nen in der Zielregion, die eine Implementierung
Zentrum für Fernerkundung der Landoberfläche Fernerkundung
le Datenbank mit sozioökonomischen Dürreindizes erweitert, des Dürreinformationssystems in der Region
Datenassimilierung Ertragsmodell
sodass Zeitreihen für die Indikatoren vorliegen. unterstützen können. Weitere Regionen für Fall- Dr. Olena Dubovyk
studien werden in Zusammenarbeit mit Nutzern
und Stakeholdern in Modul 1 ausgewählt.
Goethe-Universität Frankfurt am Main Hydrologische Modellierung
Institut für Physische Geographie, Abteilung Hydrologie Modellkopplung
Prof. Dr. Petra Döll
Universität der Vereinten Nationen Indikatorbasierte Ermittlung von Dürre-
Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit risiken Wissenstransfer
Dr. Fabrice Renaud
Remote Sensing Solutions GmbH Satellitenfernerkundung
Aufbau des Dürreinformationssystems
Dr. Jonas Franke
Deutsche Welthungerhilfe e.V. Validierung der ermittelten Dürrerisiken
Einbindung von Stakeholdern
Dr. Daniel Rupp
Graphische Übersicht der Struktur und Interaktion der Arbeitspakete (Module); Quelle: GlobeDrought Konsortium
18 19
Description:Ergebnisse innovativ in einem Web-GIS dargestellt und nutz- bar gemacht. Relevanz: Die Transformation des Energiesektors kann durch die enge.