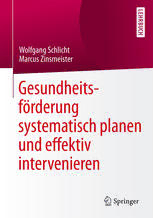Table Of ContentWolfgang Schlicht
Marcus Zinsmeister
Gesundheits-
förderung
systematisch planen
und eff ektiv
intervenieren
Gesundheitsförderung systematisch planen
und effektiv intervenieren
Wolfgang Schlicht
Marcus Zinsmeister
Gesundheitsförderung
systematisch planen
und effektiv
intervenieren
Wolfgang Schlicht Marcus Zinsmeister
Sport- und Gesundheitswissenschaften Fakultät für Gesundheit & Soziales
Universität Stuttgart Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kempten
Stuttgart, Deutschland Kempten, Deutschland
ISBN 978-3-662-46988-0 ISBN 978-3-662-46989-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-46989-7
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrück-
lich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbe-
sondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne
besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und
Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in
diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die
Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes,
etwaige Fehler oder Äußerungen.
Planung: Marion Krämer
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
(www.springer.com)
V
Vorwort
„Every generation got its own disease“, so besingt „Fury in the Slaughterhouse“ die Suche nach
dem Sinn des Lebens der Generation X während der 1990er-Jahre. Jeder historische Zeitab-
schnitt kennt also seine „passenden“ Erkrankungen, und zu jeder Zeit suchten Menschen
nach geeigneten Mitteln und Maßnahmen, sich drohender Erkrankungen zuvorkommend zu
erwehren. Einige Präventionsempfehlungen, wenn nicht viele davon, transportierten sozial ge-
teiltes Erfahrungswissen, andere den Glauben an übersinnliche Mächte und Riten, mit denen
man sich die Mächte gewogen machen wollte. Bakterielle Infektionen verliefen noch in den
1920er-Jahre – bis zur Entdeckung des Penicillins durch den schottischen Bakteriologen Al-
exander Fleming – nicht selten tödlich. Im Mann’schen Roman Buddenbrooks, der allerdings
Mitte des 19. Jahrhunderts spielt, stirbt Senator Thomas Buddenbrook an einem vereiterten
Backenzahn. Die Katastrophe eskaliert nach einem missglückten zahnärztlichen Eingriff.
Mit der zunehmenden Technisierung und Mechanisierung der Arbeits- und Lebenswelt
bedrohen Herz-Kreislauf- (zum Beispiel koronare Herzerkrankungen) und Stoffwechseler-
krankungen (zum Beispiel Diabetes Typ 2) die Bevölkerung. Um diese nicht ansteckenden
Erkrankungen zu verhindern, bedarf es der Änderung einer riskanten Lebensweise – mit
fettreicher und zuckerhaltiger Ernährung, wenig Bewegung und dauerhaftem Stillsitzen – und
einer sie stützenden Umwelt. Aktuell scheinen seelische Störungen auf dem Vormarsch, sie
bedingen Arbeitsausfall und Leiden der Betroffenen. Termindruck, stetige Verfügbarkeit und
prekäre Arbeitsverhältnisse (zum Beispiel Zeitverträge) werden unter anderem als Ursachen
benannt. Eine ausgewogene Balance von stressender Beanspruchung und achtsamer Entspan-
nung scheinen hier die präventiven Mittel der Wahl.
Und in Zukunft? Man braucht keine prophetischen Fähigkeiten, um vorherzusagen, dass –
trotz aller säkularer positiver Trends – altersassoziierte Erkrankungen (zum Beispiel Demen-
zen, einige Krebsarten) die kommenden Jahrzehnte bestimmen werden. Die Menschen in den
hochentwickelten Ländern leben länger. Der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung
wächst. Ein kognitiv und körperlich aktives Leben könnte das Erstauftreten altersassoziierter
Erkrankungen nach hinten, auf wenige Jahre vor dem Tod verschieben.
Der Ausbau der kurativen und pflegerischen Versorgung ist vor dem Hintergrund zukünftiger
Entwicklungen sicher wichtig. Beides alleine wird aber weder reichen, noch wird es bezahlbar
sein, um auf das zukünftig veränderte Krankheitsgeschehen zu reagieren. In Deutschland
gehen bereits heute mehr als 11 % des Bruttoinlandsprodukts zulasten von indirekten und
direkten Gesundheitskosten. Mit 96 % verschlingt die kurative und rehabilitative Versorgung
den Großteil der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Prävention und Gesundheits-
förderung sind zwingend geboten, und sollen sie nicht nur Geld kosten, dann müssen sie
wirksam gestaltet sein.
Aber wie arbeitet Prävention, wie funktioniert Gesundheitsförderung so, dass mit ihr die
gewollten Zwecke erreicht werden? Sind Plakataktionen, die auf Bluthochdruck und andere
Gefahren aufmerksam machen oder für Safer Sex und Nichtrauchen werben, das Vorgehen
der Wahl? Ist Wissensvermittlung entscheidend? Was bewirken Furchtapelle auf Zigaretten-
packungen? Sind Änderungen der Ernährungs- und Aktivitätsgewohnheiten die Lösung?
VI Vorwort
Wenn sie es sind, wie gelingen sie? Muss doch eher die Umwelt geändert werden (zum Beispiel
Ampelsymbole für Lebensmittel, bauliche Maßnahmen, um Radfahren und Zufußgehen zu
erleichtern und interessant zu machen), statt dass Personen sich mühen, ihre riskanten Ge-
wohnheiten abzulegen, und dabei häufig kläglich scheitern? Vermutlich muss alles zugleich
geschehen, weil Störungen und Erkrankungen das Ergebnis eines komplexen Wirkungsgefüges
von Umweltbedingungen und personalen Faktoren sind.
Als Gesundheitswissenschaftler und wissenschaftliche Berater von präventiven Kampagnen
und gesundheitsfördernden Initiativen konnten wir ein ums andere Mal erleben, dass die an-
gedeutete Komplexität nicht nur herausfordert, sondern die Akteure regelrecht bedroht: Wie
anfangen, was tun, wie weiter, wen einbeziehen, warum dies und nicht das, wie rechtfertigen,
wer kann das – diese und noch viele weitere Fragen plagen die Akteure. Sie suchen Antwor-
ten bei einschlägigen wissenschaftlichen Disziplinen. Ohne sich in Details zu verlieren, die
der jeweiligen Situation angemessene Antworten liefern, gilt nach unserem Dafürhalten und
allgemein: Systematisches Vorgehen ist eine notwendige Bedingung, wenn nicht sogar die
Conditio sine qua non für ein erfolgreiches präventives Handeln.
Aus unserer – im einen Fall langjährigen – Tätigkeit als Hochschullehrer, als Forscher und
wissenschaftliche Berater von Präventionskampagnen und gesundheitsfördernden Initiativen
in der Bevölkerung, in Betrieben und in Kommunen konnten wir erfahren, wie weit sich der
Bogen der erforderlichen Kenntnisse und Techniken spannt, um dem Anspruch eines syste-
matischen Vorgehens gerecht zu werden.
Ohne Navigation können sich Studierende und Akteure der Prävention und Gesundheitsför-
derung dort leicht verirren. Sie können die Motivation verlieren, sich noch weiterhin Gedan-
ken zu machen, wie sie aus dem unübersichtlichen Gelände wieder herausfinden. Sie lassen
sich dann dort nieder, wo es ihnen angenehm erscheint, oder tappen plan- und ziellos durch
das Gelände und machen es halt so, wie man es schon immer gemacht hat. Ein „Durchwursch-
teln“ und „One-size-fits-all-Denken“ ist nicht gerade selten in Präventions- und Gesundheits-
förderungskampagnen. Navigation hilft, sich in einer Topographie zu orientieren und den
gewünschten Ort zu erreichen. Navigieren braucht Werkzeuge und basiert auf Methoden. Da
beginnt die nächste Herausforderung für Gesundheitswissenschaftler/innen und -förderer/
innen. Das World Wide Web und die Literatur sind voll von Empfehlungen und Erfahrungs-
berichten. Aber es fällt schwer, deren Güte zu beurteilen. „Selbstgestricktes“ dominiert die
Empfehlungen.
Ein Lehrbuch, das die wesentlichen Fakten zusammenfasst, kann im doppelten Sinne navigie-
ren helfen. Einmal, weil die Fakten gebündelt in nur einem Werk angesprochen und erläutert
werden. Zum anderen, weil auf die Komplexität der Herausforderungen von Prävention und
Gesundheitsförderung mit jenen Elementen geantwortet wird, die ein systematisches Vorge-
hen ausmachen. Das sind jene Elemente, die wissenschaftlich fundiert und ethisch legitimiert
sind.
Lesen hilft, und Bücher sind dazu immer noch ein geeignetes Medium. Das gilt trotz der
technischen Medien, die auch die Hochschulen inzwischen erobert haben und die – etwa wie
die Massive Open Online Courses – als methodisches und didaktisches Heilsversprechen an-
gepriesen werden. Bücher, davon sind wir nach Jahrzehnten der Lehre an Hochschulen noch
immer überzeugt, tragen zur Mehrung des Wissens bei.
VII
Vorwort
Was liegt bei einer solchen Haltung näher, als ein eigenes Buch zu schreiben und das aufzu-
schreiben, was uns all die Jahre in Forschung und Lehre bewegt hat und von dem wir über-
zeugt sind, dass Prävention und Gesundheitsförderung davon profitieren.
Am Ende eines Schreibprozesses sagen wir danke: den Studierenden, die mit ihren Nachfragen
einem immer mal wieder die blinden Flecken der eigenen Argumentation aufgezeigt haben,
unseren Mitarbeiter/innen, die unseren Arbeitsalltag kritisch begleiten und ohne die wir zur
empirischen Feldforschung nicht in der Lage wären, und nicht zuletzt den beiden Ansprech-
partnerinnen im Lektorat des Springer Verlags, Frau Alton (Projektmanagement) und Frau
Krämer (Programmplanung), die uns mit Anregungen und Rat zur Seite standen.
Schreiben ist ein Handwerk, manches Mal ist es mühsam. Aber es hat immer auch Spaß
gemacht!
Wolfgang Schlicht und Marcus Zinsmeister
Stuttgart und Kempten im April 2015
Inhaltsverzeichnis
1 Mach einen Plan! ......................................................................1
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
1.1 Wann planen passend ist ................................................................2
1.1.1 Pläne ohne Richtung, Märsche ohne Plan ..................................................2
1.1.2 Pläne, die zum Erfolg führten .............................................................4
1.2 Unsicherheit ............................................................................5
1.2.1 Probabilistische Vorhersagen .............................................................5
1.2.2 Varianten von Unsicherheit in der sozialen Welt ............................................5
1.3 Komplexe Probleme – komplexe Interventionen ........................................8
1.3.1 Komplexe Probleme .....................................................................10
1.3.2 Komplexe Interventionen ................................................................13
1.3.3 Systematisches Vorgehen ................................................................14
Literatur ................................................................................16
2 Entscheiden ..........................................................................19
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
2.1 Das „Bauchhirn“: Was ist dran? .........................................................20
2.1.1 Was Rosamunde Pilcher dazu sagt ........................................................20
2.2 Zwei Denkmodi ........................................................................21
2.2.1 Intuitiv entscheiden: Fehler und Fallen ...................................................22
2.2.2 Erfahrung und Zuverlässigkeit ...........................................................23
2.3 Unbegrenzte oder doch nur begrenzte Rationalität ....................................25
2.4 Entscheidungsvarianten und -techniken ...............................................28
2.4.1 Techniken des heuristischen Entscheidens ................................................29
2.4.2 Techniken des rationalen Entscheidens ...................................................31
Literatur ................................................................................39
3 Interventionsabsicht: Gesundheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
3.1 Alle kennen, alle wollen sie – kaum jemand kann sie definieren ........................42
3.2 Prävention und Gesundheitsförderung .................................................43
3.3 Gesundheit ist mehrdimensional .......................................................47
3.4 Die Rolle der Experten .................................................................49
Literatur ................................................................................51
4 Vorannahmen und Beweise .........................................................53
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
4.1 Ist alles nur graue Theorie? .............................................................54
4.2 Theorieorientiert und evidenzbasiert ..................................................56
4.2.1 Kriterien systematischer Intervention .....................................................57
4.2.2 Realist Synthesis ........................................................................62
IX
Inhaltsverzeichnis
4.3 Paradigmata ...........................................................................64
4.3.1 Theoretische Orientierung schaffen ......................................................64
4.3.2 Sozial-ökologisches Paradigma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Literatur ................................................................................68
5 „Praktische“ Theorien, Modelle und Ansätze .....................................71
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
5.1 Geeignete Programmtheorien ..........................................................72
5.2 Personale Determinanten des gesunden Verhaltens ....................................72
5.2.1 Health Action Process Approach .........................................................73
5.2.2 Transtheoretisches Modell ...............................................................74
5.2.3 Einstellungen und geplantes Verhalten ...................................................76
5.3 Organisationale Gesundheitsförderung ................................................77
5.3.1 Stadienmodelle des organisationalen Wandels ............................................78
5.4 Welche Theorie für welchen Zweck? ....................................................85
Literatur ................................................................................87
6 Messen, bewerten, beschreiben, informieren .....................................89
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
6.1 Evaluieren ..............................................................................90
6.1.1 Evaluationstypen ........................................................................91
6.2 Welche Evaluationsmethode zu welchem Anlass? ......................................96
6.2.1 Methoden ..............................................................................97
6.3 Drei Evaluationsmodelle ..............................................................101
6.3.1 CIPP ...................................................................................101
6.3.2 Theory-Driven Evaluation ...............................................................101
6.3.3 Constructivist Evaluation (Fourth Generation Evaluation) .................................104
Literatur ...............................................................................106
7 Gesundheitsförderung im Setting ................................................109
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
7.1 Was sagt die WHO dazu? ..............................................................110
7.2 Kommunen und Betriebe ..............................................................111
7.2.1 Kommunale Gesundheitsförderung .....................................................111
7.3 Betriebliche Gesundheitsförderung ...................................................120
7.3.1 Betriebliche Gesundheitsförderung ist noch kein betriebliches Gesundheitsmanagement ..121
Literatur ...............................................................................126
8 Planungsmodelle ...................................................................129
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
8.1 Modelle unterstützen das Planen ......................................................130
8.2 Tun oder lassen: PABCAR hilft entscheiden ............................................133
8.3 Sich Klarheit verschaffen: PRECEDE/PROCEED .........................................135
8.4 Umfassende Planungsmodelle ........................................................138
8.4.1 GTO, PREFFI, PMG ......................................................................138
8.4.2 Intervention Mapping: das derzeit elaborierteste Planungsprotokoll ......................140
8.5 Logic Modelling .......................................................................141
X Inhaltsverzeichnis
8.6 Stakeholder-Analyse ..................................................................145
8.7 PREMIT: Beispiel einer Matrixstruktur zur Intervention in das Aktivitäts- und
Ernährungsverhalten ..................................................................147
Literatur ...............................................................................149
9 Verhalten ändern: Techniken und Werkzeuge ....................................151
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
9.1 Verhalten und Verhaltensdetermination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
9.2 Zentrale Konstrukte des Verhaltens ...................................................154
9.2.1 Motive .................................................................................154
9.2.2 Überzeugungen ........................................................................154
9.2.3 Normen und Werte .....................................................................156
9.2.4 Wissen .................................................................................156
9.2.5 Absicht und Verhalten ..................................................................156
9.2.6 Gewohnheiten .........................................................................157
9.2.7 Fehltritte und Rückfälle .................................................................158
9.3 Von der Theorie zur Praxis .............................................................158
9.3.1 Techniken und Methoden ...............................................................158
9.3.2 Behaviour Change Wheel ...............................................................159
9.4 Umwelt ermöglicht, Umwelt behindert ................................................160
Literatur ...............................................................................162
10 Kommunizieren: Social Marketing ................................................165
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
10.1 Rede drüber! ..........................................................................166
10.1.1 Kernseife und Brüderlichkeit ............................................................166
10.1.2 Kommunikation ........................................................................166
10.1.3 Kommunizieren ........................................................................167
10.1.4 Was und wie kommunizieren? ...........................................................168
10.2 Merkmale des Social Marketings ......................................................170
10.2.1 Verhalten ändern – mehr als verkaufen ..................................................170
10.2.2 Das Wohl der „Konsumenten“ im Auge haben ............................................171
10.2.3 Markt und Wettbewerb .................................................................171
10.3 Strategien und Determinanten ........................................................172
Literatur ...............................................................................174
11 Lageorientierung ...................................................................175
Wolfgang Schlicht, Marcus Zinsmeister
11.1 Bedarf und Bedürfnisse ...............................................................176
11.2 Den Bedarf einschätzen ...............................................................177
11.2.1 Epidemiologische Daten ................................................................178
11.2.2 Subjektive Daten .......................................................................182
11.2.3 Objektive Umweltdaten ................................................................183
Literatur ...............................................................................184