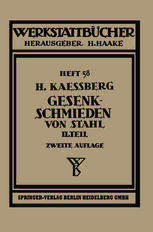Table Of ContentWERKS TATrBÜCH ER
Ft1R BETRIEBSANGESTELLTE, KONSTRUKTEURE UND FACH
ARBEITER. HERAUSGEGEBEN VON DR.-ING. H. HAAKE, HAMBURG
Jedes Heft 50-70 Seiten stark, mit zahlreichen Textabbildungen
Die Wer k s tat t b ü c her behandeln das Gesamtgebiet der Werkstatts
technik in kurzen selbständigen Einzeldarstellungen: anerkannte Fachleute
und tüchtige Praktiker bieten hier das Beste aus ihrem Arbeitsfeld, um ihre
Fachgenossen schnell und gründlich in die Betriebspraxis einzuführen.
Die Werkstattbücher stehen wissenschaftlich und betriebstechnisch auf der
Höhe, sind dabei aber im besten Sinne gemeinverständlich, so daß alle im
Betrieb und auch im Büro Tätigen, vom vorwärtsstrebenden Facharbeiter bis
zum leitenden Ingenieur, Nutzen aus ihnen ziehen können.
Indem die Sammlung so den Einzelnen zu fördern sucht, wird sie dem Betrieb
als Ganzem nutzen und damit auch der deutschen technischen Arbeit im
Wettbewerb der Völker.
Einteilung der bisher ersehienenen Hefte nach Faehgebieten
I. Werkstoffe, HiHsstoffe, HiHsverfahren HeU
Der Grauguß. 3. Aun. Von Chr. Gilles •.•••................................... 19
Einwandfreier Formguß. 3. Aufl. Von E. Kothny (Im Druck) .................... . 30
Stahl-und Temperguß. 3. Aufl. Von E. Kothny (Im Druck) ••.................... 24
Die Baustähle für den Maschinen- und Fahrzeugbau. Von K. Krekeler ............. . 75
Die Werkzeugstähle. Von H. Herbers .......................................... . 50
Nichteisenmetalle I (Kupfer, Messing, Bronze, Rotguß). 2. Auf!. Von R. Hinzmann .. 45
n
Nichteisenmetalle (Leichtmetalle). 2. Aufl. Von R. Hinzmann •••••.•••....•.•••• 53
Härten und Vergüten des Stahles. 5. Aun. Von H. Herbers ..•.................... 7
Die Praxis der Warmbehandlung des Stahles. 6. Aufl. Von P. Klostermann (Im Druck). 8
Elektrowärme in der Eisen-und Metallindustrie. Von O. Wundram ••••••••••.•.••• 69
Brennhärten. 2. Aufl. Von H. W. Grönegreß •••••••••••••.•••••................ 89
Die Brennstoffe. 2. Auf!. Von E. Kothny (Im Druck) ........................... . 32
Öl im Betrieb. 2. Auf!. Von K. Krekeler •••.•.•.•••............................. 48
Farbspritzen. 2. Aufl. Von R. Klose .•••••................................... '" 49
Anstrichstoffe und Anstrichverfahren. Von R. Klose ••.•••.•.................... lO3
Rezepte für die Werkstatt. 5. Aufl. Von F. Spitzer .............................. . 9
Furniere-Sperrholz-Schichtholz I. 2. Aufl. Von J. Bittner ..•................... 76
Furniere-Sperrholz-Schichtholz n. 2. Aufl. Von L. Klotz •..•.•••••...•...•... 77
n.
Spangebende Formung
Die Zerspanbarkeit der Werkstoffe. 3. Aufl. Von K. Krekeler ••..••••••••.••••••• 61
Hartmetalle in der Werkstatt. Von F. W. Leier.................................. 62
Gewindeschneiden. 5. Auf!. Von O. M. Milller •••................................ 1
Wechselräderberechnung für Drehbänke. 6. Aufl. Von E. Mayer .................. 4
Bohren. 4. Aufl. Von J. Dinnebier............................. . . . . . .. . .... . . . • 15
Senken und Reiben. 4. Aufl. Von J. Dinnebier . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . • . . • • • . . • . . • • 16
Innenräumen. 3. Aufl. Von A. Schatz ••••••••••.•..••••.•...••••••••••••.•••••• 26
(Fortse&ung 3. U mschlagseilf)
••
WERKSTATTBUCHER
FÜR BETRIEBSANGESTELLTE, KONSTRUKTEURE UND FACH
ARBEITER. HERAUSGEBER DR.-ING. H. HAAKE, HAMBURG
================== ==================
HEFT 58
Gesenkschmieden
von Stahl
Von
Dr.-Ing. Hugo Kaessberg
Wetzlar
Zweiter Teil
Die Gestaltung der Schmiedewerkzeuge
Z W e i t e, neubearbeitete Auflage
(7. bis 12. Tausend)
Mit 255 Abbildungen im Text
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
Inhaltsverzeichnis.
Seite
1. Gestaltung der Werkzeuge fiir die einzelnen Arbeitsgănge unter Be
riicksiehtigung der Masehinenart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Arbeiten unter Hammer und Presse ................ 3
1. Schneiden S.3. - 2. Spalten S.4. - 3. Rollen S.7. - 4. Biegen S.7. -
5. Lochen S.14. - 6. Pressen und Ziehen S.20. - 7. EHRHARDT-Verfahren
S. 22. - 8. Spritzen S.23. - 9. Richten und Kalibrieren S. 26. - 10. Stauchen
S.27.
B. Arbeiten in der Schmiedemaschine ................. 28
11. Die Arbeitsweise der Schmiedemaschine S. 28. - 12. Regeln fiir das Stauchen
in der Sehmiedemaschine S. 30. - 13. Die kegelige Vorform S. 32. - 14. Stauchen
von Kopfen S. 33. - 15. Dornen und Lochen S. 35. - 16. Schlitzen von Kopfen
S.38. - 17. Trennen S.38. - 18. Spritzen im Gesenk S. 39. - 19. Biegen im
Gesenk S. 39. - 20. Schwei13en S. 40. - 21. Stauchen von Rohren S.41.
C. Arbeiten mit sonstigen Maschinen ................. 41
22. Schmiedewalze S. 41. - 23. Ringwalze S. 42. - 24. Abgratpresse S. 42. -
25. Kaltschmiedepresse S. 46.
II. Die Abmessungen der Schmiedewerkzeuge ............... 47
A. Gesenkblocke ............................ 48
26. Gesenkblockhohe S. 48. - 27. Gesenkblockbreite S.49. - 28. Gesenkblock
lănge S.49.
B. Einsatzgesenke ............................ 49
C. Abmessungen der Abgratschnittplatten ........... 50
29. Lănge der Schnittplatte S. 50. - 30. Breite der Schnittplatte S. 50. -
31. Dicke der Schnittplatte S.50.
D. Abmessu:n.gen des Stempels 51
III. Die Befestigung der Schmiedewerkzeuge 52
A. Die Befestigung der Gesenke . . . . . . . . . . . . . .. 52
32. Befestigung durch Schrauben S. 52. - 33. Befestigung durch Keile S. 53.
B. Die Befestigung der Gesenkhalter .................. 55
34. Gesenkhalter als Trăger von Einsatzgesenken S. 55. - 35. Gesenkhalter zur
Befestigung kleinerer Gesenke S.56. - 36. Gesenkhalter als Hohenausgleieh S. 59.
C. Die Befestigung der Abgratwerkzeuge ............... 59
37. Schnittplatten S. 59. - 38. Stempel S.61.
Alle Rechte, insbesondere das der Ubersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.
ISBN 978-3-540-01592-5 ISBN 978-3-642-86856-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-86856-6
J. Gestaltung der Werkzeuge für die einzelnen Arbeitsvorgänge
unter Berücksichtigung der Maschinenart.
A. Arbeiten unter Hammer und Presse.
1. Schneiden. Das Schneidwerkzeug zum Ablängen von Werkstoff ist meist ein
einfaches Messer oder ein Führungsschnitt unter Schere oder Presse, auch wird der
Rohstoff vielfach mittels Kalt- oder Warmsäge in Stücke :lierteilt. Dabei rechnet
man :liU dem Gewicht des fertigen Schmiedestückes den Abbrand-, Beiz-, Schnitt-
und Abgratverlust. Wichtig ist oft eine gerade Schnitt- -l
fläche, die auf schlechten Scheren schwer zu erreichen
ist. Das Obermesser der Schere soll genügend schräg
sein und womöglich am Untermesser einseitig oder
doppelt geführt werden (Abb. 1). Das obere Messer darf
natürlich in seinen Seitenführungen im Ständer nicht c_
wackeln. Der Neigungswinkel der Messer kann für
Warmschneiden um einige Grad größer sein (Abb.2).
Um nicht jede Länge messen zu müssen, namentlich bei
kurzen Stücken, versieht man die Schere mit einem
Abb. 1. Schermesser.
Anschlag. Dieser Anschlag darf nicht fest sein, weil a u. b Führungen.
sonst das abgeteilte Stück sich :liwischen Obermesser
und Anschlag einpressen würde. Man macht ihn am besten drehbar, so daß er von
selbst wieder in seine Stellung zurückfällt (Abb. 3). Den Drehpunkt b befestigt man
unmittelbar am Scherenständer oder, wenn das nicht geht, an einem angeschraubten
Arme; c ist ein Gegengewicht, das den Anschlag gegen den
Stift a drückt. Die Anschlagplatte d führt man als Kreisbogen
mit dem Mittelpunkt b aus, denn beim schnellen Vorschub
kommt es vor, daß der Anschlag nicht schnell genug zurück
fällt; dann dient jeder Punkt der Oberfläche von d demselben
Zweck. Der Drehpunkt b ist in einem waagerechten Schlitz Abb.2. Neigungswinkel
für Schermesser .
für verschiedene Schnittlängen einstellbar.
Beim Kaltschneiden ist besonders darauf :liU achten, ob der Werkstoff sich
dafür eignet. Härterer Stoff bildet oft Überlappungen, die beim Pressen Ausschuß
ergeben. Bei stumpfen oder schlecht geführten SchereJilllessern entstehen Zungen
(Abb. 4 bei Z). An neuzeitlichen Pressen sind
die Messer so eingebaut, daß man einen fast
ebenen und rechtwinkligen Schnitt erhä.lt.
Um beim Schmieden von der Stange das
Schmiedestückab:liutrennen, benutzt man ent
weder eine am Hammer angebrachte Hand
hebel schere (Hackschere), die man auch, mit
dem Hammerhub verbunden oder elektrisch
betrieben, mechanisch wirken lassen kann, Abb.8. Anschlag zum Ablängen. a Anschlag<
stift; b Drehpunkt;c Gegengewlcht;d An
oder eine als Schneidkante ausgebildete Ge schlag platte ; e Befestigungsarm ;
LAbschnittlänge.
senkblockecke (Abb. 5). Man kann auch be
sondere Messer einset:lien, entweder seitlich am Block (Abb. 6) oder stirnseitig
(Abb. 7). Das Verkeilen der Messer ist besser als das Verschrauben. Doch hat sich
Anmerkung: Die erste Auflage dieses Buches ist 1936 erschienen.
1*
4 Gestaltung der Werkzeuge für die einzelnen Arbeitsgänge usw.
auch bewährt, einen verstellbaren Halter für das Untermesser auf der Schabotte
anzubringen (Abb. 8). Solche Messer am Bären sind jedoch nur an Fallhämmern
und an Eriehämmern möglich, da nur mit diesen die erforderlichen leichten
Schläge für das Abhauen gegeben werden können, im
Gegensatz zu BrettfaUhämmern mit immer gleicher Fall
höhe. Im letzten Falle muß die Abschervorrichtung neben
den Hammer gesetzt werden.
Die Rohlinge für das Schmieden unter der Presse sä.gt
man vielfach ab, um genau
rechtwinklige und glatte
I
AbbA. Schnittflächenfehler. Abb. 6. Schneidwerkzeug
I u. Il verschiedene Werkstücke; Abb. 5. Schneidkante am neben Gesenkblock.
Z Zungen. Gesenkblock.
Schnitte z;u erhalten. Bei schief geschnittenen Stücken drückt sich der Dorn in
Richtung p (Abb. 9) z;ur Seite; er kann brechen, zumindest aber werden die Wand
stärken der geschmiedeten Hülsen ungleich, oder das Roh
stück wird im offenen Gesenk einseitig verdrückt.
2. Spalten. Im Bergischen Lande hat man es verstan-
:r--"~ den, sich von der Handwerkskunst des Reckschmiedes frei
L'-___ '~ zu machen, indem man ein klug ausgedachtes System der
Werkstoffz;erteilung mittels Exzenterpressen, "Spalten"
genannt, in Anwendung bringt. Man benutzt grundsätz
Abb ;. Schneid werkzeug lich Werkstoff von flacher Form für die meist flachen kleinen
Vor Gesenkblock. Massenteile, die nach diesem Verfahren hergestellt werden,
wie Messer, Scheren, Zangen, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Kloben usw.
Die Spaltpressen stehen unmittelbar neben dem Rohstofflager, so daß der Werk
stoff - senkrecht aufgestapelt - ohne große Förderkosten gespalten, in Kästen
gepackt und dem Hammer zugeführt werden
kann. Auf dem Pressentisch befindet sich die
Spaltsohle (Abb. 10), in die der Spaltschnitt
eingespannt wird.
Die entfallenden Werk
stücke nennt manSpaltstücke.
Mit Ausnahme von etwas Stan
genendenabfall entsteht kein
Werkstoffverlust. Falls er
Schabotte forderlich, wird beim Spalt
stück z;um Anfassen beim
Sohmieden ein Zangenende
mit angeschnitten (Abb. 11).
Abb. 8. Halter für Untermesser auf s~~~f2~ ~~~~~~. Wie die Abb. 10 u. folg. z;ei-
Schabotte verschiebbar aufgebant
gen, sind die Spaltwerkz.euge
eigentlich besonders geformte Messer, die wie Schnitt und Stempel zusammen ar·
beiten, wobei der Werkstoffstreifen in seitlichen Anschlä.gen geführt und in der
Lä.nge begrenz;t wird (Abb. 12). Die Formen der Spaltschnitte sind sehr viel
gestal tig, doch lassen sich einige Grundformen festlegen:
Arbeiten unter Hammer und Presse. 5
Grundform I. Gerade Spaltf arm (Abb. 13 u. 14). Bei jedem Pressenhub entfällt
ein Stück.
Grundform H. Schräge Spaltf arm (Abb. 15 u. 16). Der Flachstreifen wird
schräg über das aus zwei einfachen Messern bestehende Spaltwerkzeug geführt.
Das Spalts tück zur Herstellung vOn Kom
binationszangenschenkeln wird gebogen und
dann ins Gesenk geschlagen.
Grundform IH. Spaltf arm für vereinigten
Abb.10. Spaltsohle für ~;xzenterpresse. Abb. 11. Sp"ltwerkzeug, Einzelteile.
a Spaltschnittuntert.eil; b Spaltschnitt a Unterteil; bOberteil: c Spaltstüek.
oberteil; c Spaltstück.
geraden und schrägen Schnitt (Abb. 17 u. 18). Bei dieser Form entfallen bei jedem
Pressenhub zwei Stück. Sie dient z. B. auch zur Herstellung vOn Scherenschenkeln.
Spul/s·'t ück
c Hult.h o/RqlJ mtssvn~ JO,,1r6' ---
n
----,O bfrs/~",pe/ si~uc1J;liidr ~eJ1' UnterScllniff
Sei/M '.
IJl/sm/lJg Abb.15. Schräge Spaltform ;
, Draufsicht.
.
Abb.12.
Spaltwerkzeug Abb. 11 ein
gebaut; Schema, Draufsieht.
, !
a~ ,, .
, I
b~
(> l
c~ ,
Abb.13. Gerade Spalt
form. a für Scheiben: b wie
Abb. 11; c für Rachen Abb. 14. Herstellung einer
lehren Abb. 14. Rachenlehre.
Grundform IV. Spaltf arm für einseitige Köpfe (Abb. 19·· ·21) mit Querschnitts
verminderung nach einer Seite. 2 Stück je Hub.
6 Gestaltung der Wer~euge für die einzelnen Arbeitsgänge usw.
Grundform V. Spaltform für Köpfe in Mitte (Abb. 10, 22, 23), brauchbar für
Querschnittsverminderung nach beiden Seiten.
Grundform VI. Spaltf orm für doppelte Köpfe (Abb. 24), z. B. zur Herstellung
von Schraubenschlüsseln (Abb. 25).
9
Abb.20.
Spaltform mit verjüngtem Schaft. Abb.24. Spaltform für dop
pelte Köpfe. Winkel IX gibt
die Schaftbreiten an.
Abb.21.
Spaltform mit verdicktem Schaft.
2 Sspttaic/ltr- a It;' ,'. &~j ' ") ~
b C' ~">~
8>
c
gp
d
Abb.17. Spaltform für ver Abb.22. Spaltform für Kopf in
einigten geraden und schrägen Mitte. a Flachstahlstab : b Spalt
Schnitt. stück; c Setzschlag bringt Schäfte
in Mitte; zugleich Einkneifen;
d Fertigstücke.
Abb.25. Herstellung eines Doppelschranben
schlüssels im Spaltverfahren.
Die drei ersten Grund
formen sind Universal
schnitte und für viele
Zwecke zu gebrauchen, die
übrigen sind Sonderformen ,
Abb. 18. Herstellung eines Exzel die für bestimmte Zwecke
siorschlüsselstieles. aSpaltstück :
b Spaltstück gehoben; c Rohling entwickelt wurden. Das
im Grat
Spalten geht bedeutend
schneller als das Recken,
al&~'%~"/t~ 9 z. B. lassen sich in der
Stunde 2000 Spaltstücke
b~·än??ü NU ,,'
c::::::::;;:::::===:=:=:> für 4" Scherenschenkel aus
C
einer Werkstoffabmessung
d~~~~(» 100 X 20 X 12 mm herstel
len oder 1000 Spaltstücke
Abb.19. Abb.23. für Exzelsiorschlüsselstiele
Herstellung eines Kreszentschlüsscl HerRtellnng eines Tischmessers.
stiels. Spaltstück wirQ vor dem Ge a Spaltstüek; b Kropf und Angel aus 300 X 40 X 13 mm
senkschmieden gebog{'n. a Flachstahl- geschlagen; c Klinge ausge
sta b; b Spaltstück ; c Spaltstück ge schmiedet; d Klinge abgegratet; Flachstahl. Außerdem kann
bogen; d Rohling im Grat. e Angel gelängt. diese Arbeit von ungelern
ten Kräften ausgeführt werden. Ein Nachteil ist, daß die Faser zerschnitten
wird. Bei manchem Schmiedestück ist darauf Rücksicht zu nehmen. Der Werk
stoffverbrauch läßt sich bei diesem Verfahren vorher sehr genau berechnen. Beim
Entwerfen von Spaltschnitten fertigt man zweckmä.ßig zunächst Probespaltstücke
von Hand.
Arbeiten unter Hammer oder Presse. 7
Abb.26 zeigt die Herstellung eines Ringschlüssels nach dem Spaltverfahren
mit anschließendem Gesenkschmieden. Neuere Klingen werden nach Abb. 27
hergestellt (vgl. die alte Form Heft 31, Abb. 98-100).
3. Rollen. Beim Rollen wird das
Arbeitsstück dauernd gedreht, damit
i ~ 1 kein Grat entsteht. Es kommt in Frage
für Vor- und Fertigschmieden bei Stan
gen-oder Stückarbei t. Man kann runde,
kugelige oder polygonale Formen damit
herstellen (Abb. 28, 29 u. 30). Das Rol
Spultstück
(;----:;=========:::::~~ len lediglich als Vorformung hingegen
gestoucht
C===========C>-
~ vorgeschmierJel~
~ ~
...
~ rerl,geSChmiede~
~ ~
...
@g elrx:lJl u.nde .nfgl.'tllele.r Ro.illin+ g @-
Abb.26. Abb.27.
Herstellung eines Ringschlüssels Im Spaltverfahren. Herstellung einer Klinge im Spaltverfahren.
bedeutet ein genaues Recken zwecks genauer Materialzuteilung (Heft 31 Abb. 132).
Rollgesenke werden im Grunde mit dem gewünschten Halbmesser des Stückes
ausgefüDhrt (A bb.31). Alle Krümmungsübergänge müssen tangential verlaufen.
t Schm'lt A-B 4. Biegen. a) Das
.! - ._. Biegen vor dem
Gesenkschmieden.
A bb. 28. Gerollte.
SchmledeetUck; An
Icbwolllkopf fOr GI ... -
anlangel.cn.
c a. •Ab b.31. Rollform.
I [
rr
a I
Abb.29. Rollieeenk fUr einen Olu Abb.32. Biegungsquer'
bllaerplellenkopl. CI Oeoenk; Abb. 30. Herstellung einer Rolle. a Vor· schnitte. I, 11 verschiedene
b lI'erilll8tllck. rollgesenk; b Fertigrollgesenk; c Messer. Profile.
Liegt die Ebene der Biegung senkrecht zur Schlagrichtung, fällt sie also mit der
Teilungsebene des Gesenkes zusammen, wie z. B. in Abb. 14, so biegt man meist
vorteilhafter beim Vorschmieden, um ein Verziehen des sauber geprägten Quer·
schnittes zu vermeiden.
Biegungen in anderen Ebenen werden oft zweckmäßiger nach dem Schlagen
ausgeführt. Wird für ein Werkstück die Teilungsebene für Unter. und Obergesenk
8 Gestaltung der Werkzeuge für die einzelnen Arbeitsgänge usw.
bestimmt, so ist auf seine Biegung Rücksicht zu nehmen und stets die unvorteil
hafteste Biegung in die Teilebene ZU legen. Die unvorteilhafteste Biegung ist aber
diejenige, bei der sich nach dem Schlagen die größte Verformung ergibt. Ist man
nun gezwungen, nach dem Schlagen zu biegen, so ist jedenfalls für diese Biegungs
stelle der elliptische Querschnitt I (Abb.32) dem T- und U-förmigen 11 vorzu-
ziehen. In solchen Fä.llen ist auch stets der
©
gerade Stab I (Abb. 33) an der äußeren Bie
gungskante bei a (11) entsprechend zu ver-
stä.rken, damit die Dicke b trotz des Bie-
~
a. gungsverlustes erhalten
lI ö
bleibt (111 und IV).
Ö
Beispiele. Die Rachen
lehreAbb. 34 kann auf ver
schiedene Weise geschmie
I II m IV det werden. Entweder
wä.hl t man einen Rohstoff
Abb.33. Vorbiegen der Rachenlehre Abb.34.
Verstärkung an der Biegestelle. I, II, III, IV Abb. M. Rachen· von der Breite B, schlägt
Fertigungsstufen.
lehre. ihn unmittelbar ins Gesenk,
gratet die Vorform außen und innen ab und schlägt sie nach, oder man wä.hlt einen
Rohstoff von einer Breite etwas kleiner als b, biegt ihn entweder auf der Biege
maschine oder im Gesenk unter dem Hammer vor (Abb.33) und schlägt diese Vor-
form dann ins Gesenk. Im zweiten Falle
wird viel Rohstoff gespart, allerdings
muß mehr Lohn für das Vorschmieden
gezahlt werden, aber nur scheinbar; denn
man kommt beim Gesenkschmieden mit
weniger Schlägen und meist auch mit ein
mal weniger Entgraten aus, da der Stoff
überschuß geringer ist. Also kann eine
größere Stückzahl ausgebracht werden,
nJ und nebenbei werden Gesenke und Schnitte
IX geschont.
Im anderen Fall, beim Schmieden aus
dem Vollen, macht der Hammer zU der
Abb.36. Vorform des selben Zeit weniger Stücke. Dabei ist die
Drehherzes. a Schwanz;
Abb.35. Drchherz. b Zangenende ; c Kopf; Abgratpresse nicht voll beschäftigt, und
w Wulst. so wird das Stück mindestens ebenso
teuer, dazu werden die teueren Gesenke noch besonders stark beansprucht. Das
gilt jedoch nur für größere Abmessungen der Rachenlehren. Für kleinere lohnt
das Biegen nicht, so daß man doch vorzieht, sie gleich ins Gesenk ZU schlagen.
Drehherz (Abb.35). Aus Rund- oder Flachstange wird zunächst die Form
Abb. 36 vorgeschmiedet, indem der Schwanz a und das Zangenende b unter einem
schnell schlagenden Lufthammer ausgereckt werden und auch der Kopf c abgesetzt
wird. Dann wird das Rohstück ins Vorgesenk geschlagen, wobei der Schwanz zu
nächst gerade bleibt und eine Wulst w (Abb. 36) bekommt, die als Vertiefung im
Untergesenk angebracht ist. Nach dem Abgraten der äußeren Form mit einem üb
lichen Schnittwerkzeug (vgl. Heft 31, Abb.4) wird das Loch mit dem Führungs
schnitt Abb. 37 ausgestoßen und der Schwanz von Hand oder unter der Presse
gebogen (Abb. 38). Dann wird das Drehherz im Fertiggesenk Abb. 39 über den
Dorn geschlagen, dadurch sauber und genau und schließlich nochmals mit dem
Schnitt Abb. 39 abgegratet.
Arbeiten unter Hammer oder Presse. 9
Kurbelwelle für Automobilmotor (Abb. 40). Die dreifach gelagerte Welle besteht
aus legiertem Stahl. Ein Knüppel von quadratischem oder rundem Querschnitt
und berechneter Lä.nge (Abb. 40a) wird zunä.chst im Vorschmiedegesenk Abb. 41
unter der hydraulischen Presse gebogen.
Die Gesenkbacken werden meist mit
Flansch am Preßtisch bzw. am Preß-
Abb.37. Lochwerkzeug lur Drehhef7.. Abb. 3~. Biegevorricht.ung für Drehherz .
holm befestigt. Bei diesem Vorbiegen ist ein Strecken der Wangen und daher eine
Querschnittsverminderung nicht zu vermeiden. Folglich muß der Knüppelquer
schnitt so groß sein, daß die
Wangen nach dem Biegen noch
stark genug sind, um im Ge
senk die richtige Form zu er
geben. Der vorgebogene Roh
stoff wird dann auf die vor
geschriebene Höchsttempera
tur erhitzt und geht in das
Vorgesenk b (Abb. 42). Die
Benutzung dieses kombinier
ten Gesenkes zum Biegen a und
Schmieden b ist bei :Massen- Abb. ~9 . .!>'ertiggesenk und Abgratwerkzeug.
fertigung nur dann üblich,
wenn z. B. nur ein schwerer Hammer zur Verfügung steht; sonst wird viel ein
facher und schneller auf der dampfhydraulischen Presse vorgebogen. Die vorge-
d~+
-4
Abb.40. Herstellung einer Kurbelwelle. Abb.4t. Biegevorrichtung zur Kurbelwelle
a, b, e, d Fertigungsstulen. Abb.l36.
schlagene Kurbelwelle wird jetzt abgegratet (Abb. 43) und meist wieder erwä.rmt,
um einen Schlag in dem Fertiggesenk Abb. 44 zu erhalten. Nach nochmaligem