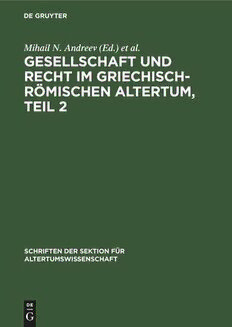Table Of ContentDEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN
SCHRIFTEN DER SEKTION FÜR ALTERTUMSWISSENSCHAFT
5J
GESELLSCHAFT UND RECHT
IM GRIECHISCH-RÖMISCHEN
ALTERTUM
Eine Aufsatzsammlung
herausgegeben von
Mihail N. Andreev, Sofia Elemér Pólay, Szeged
Johannes Irmscher, Berlin Witold Warkallo, Warszawa
Teil 2
AKADEMIE-VERLAG • BERLIN
1969
Redaktor der Reihe: Lukas Richter
Redaktor dieses Bandes: Edmund Piekniewskif
Erschienen im Akademie-Verlag GmbH, 108 Berlin, Leipziger Straße 3—4
Copyright 1969 by Akademie-Verlag GmbH
Lixenznummer: 202 • 100/127/09
Ofsetdruck und buehbinderiMhe Verarbeitung: VEB Druckerei „Thomas Müntzer", 582 Bad Langeiualsa
Bestellnummer: 2067/S2/II - ES i B 2
25,-
Inhaltsverzei chnls
Abkürzungen V
Janos Bir6 (Szeged)
Das Colleglum funeraticlum in Alburno maiore 1
Georg Clulei (Oravlfa)
Gab es einen Einfluß des griechischen Rechts In den
Zwölf tafeln? 21
Vladimir Hanga (OluJ)
Le droit G&to-Dace 47
Johannes Irmscher (Berlin)
Die Bewertung der Prostitution im byzantinischen Hecht. 77
Maria Jaczynowska (Toru6)
L'organisation intérieure des "collegla luvenum" au
temps du Haut-Empire romain 95
Boris iapicki (i6dâ)
L'humanisme Romain et son Influence sur l'évolution du
droit Romain 121
Stanislaw lirozek (Torufi)
Oie Arbeitsverhältnisse in den Goldbergwerken des römi-
schen Dazlens 139
Lesïaw Pauli (Krak&w)
Einflüsse des römischen Rechts im Hauptwerk von Bartho-
lomäus Groicki. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt-
rechtsliteratur und der Rezeption des römischen Rechts
In Polen 157
Vojtèich Polâcek (Praha)
Zur Frage des Gerechtlgkeitsgedankens im Altertum 185
3jina Cojiouohhk (CH»i$eponojii.)
0 KJieüMJieHHH cKOTa h paÖoB b hpcbhoctm 219
H. C. CBeHUHUKaA (UOCKBa)
K Bonpocy o npaBOBOM nonoxemiH paajiHiHux rpynn Hacene-
HIVt 3JIJIHHHCTHieCKOrO IIOJIHCa. 227
III
Abkiirzungen
¿età antiqua Acta antiqua academiae scleriti arum Hungariae,
Budapest
AE Année épigraphique, Paris 1888 ff.
Aegyptus Bivista italiana di egittologia e di papiro-
logia, Milano
BACTH Bulletin archéologique du Comité des travaux
historiques et scientifiques, Paris 1882 ff.
BCH Bulletin de correspondance hellénique
Bruns, Font. Fontes iuris Romani antiqui edidit C. G. Bruns,
septimum edidit Otto Gradenwitz
C Codex Justin!anus
CGF G. Kaibel. Comicorum Graecorum fragmenta,
Berlin 1899
CIL Corpus inscriptionum Latinarum
D. Digesta Justiniani
Dacia Dacia. Revue d'Archéologie et d'Histoire An-
cienne
Eirene Sirene. Studia Graeca et Latina, Praha
FHG C. Miiller, Fragmenta historicorum Graecoum,
2. Auf1., 5 Bde., Paris 1868-1883
Gai Gaius, Institutionum commentarli quattuor
GGM C. Mller, Géographie! Graeci Minores, Paris
1855-1861
I Institutiones Jus tiniani
IG Inscriptiones Graecae
IGI Inscriptiones Graecae insularum maris Aegae!
IGRR Inscriptiones Graecae ad res Romanas perti-
nentes
ILA1 Inscriptions Latines de l'Algérie
JJP Journal of Juristlc Papyrology, Warszawa
IURA Rivista internazionale di diritto romano e
antico, Napoli
LBW P. Le-Bas et Waddington, Inscriptions d'Asie
Mineure, Paris 1870
Materiale Materiale fi cercetari-arheologice, Bucureçti
HDSA Notizie degli scavi di antichità, Roma 1876 ff.
V
Nov. Novellas (Corpus iuris civilis, edltio stéréo-
typé. Berlin III: Novellae rec. R. Schoell,
opus absolvlt G. Kroll)
OGJS Orient!s Gracae inscriptlones selectae, ed.
ff. D1ttenberger
HC C. B. Walles, Royal Correspondence In the Hel-
lenistic Period, New Haven 1934
BE Pauly's Realencyclopädie der classischen Alter-
tumswissenschaft, neue Bearbeitung begonnen von
Georg Wissowa, fortgerührt von Wilhelm Kroll
und Karl Mittelhaus, jetzt herausgegeben von
Konrat Ziegler, Stuttgart
REA Revue des Études Anciennes, Paris
BHD Revue Historique de Droit français et étran-
ger, Paris
BID A Revue Internationale des Droits de l'Antiquité,
Bruxelles
Saeculum Jahrbuch für Universalgeschichte, Freibürg i.Br.
SEG Supplementum epigraphlcum Graecum
SEHHW U. Rostovtzeff, The Economic and Social History
of Hellenistic World, Oxford 1941
SGHI Ii. Todd, Selection of Greek Historical Inscrip-
tions, Oxford 1948
Studii Studii gl cercetârl de istorie veche, Bucureçtl
Syli. Sylloge inscriptlonum Graecorum
SZ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte, Romanistische Abteilung, Weimar
TAM Tituli Aslae llinorls
TR Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Revue d*
histoire du droit, Haarlem
VI
Das Collegium funeratlclum In Alburno maiore
Janos Bir6, Szeged
I. Im antiken Römischen Reich können wir in Bom wie auch in
den eroberten Provinzen mittels zahlreicher Inschriften und ande-
rer Denkmäler als Quellen die Vereine und Körperschaften der Frei-
en, Freigelassene^ und in einigen Fällen auch solche der Sklaven
beobachten. Diese Vereine kamen auf Grund der Initiative von meh-
reren ähnliche Berufe ausübenden oder vom sozialen Gesichtspunkt
aus unter eine gleiche Beurteilung fallenden Personen zur Verwirk-
lichung eines gewisse Privatinteressen verfolgenden Zieles zustan-
de. Die Organisation und Art ihrer Funktionen waren in Statuten
festgelegt, und auf Grand allgemeiner oder spezieller Genehmigun-
gen konnten Rechte erworben und Verpflichtungen übernommen werden.
In den Donauprovinzen des Römischen Seiches sind Körperschaf-
ten von priesterliche Funktionen ausübenden Personen, von Handwer-
kern, Gewerbetreibenden, Steuerpächtern, kleinen Beamten, Bergleu-
ten, Musikanten, Veteranen, Soldaten, von Leuten gleicher Nationa-
lität, in einzelnen Fällen sogar von Sklaven anzutreffen. Es fin-
den sich aber auch Körperschaften von Personen, die selbständiges
Vermögen besaßen, aber an der Ausübung der Macht nicht beteiligt
waren (Freie oder Freigelassene), ja sogar Vereine von Mitgliedern
zugrunde gegangener freier Schichten .
Verarmte Freie, die. unter schweren wirtschaftlichen Verhält-
nissen lebten, und vermögenslose Freigelassene sowie auch Sklaven
haben sich Vereine geschaffen, um durch sie für die Begräbnisko-
sten eine Hilfeleistung (soziale Unterstützung) erhalten zu können
(collegium funeratlclum).
Dieser den Privatinteressen der genannten Personenkreise die-
nende Zweck wurde in der Regel mit der Pflege eines Religionskul-
tes oder mit der Vergöttlichung der Person des Kaisers verbunden.
Die Bestattungsvereine zogen Beitritts- und Mitgliedschafts-
gebühren ein und konnten aus diesen Summen und den von den Patro-
nen dem Kollegium geschenkten Geldern die den Mitgliedern zuste-
henden Bestattungskosten sowie auch die Aufstellung von Grabmälern
1
und die Kosten der gemeinsamen Gelage bestreiten. Im Gebiet des
alten Dazien, in Alburnus maior, findet sich so ein Collegium fu-
neratlcium, dessen Existenz die Wachstafel CIL III 924 beweist.
Die Wachstafel enthält den Namen des Kollegiums und einige
wichtige Daten über die Organisation des Vereins für Bestattung;
sie nennt die Zahl der Mitglieder, gibt Aufschluß über die Rechte
und Pflichten der Mitglieder, läßt auch Folgerungen bez. der Hand-
lungsfähigkeit des Kollegiums und Schlüsse vom Gesichtspunkt der
privatrechtlichen Haftung zu und nennt den Grund der Auflösung des
Kollegiums. Wir haben uns in unserer Studie zum Ziele gesetzt, die
Rekonstruktion dieser Bestattungsvereine so vorzunehmen, da£ man
aus ihr wichtige Schlüsse auf die allgemeine und provinzielle
Rechtsprechung ziehen kann, und trachteten durch Vergleich der
Rechtspraxis des Bestattungsvereins von Alburnus maior mit anderen
in der Rechtspraxis des Reiches bestehenden Statuten die geschicht-
lichen Phasen der Entwicklung der Kollegien darzustellen und wo-
möglich zu erklären.
Auf Grund der oben genannten Wachstafel sollen auch der Cha-
rakter, die Organisation sowie die Rechts- und Handlungsfähigkeit
des Kollegiums analysiert werden.
II. "Descrlptum et recognltum factum ex libello qui proposi-
tus erat Alburno maiorl ad statione Reculi, in quo scriptum erat
Id quod infra scriptum est. Artemidorus Apollinis mag!ster collegi
Jovis Cerneni..." (CIL III 924).
Dem Text der Wachstafel ist zu entnehmen, da£ wir es mit ei-
nem nach Jupiter Cernenus benannten Kollegium zu tun haben, des-
sen wichtigstes Ziel die Sicherung der materiellen Unterstützung
für den Todesfall war, wodurch die Uitglieder des Kollegiums oder
Ihre Angehörigen auf eine nicht unerhebliche Bestattungsbeihilfe
aus der gemeinsamen Kasse rechnen konnten. Wir stehen hier dem We-
sen nach einer für privatrechtliche Zwecke gegründeten Vereinigung
gegenüber, welche zugleich mit einem religiösen Kult verbunden ist.
Vereine mit ähnlichen Zielsetzungen sind auch In anderen Gebieten
2
des Reichs zu finden .
Das collegium funeraticium von Verespatak ist aber deswegen
für uns so bedeutungsvoll, weil es aus dem Anfangsstadium der Ent-
stehung von Bestattungskollegien stammt. Gleichzeitig ist der In-
halt der genannten Wachstafel nach dem Stande der derzeitigen For-
2
schung das einzige rechtshlstorische Denkmal, welches uns auch die
Möglichkeit einer rechtlichen Beurteilung gibt.
Die Untersuchung der Im antiken Dazlen bestehenden Kollegien
läBt darauf schließen, daß Mitglieder dieses Vereins jene vermö-
gensrechtlich selbständigen oder verarmten Freien und Freigelasse-
nen oder ein Sondervermögen besitzenden Sklaven werden konnten, die
sich weder an der Staatsmacht beteiligten, noch Mitglieder der Kör-
perschaften der freien vermögenden Gewerbetreibenden sein durften.
Was die Größe des Dorfes Alburnus maior und den Beruf der dort
lebenden Menschen anbetrifft, dürften die 54 Mitglieder des Kolle-
giums im allgemeinen der Schicht der Lohnarbeiter angehört haben^.
Wenn man die Nationalitätenverhältnisse des Dörfchens Albur-
nus maior unter die Lupe nimmt und die auf den Wachstafeln verzeich-
neten Namen berücksichtigt, muß man feststellen, daß die Mitglieder
des Kollegiums gemischter Herkunft und Nationalität gewesen sein
dürften.
In Dazlen waren außer der verhältnismäßig geringen Zahl römi-
scher Bürger noch Personen griechischer, galatischer, illyrischer
und asiatischer Abstammung vorzufinden.
Aus der Tatsache, daß Mitglieder des Kollegiums griechische
4
und lateinische Namen trugen , können wir eventuell das Vorhanden-
sein des Status für den vollberechtigten römischen Bürger entneh-
men, doch ist - ausgehend vom Beispiel der übrigen dazlschen Kol-
legien - auch festzustellen, daß Freigelassene und Sklaven eben-
falls Mitglieder des Vereins werden konnten. Der Fersonenbestand
des Kollegiums läßt vermuten, daß in Alburnus maior ein nicht all-
zu gut funktionierender Bestattungsverein existierte, denn im Ge-
biete des Römischen Reichs, wie auch in Dazlen, waren Vereine mit
einer Mitgliederzahl von 150-200, ja sogar von 300 Personen keine
Seltenheit. Jene 54 Mitglieder, welche bei der Gründung oder un-
mittelbar danach ins Kollegium eintraten, gehörten nicht zu den
ständig ansässigen Bürger von Alburnus maior, beklagt doch die
Wachstafel, daß die Mitgliederzahl des Kollegiums wegen Abzugs der
Mitglieder auf 17 gesunken sei. Mit einer so kleinen Mitgliederzahl
scheint es sich nicht gelohnt zu haben, die gemeinsame Kasse und
die Organisation aufrechtzuerhalten, da ja die Auflösung des Kol-
legiums aus diesem Grunde erfolgte.
3