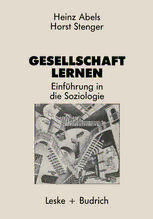Table Of ContentAbels/Stenger
Gesellschaft lemen
Heinz Abels
Horst Stenger
Gesellschaft lernen
Einfiihrung in die Soziologie
+
Leske Verlag Budrich GmbH, Opladen 1986
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Abels, Heinz:
Gesellschaft lemen, Einfiihrung in die Soziologie /
Heinz Abels; Horst Stenger. - Opladen: Leske und Budrich, 1986.
ISBN-13: 978-3-8100-0584-7 e-ISBN-13: 978-3-322-85649-4
DOl: 10.1007/978-3-322-85649-4
NE: Stenger, Horst
© 1986 by Leske Verlag + Budrich GmbH, Leverkusen
TitelgrafIk: M. C. Escher "Relativitiit" (1953).
Mit Genehmigung Cordon Art, De Baam, Niederlande.
Vorwort
Am Ende der Arbeit an einer Einfiihrung stehtdas Vorwort. Man erinnert sich
daran, was man urspriinglich schreiben wollte, und denkt dariiber nach, was man
tatsachlich geschrieben bat. Auf Anhieb fallen einem dann all die Untiefen ~d
Auslassungen ein. Da man nicht alles neu schreiben kann und eine Einfiihrung
nur einen bestimmten Umfung baben kann, tritt man die Flucht nach voman.
Man versucht, der Kritikden Wmd aus den Segelnzu nehmen, indemman selbst
auf die Lucken und Verldirzungen hinweist. Manchmal gelingt es auch, aQgebli
che Widerspruche zwischen Anspruch und Wrrldichkeit als didaktisch gewollt
hinzustellen. Alles in allem sol1en - so oder so - Vorwort und Werkals eine or
ganische Verbindung erscheinen. Das ist der Grund, weshalb Vorworte immer
zum Schlufi geschrieben werden.
Bei einem Vorwort zu einer Einfiihrung in die Soziologie steht ein Autor sieher
nicht vor geringeren Problemen. Wrr, die Autoren dieser Einfiihrung, sind uns
dieser Probleme durchaus bewufit, die Art, wie wir sie glauben gelost zu baben,
vertreten wir ohne Vorbehalt.
Eine Einfiihrung in die Soziologie soIl vor allemneugierig machen. Dieses ~iel
konnte leicht als didaktische Ambition mi.6verstanden werden. Die baben wir si
cher auch. Unser eigentliches Ziel ist aber, Sie neugierig zu machen auf das, was
uns tagtiiglich begegnet. Wir mochten Sie mit einem spezifischen Denkenver
traut machen, das das "Selbstverstandliche" unbefungen von allen Seiten be
trachtet. Das ist der Grund, warum das Thema "Wissen" in dieser Einfiihrung so
oftangesprochen wird. Urnes nab an vertrautenErfahrungenzu plazieren, haben
wir uns mit der Grundfrage "wie wir werden, was wir sind" auseinandergesetzt.
Was den Stil angeht, in dem wir diese Einfiihrung geschrieben baben, so }conn
ten Sie den Eindruck baben, da6 hinter vielen Formulierungen ein personliches
Interesse aufscheint. Dieser Eindruck ist korrekt. Auf diese Weise werden wir
zwar angreitbar, aber wir meinten, da6 Soziologie etwas mit dem konkreten Le
ben - auch unserem - zu tun haben sol1te. Die nachfolgende Passage mOchten
wir denn auch nicht als trotzige Entschuldigung, sondem als Erlauterung fiir die
verstanden wissen, die etwas anderes erwarten oder alles ganz anders gemacht
hatten:
Ein geeignetes Mittel. die Wertgebundenheit zumindest zu verschleiem, ist die
Entwicklung einer Fachsprache, die nur noch von Eingeweihten - und auch dort
nicht selten erst mit Hilfe von Kommentaren und "Materialien" - verstanden
wird. Hier liegt ein Grund fiir die ErschOpfung, mitder nicht nur Studenten der er
sten Semester soziologische Bucher nach den ersten Seiten beiseite legen. Es sind
vor allem zwei Griinde, die das Gefiihl der Entriicktheit soziologischen Denkens
aufkommen lassen: Es fehlt an einem Hinweis auf die Person, die hinter den ab
strakten Formulierungen steht. "Der Ton ist nicht nur unpersoniich, sondem an
mafiend unpersonlich. Bulletins der Regierung oder auch Geschiiftsbriefe werden
5
manchmal in einem solchen Ton geschrieben", polemisiert Mills (1963; S. Z16).
AuBerdem fehltes an konkretenHinweisen, was dieseabstrakteSpracheuberhaupt
beschreiben will. Die Wamung, daB man nie mehr als drei Seiten schreiben sollte,
ohne an ein konkretes Beispiel zu denken (Mills, 1963; S. Tl9), scheinen viele So
ziologen nicht auf sich zu beziehen. Hochschuldidaktisch ist die Forderung nach
einer Verdeutlichung von Problemen an konkreten Beispielen selbstverstindlich,
doch sobald ein Soziologe in die offentliche Diskussion eintritt, gilt diese Forde
rung nicht mehr. Wer sich das klar Machen will, braucht nicht erst die Theoriedis
kussion der letztenJahre nachzulesen, sondem allein den Wechsel der Sprachebe
nenzu beobachten, den Soziologen bei gemeinsamenAuftritten vor Publikum vor
nehmen.
Die gingige Fachsprache der Soziologie hat nicht wenig getan, dem nicht
wissenschaftlichen Leser die "Obertragung abstrakter Brkenntnisse auf konkrete
Brfuhrungen zu erschweren. Bs scheint beinahe so, als ob die Qualitat der Inhalte
durch einen Spezialjargon signaiisiert werden solI. Die Griinde sind zweifellos in
der Orientierung des Soziologenan der akademischen Kommunikation zu suchen,
aus der allein er glaubt, Respekt erheischen zu mussen. Mills, der so vieles getan
hat, was seine akademischen Kollegen schaudem machte, hat dies treffend be
schrieben: "Wer sich heute einer allgemeinverstindlichen Sprache zu bedienen
sucht, wird von vielen akademischen Kreisen als obertliichlich oder schlimmer
noch, als ,bloB literarisch' verurteilt. Bs liiBt sich unschwer erkennen, daB diese
Phrasen auf dem FehlschluB beruhen, was lesbar ist, sei obertliichlich ... ,Nur ein
Journalist' genannt zu werden, ist eine Herabwiirdigung. Sicherlich ist das baufig
der Grund fiir das Spezialistenvokabular und die gedrechselte Ausdrucksweise"
(1963; S. Z13).
Der AuBenstehende - und das ist inzwischen schon der nicht-soziologisch ge
schulte Kommilitoneoder Kollege aus dem anderenFachbereich geworden - steht
hilflos vor einer solchen abstrakten Sprache, findet sich und die ihn bewegenden
Probleme indieserSprache nichtmehrwiederodersiehtsie in Dimensioneneinge
ordnet, von denen er in verwegenster Kiihnheit oder Beschriinktheit nicht batte zu
triiumen gewagt. Sein Unvermagen, dies alles zu begreifen, verweist ihn nach
driicklich auf die Bbenedes Laien. So kommtes nichtvon ungefiibr, daB die Offent
lichkeit nicht selten aus der spezialisierten Fachsprache auf den Verstand des For
schers und ein Vermogen schlie8t, die untersuchten Probleme nicht nur als solche
einzuordnen, sondem auchzu /(Jsen. Doch dieser SchluB erweist sich oft als triige
risch, und es ist diese Bnttiiuschung, die schlie8lich engagierte Sozialwissenschaft
in eine Randposition driingt, die ihr technokratische Politiker gem zuweisen.
Wenn wir uns als Soziologen nicht mit einer irrelevanten Randposition zufrie
dengeben wollen, wenn wir verhindem wollen, daB die theoretische Diskussion in
intellektuelle Spielerei und schlimmer noch in Belanglosigkeit und Bntbehrlich
keit mundet, sollten wir uns fragen, ob die "maschinell gefertigte Prosa" (Mills,
1963; S. Z16) abstrakter Formulierungen nicht die Soziologie in die falsche Rich
tungtreibt. Bs istdie Sprache, an der wir glauben, einen Menschen zu erkennen, es
ist die Sprache, an der sich die Soziologie zu erkennen gibt. (Abels, 1975, S. 2'51f.)
6
Inhalt
Vorwort ...................................................................... 5
Soziologie und Alltag
"Was wir wissen" ........................................... 11
Einfiihrung .................................................................. 13
1. Anniiherung an den Gegenstand
Die "unbekannte" Wissenschaft ......................................... 15
2. Wir wissen Bescheid ....................................................... 19
2.1 Alltag und Routine ........................................................ 19
2.2 Routinen und Strukturen .................................................. 24
2.3 Die Erfahrung der gesellschaftlichen Wirklichkeit ................... 27
2.4 Wissen wir Bescheid? ..................................................... 31
3. Der scheinbare WuJerspruch:
Individuum und Gesellschaft ............................................. 35
3.1 Sind wir unser eigener Herr? ............................................ 42
3.1.1 Die Macht der Geschichte ................................................ 43
3.1.2 Die Macht des Gewissens ................................................ 44
3.1.3 Die Macht der anderen ................................................... 44
3.1.4 Kulturelle Gewillheit ...................................................... 45
3.2 Die Ahbiingigkeit von anderen auf dem Priifstand ................... 48
4. Vorurteile und Ideologie:
Vas ,Jalsche Wissen"? ................................................... 55
4.1 Vorurteile ................................................................... 56
4.1.1 Die "harmlose" Gedankenlosigkeit .................................... 56
4.1.2 Die "Denknotwendigkeit" von Vorurteilen ........................... 57
4.1.3 Die Korrektur der Wirklichkeit .......................................... 59
4.1.4 Anpassung .................................................................. 61
4.1.5 Projektion ................................................................... 62
4.1.6 Ausgrenzung ................................................................ 62
4.1.7 Zusammenfassung ......................................................... 64
7
4.2 Ideologie.................................................................... 65
4.2.1 "Gesellschaftliche Rechtfertigungslehre" ... ...... ....... .............. 66
4.2.2 Die "Seinsgebundenheit des Denkens" .......................... ...... 70
5. Soziologisches Denken I ................................................. . 75
Sozialisation und Interaktion:
"Wie wir werden, was wir sind" 79
Einleitung ................................................................... 81
li Sozialisation - ein Thema im Schnittpunkt sozialwissenschaJtlicher
Interessen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.1 Ein anthropologischer Aspekt:
Weltoffenheit und Entlastung ............................................ 84
6.2 Ein Beitrag der Psychoanalyse:
Uber-Ich und Internalisierung ........................................... 86
6.3 Eine soziologische Perspektive:
Sozialisation als Aneignung von Umwelt .............................. 94
7. Zwischen Bestimmtheit und Selbstbestimmung:
Interaktion und Rollenabernahme ....................................... 103
7.1 Vorsprachliche Interaktion ............................................... 103
7.2 Sprache und Denken: Symbolische Aneignung ....................... 105
7.3 Symbolische Aneignung und Interaktion ..... ......................... 106
7.4 Rolleniibernahme und die wachsende Welt:
von "signifikanten" und "generalisierten Anderen" ................ 109
7.5 Rolleniibernahme, Perspektivenwechsel und Identitiit ............... 112
7.6 Zusammenfassung......................................................... 116
8. Um der Interaktionsfiihigkeit zur Identitat:
Die Auseinandersetzung mit den Rollen ... ............ ....... .......... 121
8.1 Handlungs- und Strukturaspekt von Rolle ............ ....... .......... 121
8.2 Zur "Festlegung" von Rollen und Erwartungen in Interaktionen 123
8.3 Zur Komplexitiit sozialen Handelns ..................................... 127
8.4 "Funktionieren in sozialen Strukturen":
Internalisierung und Selbststeuerung ................................... 130
8.5 "Erfolgreiches" Rollenhandeln: Die Annahmen der
traditionellen und der interaktionistischen Rollentheorie ............ 132
8.6 Strukturelle Bedingungen und Handlungschancen:
Voraussetzungen fUr Prozesse der Identitiitsbildung .................. 136
8.7 Zusammenfassung ......................................................... 139
9. Zur Autonomie des handelnden Subjekts:
Aspekte der Identitatsdarstellung ........................................ 141
9.1 Rollen und soziale Identitiit .............................................. 142
9.2 Personliche Identitiit: Das Bewufitsein der eigenen Geschichte .... 147
9.3 Ich-Identitiit: Die Balance zwischen personlicher und sozialer Iden-
titiit ........................................................................... 151
9.4 Zusammenfassung.................. ........... ...... ...................... 152
8
Ein Perspektivenwechsel:
Sozialisation in der Gesellschaft ......................... 155
10. Gesellschaftliche Bedingungen der Sozialisation ..................... 161
10.1 Umweltaneignung und soziale Schicht .................. ....... ........ 161
10.2 Schicht und Handlungskompetenz ...................................... 164
10.3 Erziehungsziele - Leistungserwartungen ..................... ........ 168
10.4 Sprachstile und Umweltaneignung ...................................... 171
Exkurs: Die Sozialisationsfunktion der Schule ....................... 176
Exkurs: Schule und Bildungschancen .................................. 180
fl. Die Rolle der Soziologie in der Gesellschaft:
Soziologisches Denken fl ................................................. 185
Literatur ............ ................................ ...................... ... 197
9
1. Soziologie und Alltag
, ,Was wir wissen"
Einfiihrung
Das Problem jeder wissenschaftlichen Einfiihrung ist die richtige· Mischung
zwischen Verstandlichkeit und fachnotwendiger Abstraktion; zwischen breiter
Ubersicht und vertiefter Darstellung von Schwerpunkten. Diese Balance ist fUr
eine soziologische Einfiihrung schwieriger als bei den meisten anderen Wissen
schaften. Grund dafiir ist die Thtsache, da6 die Soziologie sich wissenschaftlich
mit Sachverhalten und Beziehungen des allmglichen Lebens beschliftigt und da
mit fUr den soziologisch Ungeschulten vielfach zur "Konkurrenz" fUr den, ,ge
sunden Menschenverstand" wird. Wir reden also oft fiber Dinge, die alle schon
kennen. Unsere Aufgabe als Soziologen wird es sein, demLeserplausibelzu ma
chen, da6 der "gesunde Menschenverstand" keineswegs so vemfinftig und zu
verliissig ist, wie er in der Alltagspraxis erscheint.
Insofem mfissen wir notwendige IDusionen oder "gesichertes Wissen" zerstO
ren, das TImen lieb und teuer sein mag.
Die Balance wird deshalb auch schwierig, well wir nicht den Eindruck entste
hen lassen wollen, Soziologen seien Besserwisser und Wichtigtuer, dieauch nicht
mehr als Altbekanntes anzubieten haben und es darum in einer "aufgeblasenen"
und komplizierten Sprache verpacken, damit es einen "wissenschaftlichen" An
strich erhiilt.
Wir glauben, da6 wir das "Balanceproblem" in dieser Einfiihrung recht gut
gelost haben, indem wir zwar in den Darstellungen auf Alltagserfahrungen zu
ruckgreifen, die wir dann allerdings soziologisch verarbeiten. "Soziologisch
verarbeiten" heillt vor allen Dingenanalvtisch vorzugehen. So wie der Chemiker
flir eine chemische Analyse mechanische und elektronische Instrumente sowie
erprobte Verfahrensweisen zur Verfiigung hat, urn die Zusammensetzung eines
Stoffes zu bestimmen und die Art der Zusammenhlingezwischen den Bestandtei
len zu beschreiben, hat auch der Soziologe Instrumente und Verfahrensweisen,
urn Strukturen und Zusammenhiinge in gesellschaftlichen Vorgiingen zu erken
nen undzu bestimmen. Die analytischen Instrumente des Soziologen sind jedoch
keine Geriiteund Apparaturen, sondem Begriffe, also Worte miteiner abstrahier
ten und von der alltagssprachlichen Wortverwendung abgegrenzten Bedeutung.
Die Bedeutung eines soziologischen Begriffes hat sich Dicht naturwfichsig ent
wickelt, sondem ist Ergebnis der analytischen Erprobung. D.h., mit soziologi
lichen Begriffen wird in der Untersuchung gesellschaftlicher Re8.llmt gearbeitet
pnJi iiberpruft, wie taQglich di~se Begriffe als Instrumente sind. Als Ergebnis die
ser dauemden Uberprufung werden Begriffe verfeinert, veriindert oder neu ent
wickelt.
"Soziologische Verarbeitung" von Alltagserfahrungen heillt darfiber hinaus
auchsystematische Veifremdung. Der Soziologe nimmtAlltagserfahrungen nicht
als das, was sie scheinen, sondem interessiert sich flir die vordergrfindig verbor-
13